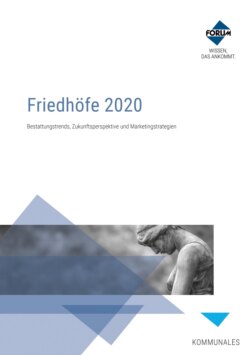Читать книгу Friedhöfe 2020 - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Trends in der Bestattungskultur
1.1 Baumbestattungen und weitere Formen der Naturbestattung
{Baumbestattung}
{Naturbestattung}
Im frühen 21. Jahrhundert wandelt sich die Bestattungs- und Friedhofskultur durch den Trend zu Naturbestattungen. Neben dem Friedhof wird die freie Natur zum Schauplatz von Beisetzungen. In vielen europäischen Ländern spielen Baum-, Berg-, Flussbestattungen u. Ä. eine immer wichtigere Rolle. Auch länger geläufige Formen der Naturbestattung, wie die Seebestattung, finden in diesem Umfeld neue Beachtung. In Deutschland stehen dabei Baumbestattungen und sog. Bestattungswälder im Vordergrund.
Bild 1: Der erste deutsche Bestattungswald, der Friedwald in Reinhardwald, Foto aus 2001 (Quelle: Norbert Fischer)
Allerdings stehen in Deutschland vielen Wegen der Naturbestattungen die Bestattungsgesetze der Länder entgegen. Ausnahmen sind das Bundesland Bremen, das seit dem 01.01.2015 u. a. das Verstreuen auf besonders ausgewiesenen öffentlichen Flächen erlaubt sowie die Anlage von Bestattungswäldern in Waldflächen und die Seebestattung.
Bestattungswälder wurden in den einzelnen Bundesländern seit 2001 schrittweise zugelassen.
Die v. a. in Norddeutschland praktizierte Seebestattung ist bereits seit den 1970er-Jahren bekannt und in den Bundesländern unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenregelungen unterworfen (in Schleswig-Holstein ist sie der üblichen Aschen- bzw. Erdbeisetzung gleichgestellt). In Teilen Österreichs ist die Flussbestattung von Aschen ebenso gesetzlich gestattet wie die Bergbestattung.
Im Umfeld zunehmender Popularität der Naturbestattungen verändern sich die Friedhöfe. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der verstärkte Einsatz von naturlandschaftlichen Elementen in der Gestaltung der Begräbnisplätze. Vielerorts werden die klassischen, abgegrenzten Reihen- und Familiengräber abgelöst durch naturnah gestaltete Miniaturlandschaften. Friedhofsflächen werden als Bestattungswälder gestaltet, auch Themenfelder wie „Baumgräber“ oder „Apfelgarten“ verweisen symbolisch auf den Trend zu naturnahen Bestattungsräumen.
Diese Entwicklungen repräsentieren für die Bestattungs- und Friedhofskultur das vielfältige Spektrum der aktuellen gesellschaftlich-kulturellen Wandlungsprozesse: Grenzen lösen sich auf, Übergänge werden fließend. Eine wichtige Rolle spielt dabei die stetig steigende Zahl von Feuerbestattungen und Aschenbeisetzungen. Entscheidend ist die – im Vergleich zur Körper-(Erd-)Bestattung – hohe Mobilität der Asche, die flexible Beisetzungsmöglichkeiten erlaubt und der Bestattungskultur neue Räume eröffnet. Auf dem Friedhof ermöglicht die platzsparende Urnenbestattung neue Gestaltungsmöglichkeiten.
1.1.1 Bestattung, Tod und Natur: zur Geschichte
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die Verknüpfung von Tod und Natur eine lange Tradition hat. Im bürgerlichen Zeitalter des 19. Jahrhunderts wurden neue Muster der Friedhofskultur entwickelt, bei denen Natur und Landschaft ein zentrales Leitbild bildeten. Einzelne Vorbilder stammten aus dem 18. Jahrhundert. Zwar frühe Ausnahme, jedoch in der Öffentlichkeit vielbeachtet, war der Friedhof der pietistischen Herrnhuter Brüdergemeine (Herrnhut, 1730) mit seinen gepflegten Rasenflächen und den für alle gleich gestalteten Grabstätten. Knapp 30 Jahre später erwarb der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock auf dem ländlichen Kirchhof von Ottensen am hohen Elbufer bei Altona eine naturgeprägte Grabstätte für seine früh im Kindbett verstorbene Frau Meta. Ein weiteres prominentes Beispiel für die Synthese von Tod und arkadischer Natur bildet das Inselgrab des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau im Park zu Ermenonville (1776/78). Wie die Klopstock-Grabstätte wurde es zu einer vielbesuchten Pilgerstätte des gebildeten Bürgertums. Der französische Philosoph sah den Garten als idealen Schauplatz jener Verschmelzung mit der Natur, von der er die wahrhafte ideale Bildung des bürgerlichen Individuums erhoffte.
Auch die Theorie wandte sich der Synthese von Tod, Friedhof und Natur zu. In seiner mehrbändigen, 1779–1785 erschienenen „Theorie der Gartenkunst“ widmete der Kieler Philosophieprofessor Christian Cay Lorenz Hirschfeld dem Friedhof eigene Abschnitte. Hirschfeld konzipierte hier den Friedhof als Parklandschaft nach englischem Muster.
Diese Visionen hingen mit veränderten Vorstellungen vom Tod zusammen. Natur und Landschaft sollten den Tod versöhnlich gestalten. Als Katalysator fungierte eine, durch die Malerei vorgeprägte Landschaftsästhetik, die Natur als arkadisches Idyll idealisierte. Nicht zuletzt spielte die in der Kulturgeschichte seit Langem verankerte Idee des Gartens als irdisches Paradies eine wichtige Rolle. Diese Ideale wirkten sich im bürgerlichen Zeitalter auf die Friedhöfe aus. Neben dem weithin als internationales Vorbild wirkenden Pariser Friedhof Père Lachaise als erstem europäischen Friedhof im Stil des englischen Landschaftsparks sorgte die aus den USA kommende „rural cemetery“-Bewegung (zuerst Mount Auburn, Cambridge/Massachusetts, 1831) für einen weiteren Ästhetisierungsschub.
In Deutschland waren es zunächst kleinere Anlagen, die naturlandschaftlich gestaltet wurden, u. a.
| • | der französisch-reformierte Friedhof in Hamburg 1825 und |
| • | der Domfriedhof in Braunschweig (Umgestaltung bis 1835). |
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden dann auch größere städtische Anlagen als Parkfriedhöfe gestaltet:
| • | Hauptfriedhof Schwerin 1863 |
| • | Südfriedhof Kiel 1869 |
| • | Friedhof Riensberg in Bremen 1875 |
| • | Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg 1877 |
Hier wurde eine möglichst naturnah gestaltete Sepulkrallandschaft zur Kulisse für eine immer monumentalere Grabstättenkultur.
Unter anderen Vorzeichen bildete im frühen 20. Jahrhundert der 1907 eröffnete Waldfriedhof München ein Beispiel naturnaher Bestattungen. Im Gegensatz zu heutigen Bestattungswäldern, bei denen die Asche im Wurzelbereich der Bäume beigesetzt wird, wurden hier die Grabstätten in einen vorhandenen Baumbestand hineinkomponiert. Der Waldfriedhof München wirkte als Vorbild für eine möglichst naturnahe Friedhofsgestaltung und war nicht zuletzt ein Gegenentwurf zu den durchgestylten Parkfriedhöfen des späten 19. Jahrhunderts.
1.1.2 Aktuelle Trends zu Naturbestattungen und ihre Voraussetzungen
Bestattungswälder {Bestattungswälder}
Im späten 20. Jahrhundert entstanden in Großbritannien frühe Ideen zur Naturbestattung. Sie wurden unter Stichwörtern wie „Green Burials“ oder „Natural Burials“ bekannt, bei denen Sarg- und Aschenbestattungen in Wäldern vorgenommen werden. Das 1991 in Großbritannien gegründete Natural Death Centre hat die Einrichtung sog. Natural Burial Grounds (Naturfriedhöfe) betrieben. Von der gemeinnützigen Organisation Earthworks Trust wurde im Jahr 2000 im englischen Nationalpark South Downs (Hampshire) ein 14 ha großer Naturfriedhof eröffnet, der nur Erdbestattungen vorsieht. Die Särge bestehen aus Weide, statt Grabmälern dienen Inschriften-Bänke der Erinnerung.
Der Trend hat sich letztlich in den heute in Deutschland bekannten Formen der Naturbestattung fortgesetzt. Als herausragendes und wichtigstes Beispiel sind die sog. Bestattungswälder zu nennen, die in Deutschland vorwiegend unter geschützten Markennamen von Unternehmen wie Friedwald GmbH oder Ruheforst GmbH privatwirtschaftlich vermarktet werden. Sie greifen mit ihrem Angebot auf besonders in Deutschland bis heute wirksame, romantische und naturmythologisch geprägte Auffassungen vom Wald zurück.
Bild 2: Beschilderung für den Bestattungswald in Wingst von der Ruheforst GmbH (Quelle: Norbert Fischer)
Die Baumbestattung in der freien Landschaft kollidierte zunächst mit den Bestattungsgesetzen der einzelnen Bundesländer, bevor diese nach und nach entsprechend novelliert wurden.
Friedwälder {Friedwälder}
Der erste „Friedwald“ entstand 1997 in der Schweiz (Mammern/Kanton Thurgau). Die Idee dieses „Friedwaldes“ liegt darin, die Aschenbestattung mit landschaftlich schöner Umgebung, v. a. aber mit Bäumen zu verbinden (in der Schweiz kann die Asche an jedem beliebigen Ort beigesetzt werden).
Der erste deutsche Bestattungswald wurde nach Schweizer Vorbild von der Friedwald GmbH 2001 im Reinhardswald zwischen Kassel und Göttingen eröffnet. Der Baum mit seinem Wurzelwerk in einem möglichst naturbelassenen Waldgebiet ist hier Grabstätte und Grabzeichen zugleich.
Dienten in der Frühzeit der Bestattungswälder lediglich Plaketten mit Nummern als Orientierungszeichen, so finden sich neuerdings immer häufiger Namensplaketten (Beispiel „Friedwald“ Neukloster bei Buxtehude). Die als solche belassene Umgebung des Waldes soll weitgehend naturnah wirken, die Bestattungsflächen sind nur bei genauerem Hinsehen zu erkennen. Es handelt sich um Urnenbeisetzungen auf gepachteten Grundstücken.
Bild 3: Andachtsplatz im „Friedwald“ Neukloster bei Buxtehude (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 4: „Friedwald“ Neukloster bei Buxtehude (Quelle: Norbert Fischer)
Weitere Anbieter von Bestattungswäldern
Neben der Friedwald GmbH ist die Ruhewald GmbH heute ein weiterer bedeutender Anbieter von Bestattungswäldern. Daneben gibt es mehrere, auch kommunale und kirchliche Einzelanbieter. Ein weiteres privatwirtschaftliches Konzept ist unter dem Namen „Final Forest“ bekannt und eröffnete 2014 ein Gelände für Waldbestattungen im Forstrevier der Gemeinde Hümmel (Eifel). Hier steht u. a. die Besonderheit eines besonders urtümlichen Waldbestands im Vordergrund.
Im „Wald der Ewigkeit“ im Mauerbachtal bei Wien gibt es keinerlei persönliche Kennzeichnung der Grabstätte. Vielmehr sind hier die einzelnen Bereiche nach allgemeinen symbolischen und emotionalen Themen angeordnet und können entsprechend ausgewählt werden, beispielsweise „Liebe“, „Treue“, „Frieden“, „Herz“ u. Ä.
Bild 5: Karte vom „Wald der Ewigkeit“ im Mauerbachtal in Wien (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 6: Der „Wald der Ewigkeit“ (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 7: Beschilderung im „Wald der Ewigkeit“ (Quelle: Norbert Fischer)
Ein kommunales Beispiel für Baumbestattungen ist der 2006 eröffnete und 2010 erweiterte Berg-Naturfriedhof „Ruheberg“ in Oberried (Schwarzwald). In seinem Mischwaldbestand können einzelne Urnengrabhaine oder sog. Friedhaine erworben werden. Bei Letzteren handelt es sich um Gruppen von zwölf Urnengräbern um einen Baum, die beliebige soziale Gruppierungen abbilden können und spezielle Namen erhalten, z. B. Familien oder Freundeskreise.
Baum- und Waldbestattungen {Waldbestattung} auf Friedhöfen
Inzwischen bieten auch reguläre, d. h. kommunale und kirchliche Friedhöfe solche Baumbestattungsflächen an. Einige Beispiele sind der Hauptfriedhof Kassel mit dem „Friedpark“, der Friedhof Ohlsdorf in Hamburg und der Neue Friedhof in Heiligenhafen mit ihren jeweils als „Ruhewald“ bezeichneten, mehr oder weniger weitläufigen Anlagen. Hier zeigt sich neuerdings, dass die Bäume auch als Ablage für individuelle Erinnerungszeichen dienen. In der Regel, aber nicht immer, handelt es sich um Aschenbeisetzungsflächen. Diese Anlagen gehen zurück auf jene Herausforderung, der sich die kommunalen und kirchlichen Friedhofsverwaltungen seit dem Aufkommen der Baumbestattung in freien Waldflächen ausgesetzt sehen.
Beispiel: Ohlsdorfer Ruhewald
Der 2006 eingerichtete und inzwischen deutlich erweiterte „Ohlsdorfer Ruhewald“ auf dem gleichnamigen Hamburger Friedhof zeigt sich als fast unberührte Waldlandschaft. In dem Mischwaldbestand werden um Bäume herum Urnengräber angelegt. Zum entsprechenden Beisetzungsbaum gehört eine in der Nähe aufgestellte pultartige Tafel, auf der die Art des Baums und ggf. auch der Name der Beigesetzten verzeichnet sind. Die genaue Beisetzungsstelle hingegen wird mit einem ebenerdigen Granitpfosten markiert. Auf größere Pflegearbeiten wird in diesem Areal – abgesehen vom saisonalen Mähen des Grases – ausdrücklich verzichtet, um den urtümlichen Charakter der Waldlandschaft zu erhalten. Blumenschmuck und Gestecke können entlang des Erschließungswegs abgelegt werden.
Bild 8: Der „Ruhewald“ in Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 9: Tafel, auf der die Art des Baums und der Name der Beigesetzten verzeichnet sind, im „Ruhewald“ Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Norbert Fischer)
Der Ohlsdorfer Friedhof bietet seit 2003 auch sog. „Baumgräber“ als Aschenbeisetzungsfläche an: ein mit Solitären, also Einzelbäumen, gestalteter Friedhofsbereich und Gemeinschaftsdenkmälern unter Bäumen (Eichen, Birken) ohne einzelne Grabzeichen. Es handelt sich hier um 100 x 50 cm große, mit zwei Urnen belegbare Wahlgräber. Namen und Lebensdaten der Verstorbenen können in gemeinschaftlichen Granitplatten verzeichnet werden. Die Anlage wird durch einen Rundweg erschlossen, der Außenbereich ist als sog. Wildwiese gestaltet.
Bild 10: Baumgräber in Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Norbert Fischer)
Weitere Beispiele
Im Ostseebad Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) bietet der „Ruhewald“ auf dem Gelände des Neuen Friedhofs eine Möglichkeit der Baumbestattung in einem noch relativ jungen Baumbestand. Es werden nur Urnen bestattet, Erinnerungsobjekte können angebracht werden. Zusätzlich erinnert ein kleines Schild an die Verstorbenen.
Bild 11: Der „Ruhewald“ in Heiligenhafen (Quelle: Norbert Fischer)
Es gibt viele weitere Beispiele für Friedhofsareale, die Bestattungen mit Baumsymbolik anbieten: Auf dem Friedhof im schleswig-holsteinischen Mölln gibt es einen sog. „Bestattungsbaum“, um den Aschengrabplätze gruppiert sind. In Unterschleißheim bei München werden seit 2016 große Bäume aus dem öffentlichen Raum, die beispielsweise Baumaßnahmen behindern, auf den städtischen Friedhof verpflanzt und dienen dort Baumbestattungen.
Bild 12: Der „Bestattungsbaum“ auf dem Friedhof Mölln (Quelle: Norbert Fischer)
Die Seebestattung {Seebestattung}
Eine schon länger bestehende Ausnahme von den gesetzlichen Restriktionen für Naturbestattungen in Deutschland bilden die sog. Seebestattungen (die präziser „Meeresbestattungen“ heißen müssten). Als Urnenbeisetzung im Meer ist sie eine Form der Naturbestattung, für die die grundsätzliche Bestattungspflicht auf Friedhöfen nicht gilt. Das deutsche Feuerbestattungsgesetz von 1934, das die Feuerbestattung der Erdbestattung erstmals allgemein gleichstellte, erlaubte mit behördlicher Genehmigung Ausnahmen von der Beisetzung der Asche auf einem Friedhof – und damit grundsätzlich auch die Seebestattung. Dies galt auf Antrag zunächst für bestimmte, der Seefahrt verbundene Personengruppen. Die Anfänge regulärer Seebestattungen für breitere Bevölkerungskreise in der Bundesrepublik Deutschland stammen aus den 1970er-Jahren. 1975 wurde auf Initiative des Bundesverbandes des Deutschen Bestattungsgewerbes die Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft e. G. (DSBG) mit Sitz in Kiel gegründet. Zwar setzt die Seebestattung nicht in allen Bundesländern, aber i. d. R. eine amtlich-behördliche Genehmigung voraus, um die Entbindung vom Friedhofszwang für Beisetzungen zu erhalten. Faktisch aber ist der rechtliche Zugang zur Seebestattung im frühen 21. Jahrhundert gelockert worden.
Zunächst erfolgen die übliche Trauerfeier sowie die Verbrennung im Krematorium. Anschließend wird die Asche in die gewünschte Küstenregion überführt, was je nach Entfernung unterschiedlich hohe Kosten mit sich bringt. Zwar sind die Aufwendungen für die Seebestattung zunächst generell höher als bei einer friedhofsgebundenen Aschenbeisetzung, allerdings entfallen die Folgekosten für Erwerb und Pflege einer Grabstätte. Die Seebestattung selbst wird von der Reederei, die vom jeweiligen Bestattungsunternehmen beauftragt wurde, mit einem speziell ausgestatteten Schiff vollzogen. Je nach Heimathafen fahren die einzelnen Schiffe genau markierte Beisetzungsgebiete an. In Deutschland geschieht dies in den meisten Fällen in der Nord- und Ostsee, aber Seebestattungen sind prinzipiell – verbunden mit entsprechend höheren Kosten – auch in anderen Meeren möglich. Um Schifffahrt und Badestrände nicht zu gefährden, wurden behördlicherseits strenge Regeln und Positionen für Seebestattungen festgelegt. Unter anderem dürfen Seebestattungen nur außerhalb der Drei-Meilen-Zone stattfinden. Die verwendeten Urnen müssen sich von selbst im Wasser auflösen.
Neue Formen der Erinnerungskultur
Die Seebestattung hat – wie auch andere Varianten der Naturbestattungen – neue Formen der Erinnerungskultur hervorgebracht. Für häufig frequentierte Meeresgebiete, z. B. Kieler Bucht und Lübecker Bucht an der Ostsee sowie Büsum an der Nordsee, werden jährliche Gedenkgottesdienste mit regelmäßigen Gedenkfahrten zum Beisetzungsort angeboten. Hinzu kommen allgemeine Gedenkstätten, die einem bestimmten Seebestattungsgebiet zugedacht sind, jedoch nicht die Namen der Seebestatteten aufführen (z. B. bei Travemünde an der Lübecker Bucht oder in Hooksiel am Jadebusen bei Wilhelmshaven).
Bild 13: Die Seebestattungsgedenkstätte in Hooksiel (Quelle: Manfred Sell)
Bild 14: Informationstafel der Deutschen See-Bestattungs-Genossenschaft in Büsum (Quelle: Norbert Fischer)
Darüber hinaus bieten einzelne Friedhöfe die Möglichkeit, die Namen von seebestatteten Personen auf einem Gemeinschaftsdenkmal vermerken zu lassen. Dies ist u. a. in Westerland auf Sylt, auf der Insel Norderney und im Ostseebad Großenbrode möglich. Teilweise werden dabei auch die Koordinaten des Bestattungsortes auf See verzeichnet.
Eine besondere Gedenkstätte für Seebestattungen mit namentlichen Kennzeichnungen wurde im Jahr 2011 von der Stadt Wilhelmshaven (Jadebusen/Nordsee) auf dem Rüstringer Berg eingeweiht. Unter dem Namen „Seefrieden“ besteht sie aus Holzstelen, die auf Messingtafeln die Namen der Seebestatteten mit den Geburts- und Sterbedaten sowie die Koordinaten des Seebestattungsorts tragen.
Allgemein ist die Seebestattung ein wichtiges Beispiel für das zunehmende Auseinanderfallen von Bestattung einerseits, Gedenken andererseits.
Weitere Formen der Naturbestattung auf Friedhöfen
Auf vielen Friedhöfen gibt es auch jenseits von „Ruhewald“ und „Baumgrab“ unterschiedliche Formen der Naturbestattung.
Wildblumenwiese
Ausdrücklich ökologisch orientiert ist die 2009 auf dem Neuen Teil des Friedhofs Ahrensburg (Schleswig-Holstein) eingeweihte „Wildblumenwiese“. Es handelt sich um ein 2 ha großes, von der evangelischen Kirchengemeinde verwaltetes Areal. Es diente zunächst in seinen Randbereichen, später auf weiteren Flächen als Aschenbeisetzungsanlage. Auch Baumbestattungen sind in diesem Bereich möglich.
Bild 15: Die „Wildblumenwiese“ auf dem Neuen Teil des Friedhofs Ahrensburg (Quelle: Norbert Fischer)
Naturfriedhof {Naturfriedhof}
Die Auflösung klassischer Friedhofsstrukturen gilt auch für den sog. Naturfriedhof „Garten des Friedens“ in Fürstenzell bei Passau, der an ein Krematorium angeschlossen ist. Abgegrenzte Grabstätten sind nicht mehr zu erkennen. Vielmehr sind vielfältig gestaltete Erinnerungsorte in eine weitgehend naturbelassene, nach geomantischen Prinzipien gestaltete Landschaft eingefügt.
Bild 16: Der Naturfriedhof in Fürstenzell (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 17: Der Naturfriedhof in Fürstenzell (Quelle: Norbert Fischer)
Weinberg-Friedhof
Seit 2017 werden Bestattungen im sog. Weinberg-Friedhof Bad Neuenahr-Ahrweiler angeboten. Inzwischen ist die fränkische Gemeinde Nordheim am Main mit einem vergleichbaren Angebot hinzugekommen.
Fluss-, Berg- oder Almbestattungen
Weitere Varianten der Naturbestattung, wie Fluss-, Berg- oder Almbestattungen, sind in Deutschland aus gesetzlichen Gründen nicht möglich. In Österreich werden Bergbestattungen von einem privaten Unternehmen in Werfenweng (Salzburg) angeboten. Im Bundesland Niederösterreich werden Flussbestattungen in der Donau praktiziert. Wie bei anderen Formen der Naturbestattung wird die Asche der Verstorbenen in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt.
Fazit
Im Übrigen zeigt sich der genannte Trend zu naturnahen Bestattungsformen auch in der Friedhofsgestaltung allgemein. Teile größerer Anlagen – wie der sog. „Park der Ruhe und Kraft“ auf dem Zentralfriedhof Wien – oder kleinere Anlagen – wie der Friedhof in Achim-Bierden bei Bremen – werden als landschaftliche Areale gestaltet. Gleiches gilt für die erstmals auf der Bundesgartenschau 2009 in Schwerin präsentierten „Memoriam-Gärten“. Im Rahmen des Friedhofsentwicklungs-Konzepts „Ohlsdorf 2050“ ist auf diesem Hamburger Friedhof geplant, große, für Bestattungen nicht mehr genutzte Bereiche nur noch extensiv zu bewirtschaften und als ökologische Flächen aufrechtzuerhalten.
Bild 18: Der „Park der Ruhe und Kraft“ auf dem Zentralfriedhof in Wien (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 19: Der „Park der Ruhe und Kraft“ auf dem Zentralfriedhof in Wien (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 20: Naturnahe Gestaltung auf dem Friedhof Achim-Bierden (Quelle: Norbert Fischer)