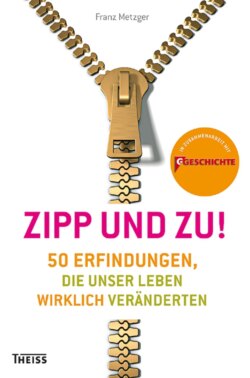Читать книгу Zipp und zu! - Franz Metzger - Страница 10
Оглавление[Menü]
Dosenöffner
Der lange Weg ans Eingemachte
Ob Erbsen, Möhren, Fisch, Fleisch oder Obst – in Konservendosen kann man seit dem 19. Jahrhundert nahezu alle Lebensmittel auf lange Zeit haltbar machen und platzsparend lagern. Doch die praktische Verpackung hatte zunächst einen großen Nachteil: Um sie zu öffnen, musste man rohe Gewalt anwenden – bis der Dosenöffner erfunden wurde.
Die traditionellen Methoden, Lebensmittel durch Trocknen, Pökeln, Räuchern, Einkochen oder Einlegen haltbar zu machen, bekamen 1803 eine delikate Konkurrenz: die Konservendose. Auf den Geschmack gekommen war ein Mann der Praxis, der französische Koch François Appert. Mit dem wissenschaftlichen Know-how seiner Landsleute Denis Papin und Joseph Gay-Lusset im Hinterkopf, lötete er verzehrfertige Speisen in Blechdosen ein und kochte sie mehrere Stunden. Beim Erhitzen wurden die den Nahrungsmitteln anhaftenden Bakterien abgetötet, und der hermetische Luftabschluss machte die Speisen lange haltbar. Apperts Erfindung verhalf Napoleons Grande Armée zu einer modernen Marschverpflegung, dem Erfinder trug sie einen Staatspreis und den Titel eines Konservenfabrikanten ein. Zum Verschließen der Dose verwendete man damals »ein Stück Blech von 1 Zoll größerem Durchmesser als die Büchse, das durch einen geschickten Blecharbeiter von unten Tropfen für Tropfen aufgelötet wurde.«
Ran ans Eingemachte
So weit, so gut. Was aber, wenn es ans Eingemachte ging? Napoleons Soldaten griffen zum Bajonett, der Polarforscher William Parry 1824 zu Hammer und Meißel. 1849 empfahl die Kochbuchautorin Henriette Davidis: »Das Aufmachen geschieht entweder durch Einschlagen des Deckels mittels eines Beiles oder mit einem alten Messer und einem glühenden Eisen«. Wem das Öffnen der Büchsen dennoch Probleme bereite, sollte sie vom Klempner öffnen lassen. Aber vorsichtig, denn Konservieren war damals sehr aufwendig und die teuren Büchsen sollten mehrfach benutzt werden. Man musste auch darauf achten, sich an den scharfen Blechkanten nicht zu verletzen, und dass das unter Einwirkung des heißen Eisens schmelzende Zinn nicht in die Speisen geriet. Der Franzose Bouvet schlug deshalb 1833 vor, zwischen Zarge und Deckel der Büchse einen Draht einzulöten. Durch Erhitzen lasse dieser sich mühelos entfernen und damit die Dose öffnen. Das Öffnen ging nun zwar leichter, aber das Zinn tropfte noch immer. Als Büchsen aus dünnem Weißblech hergestellt werden konnten (das heute verwendete Blech ist 0,14 mm stark), schlitzte man den Deckel einfach mit einem »Blechdosenmesser« über Kreuz auf und klappte die Ecken hoch.
Was aber, wenn es ans Eingemachte ging?
Napoleons Soldaten griffen zum Bajonett, der Polarforscher
William Parry 1824 zu Hammer und Meißel.
Der erste »richtige« Dosenöffner hatte ein Kaulkopf-Messer, das seinen Namen der Ähnlichkeit mit der Fischart Koppe verdankt. Das Messer befand sich unter dem Kopf, der Körper wurde zum Hebel. Messerschmiede stellten diese praktischen Helfer in Einzelanfertigung her. Anfangs waren sie nur im Besitz von Händlern, zu deren Service das Öffnen der gekauften Konserve gehörte. Als der industrielle und soziale Wandel das Familienleben veränderte und damit der Konservenkonsum – und die Nachfrage nach Dosenöffnern – anstieg, begann die Serienherstellung.
Die Produktion »am laufenden Band« hatte schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA, insbesondere in der Fleischmetropole Chicago, eine gigantische Konservenindustrie entstehen lassen. Um 1900 deckten Konserven in den USA bereits 30 Prozent des Nahrungsmittelbedarfs. Kein Wunder, dass 1858 ein gewisser Ezra Warner das erste Patent auf einen Büchsenöffner erhielt.
Die »Rote Clara« und der »Sieger« aus Solingen
Die Erfindung der Dosenverschließmaschine in den 1870er-Jahren veränderte die Form der Deckel, die nun gebördelt, maschinell gelötet oder gepresst wurden. Die Dose erhielt dadurch den heute typischen Rand. Deshalb war auch ein neuer Öffnertyp erforderlich: Griff und Messer mussten um die Höhe des Randes abgestuft und seitlich versetzt werden, damit die Noppe am Griff auf dem Rand aufsaß und das Messer hart am Büchsenkörper eindringen konnte.
Solch ein Dosenöffner kostete hierzulande um 1880 eine Mark. In einfacher Ausführung war er schon für 25 Pfennige, mit auswechselbarer Stahlklinge für 30 Pfennige zu haben. Der »Renner« des Jahres 1897 z. B. war das zirkelartig schneidende Modell »Rapid«. Legendär ist auch die »Rote Clara«.
Anfangs waren Dosenöffner nur im Besitz von Händlern,
zu deren Service das Öffnen der gekauften Konserve gehörte.
Die 1864 gegründete Firma Reutershan in Solingen erfand 1913 den Dosenöffner »Sieger«, der – mehrfach patentiert – nach dem Ersten Weltkrieg als Sensation galt. Durch bewegliche Anordnung des Messers wurde der Griff zur Ratsche, wobei ein Zahnkranz das Abrutschen an der Dose verhinderte.
Dann eroberten Scheren- oder Zangenöffner die Küche mit denen das Durchstechen des Blechs und das Festhalten der Dose erleichtert wurde und der Schneidevorschub per Drehflügel kraftsparend war. Schließlich wurde noch der Kaulkopf durch ein schräg stehendes, kreisrundes Messer ersetzt. Auch das Öffnen eckiger Büchsen (z. B. für Corned Beef), bei denen herkömmliche Öffner versagten, war für die Tüftler der Branche eine Herausforderung: Sie ritzten die Dosenwand am oberen Ende leicht ein und versahen sie mit einer Lasche. Diese steckte man in einen geschlitzten Metallstab mit Bügelgriff und öffnete die Dose durch Aufwickeln des sich abspaltenden Blechstreifens. Bei den flachen »Clubdosen« für Fischkonserven rollte man gleich den ganzen Deckel auf. Bügelöffner oder klappbare Miniöffner mit klassischem Reißhaken wurden – mit einem Löttropfen an die Dose geheftet – gleich mitgeliefert.
Um für jede Gelegenheit gewappnet zu sein, integrierte man den »Aufmacher« schließlich auch ins Taschenmesser. Für Profieinsätze, bei denen es um große Stückzahlen geht, wurden Wanddosenöffner entwickelt. Zu guter Letzt wurde der Dosenöffner sogar »elektrifiziert«: Ein Magnet hält den Deckel fest und ein motorgetriebenes Zahnrädchen zieht die Dose durch das Messer.
»Wem das Öffnen der Büchsen beschwerlich fällt,
lasse sie von einem Klempner vorsichtig öffnen.«
Henriette Davidis, Kochbuchautorin, 1849
Als um 1990 Büchsen mit Ring-Pull-Deckel auf den Markt kamen, schien der Dosenöffner überflüssig zu werden, denn durch kräftiges Ziehen am Ring lässt sich der vorgeprägte Deckel ohne Öffner »herausreißen«. Was bei Getränke- oder Erdnussdosen funktioniert, ist aber für große Gebinde wenig geeignet, ganz abgesehen von der Verletzungsgefahr.
Alle bisherigen Nachteile behebt nun die jüngste Dosenöffner-Generation der Kantenfrei-Dosenöffner durch die seitliche, gratfreie Schneidetechnik. Sie arbeitet ohne Messer, hinterlässt keine scharfen Kanten und ist 100 Prozent verletzungssicher. Der Dosenrand wird seitlich außen aufgetrennt und gleichzeitig umgebördelt. Dadurch lässt sich der Deckel wieder aufsetzen, und nicht aufgebrauchte Speisen können so einige Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Dosenöffner sind übrigens längst auch Sammlerobjekte – wer also noch ein Hobby sucht ...
Herbert Hartkopf