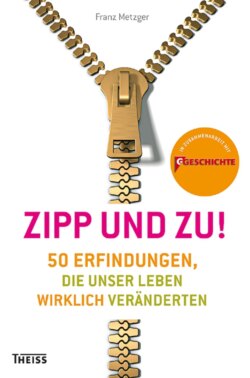Читать книгу Zipp und zu! - Franz Metzger - Страница 9
Оглавление[Menü]
Deodorant
Duften statt riechen
Schwitzen tun wir alle – aber doch bitte nicht so, dass es andere merken! Um das zu erreichen, hat die Menschheit seit den Tagen der alten Hochkulturen immer wieder neue Ideen ersonnen, den natürlichen Geruch zu »übertünchen«.
Alarm bei der Feuerwache von Büsum am 9. Februar 2007: Die Jugendherberge brennt! Die Fahrzeuge rasen los, doch am »Brandort« sind keine Flammen zu entdecken; man hört nur das durchdringende Signal des Rauchmelders. Die Einsatzkräfte erreichen die Lärmquelle: die Damentoilette. Dort schlägt den Rettern eine Duftwolke entgegen, die sie fast zu ihren Atemmasken greifen lässt. Des Rätsels Lösung: Eine Mädchengruppe hatte sich vor einem Discoabend derart mit Deospray »eingenebelt«, dass der Rauchmelder des Waschraums »SOS« funkte.
Am Hofe des »Sonnenkönigs« wurde vorzugsweise parfümiert statt gewaschen.
Um Körpergerüche zu überdecken, dufteten bald Schuhe, Taschentücher und Perücken.
Den jungen Damen im Nordseebad sei Verständnis entgegengebracht: Die Verwendung von Parfüm zur Überdeckung von Körpergeruch ist so alt wie die Zivilisation selbst. Doch für viele Menschen stellte es bis ins letzte Jahrhundert hinein ein Problem dar, unerwünschte Geruchs- und Schweißbildung zu verhindern. Schließlich empfanden nur wenige eine Vorliebe für libidinösen Wohlgestank wie Napoleon, der seiner geliebten Josephine geschrieben hatte: »Wasch dich nicht, ich komme heim!«
Ägyptische, jüdische und babylonische Priester waren die Ersten, die aus duftstoffhaltigen Blüten und Pflanzenteilen Parfüm herstellten – zu Ehren der Gottheit(en). Die Ägypter waren es auch, die die »Ganzkörperparfümierung« erfanden: Sie trugen auf den Köpfen Salbkegel, eine Crememasse, versetzt mit Oliven- und Sesamöl. In der Sonne löste sich die Masse langsam auf und lief über den ganzen Leib herab. Die antike Körperdusche erreichte auch die enthaarte Achselregion. Schon Nofretetes Zeitgenossinnen hatten herausgefunden, dass die Haare dort zu erhöhtem Schweißgeruch beitragen.
Düfte des Orients und Parfümhandschuhe
Im 13. Jahrhundert brachten die Krieger der Kreuzzüge allerlei Wohlgerüche wie Rosen- oder Narzissenöl aus dem Orient in ihre europäische Heimat mit. Allerdings galt es noch im Spätmittelalter als unschicklich, ja schädlich, die Haut mit Wasser zu waschen, vermutete man doch, dass so Krankheiten wie die Pest durch die Poren in den Körper eindringen könnten.
»Vor die Tugend haben die Götter den Schweiß gesetzt.«
Hesiod, griechischer Dichter, um 700 v. Chr.
Für das »gemeine Volk« waren diese Überlegungen ohnehin nur theoretisch. Wo sollte es die gewaltigen Summen hernehmen, um die exquisiten Essenzen zu erstehen? So war die Parfümfrage eine Frage für »hohe Herrschaften«. Die befassten sich dafür umso intensiver damit, ja kreierten nicht selten eigene Kompositionen. So führte Katharina von Medici im 16. Jahrhundert die Mode der parfümierten Lederhandschuhe an den europäischen Höfen ein.
Eine Folge der enormen Nachfrage nach den teuren östlichen Wohlgerüchen war die Suche nach »einheimischen Produktionsstätten«. Dies führte dazu, dass das südfranzösische Grasse seit dem 17. Jahrhundert zur Parfümmetropole Europas aufstieg. 700 Hektar Riechblumenkulturen entstanden in seiner Umgebung: Jasmin, Rosen, Lavendel, Orangenblüten. So dufteten bald Jacken, Schuhe, Taschentücher und Perücken modebewusster Aristokraten, um Körpergerüche zu überdecken. Dass sich am Hofe des »Sonnenkönigs« vorzugsweise parfümiert statt gewaschen wurde, ist in jedem Schulbuch nachzulesen.
Erst im 19. Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler die Verursacher der Körperdüfte: die Schweißdrüsen und Bakterien, die den Schweiß zersetzen. Die Schweißdrüsen (bis zu drei Millionen!) sind eigentlich dazu da, den Wärmehaushalt des Menschen durch den physikalischen Effekt der Verdunstungskälte zu regulieren. Ferner sorgt der Schweiß für die Geschmeidigkeit der Haut und für deren richtigen pH-Wert. Doch der Schweiß bietet auch den perfekten Nährboden für Bakterien, die den unguten Körperduft erzeugen. Nach ersten hautreizenden Versuchen mit Ammoniaktinktur erfand ein anonymer Entdecker 1888 im amerikanischen Philadelphia das erste moderne Antitranspirant auf Basis einer Zinksalbe: das Deodorant, auch Desodorant genannt. Damals wie heute bekämpft der »Entriecher« den Feind »Körperduft« mit zwei Waffen: Zum einen wird die Schweißbildung eingedämmt, zum anderen werden die Bakterien abgetötet. Im Wesentlichen enthalten die Deodorants Parfümbestandteile, Geruchsabsorber und keimhemmende Mittel.
»Pferde schwitzen,
Männer transpirieren,
Damen glänzen ...«
Amerikanisches Sprichwort
Mit Roller, Spray und Gel gegen die Bakterien
Der anonyme amerikanische Deoerfinder ließ sein Produkt unter dem Namen »Mum« von seinem Kindermädchen vermarkten. 1931 übernahm mit Bristol Myers eine bekannte Kosmetikfirma den weiteren Vertrieb. In den späteren 1940er-Jahren verwendete man dann nicht mehr Zinksalbe, sondern – wie noch heute – Aluminiumchlorid als Wirksubstanz. Damals stieß Helen Barnett Diserens zur Forschungsabteilung des Mum-Teams. Sie hatte die geniale Idee, das »Ball-point«-Prinzip des gerade erfundenen Kugelschreibers auf die Deos anzuwenden. 1952 kam das »Ban Roll-On« auf den Markt.
1965 folgte das erste Deospray und stand bald in jedem Badezimmer. Als aber erwiesen war, dass sein Treibmittel Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) höchst umweltschädlich ist, kehrte man verstärkt zu den älteren Verabreichungsformen zurück. Heute reichen sie vom Roller über den Stift bis zum Gel, vom Deotuch und Deokristall bis zur Deobanane.
In heutigen Tagen muss also niemand mehr »muffeln«, wenn es wieder einmal 35 Grad heiß ist. Nur das Schwitzen bleibt weiterhin keinem erspart. Doch auch hier gibt’s den kleinen, feinen Unterschied, lautet doch ein amerikanisches Sprichwort: »Horses sweat, men perspire, ladies glow – Pferde schwitzen, Männer transpirieren, Damen glänzen ...«
Harry D. Schurdel