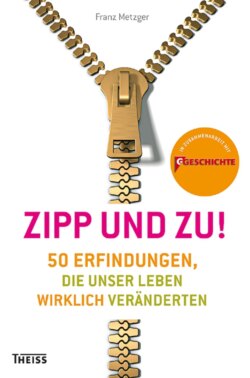Читать книгу Zipp und zu! - Franz Metzger - Страница 7
Оглавление[Menü]
Bikini
Chic am Strand
»Liebster, wie gerne möchte ich mit dir hinunter ans Wasser gehen ... Nur für dich trüge ich den neuen Badeanzug aus Memphis, aus reinem Leinen, geschnitten wie für eine Königin.«
Es sind bezeichnenderweise die Anfangszeilen eines Liebesgedichts, geschrieben um 1200 v. Chr. im alten Ägypten, die einen ersten schriftlichen Nachweis zur Geschichte der Bademode liefern. Diese frühzeitliche Poesie liefert auch die beiden kulturgeschichtlichen Kennzeichen: Es geht um weibliche Bademode und um ihre erotische Wirkung. Für die »Modehäuser« des Nillandes war die Bademode ein sehr lukrativer Aktivposten. Die nächste Kultur, die so etwas wie Badekleidung kannte, war jene Roms. Mosaike aus dem 3./4. Jahrhundert n. Chr. in römischen Villen auf Sizilien weisen darauf hin: Sie zeigen Mädchen beim Hanteltraining und bei Tanz- oder Gymnastikdarbietungen. Die Römerinnen tragen eine fascia pectoralis, ein »Busenband«, und eine kurze Dreieckshose, das subligaculum; die Kombination hieße heute Bikini. Zum Baden wurde sie wohl nicht benutzt, sondern als Fitnessdress. In den Badestuben des Mittelalters stieg man nackt oder allenfalls bedeckt mit der »Bruch(e)«, einer zusammengebundenen Dreieckshose, in den Zuber. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert galt Baden, zumal in den höheren Ständen, als unschicklich; bei der Körperreinigung war weniger Waschen als Pudern angesagt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etablierten sich geschlossene, den »Weibern« vorbehaltene Badehäuser. Dennoch gab frau sich dort zugeknöpft und badete in Unterkleidung: einem unter den Knien zusammengeschnürten Beinkleid, einem Miederleibchen (»Kamisol«) oder einem Hemd mit Puffärmeln, und Strümpfen.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war wieder gemeinsames, öffentliches Baden angesagt. Und Badekleidung wurde ein Gegenstand der Mode – unter Wahrung etwaiger Sittlichkeitsgebote, versteht sich. Nur die männliche Bademode sträubte sich jeder modischen Vereinnahmung, nicht zuletzt mangels Form und Figur der (meisten) Träger. Lediglich das preußische Militär, das gern alles regelte, kreierte Ende des 19. Jahrhunderts eine reichlich einfallslose »Badeuniform«: einen gestreiften, einteiligen Trikotbadeanzug. Der Zivilist ging vorerst weiter mit Unterbeinkleid und Leibchen an den Strand oder in die Badeanstalt. Um die Jahrhundertwende griff dann auch er zur einteiligen Trikotfassung. Erst in den 1930er-Jahren wurde das Oberteil der Herren weiter ausgeschnitten, bekam Träger und – höchste Form maskuliner Erotik – wurde mit Löchern versehen. In den USA kannte man schon länger die Badehose mit Gürtel, der später durch eine innen eingezogene Schnur ersetzt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Badehosen aus schnell trocknendem, formstabilem Synthetik in Mode, und vor gut zehn Jahren sah man die ersten Badehosen mit hohem Beinausschnitt.
Vom knöchellangen Badekleid zum Bikini
Zurück zur entschieden attraktiveren Damenbadekleidung, obgleich diese bis in die 1920er-Jahre mehr von verhüllenden als offenbarenden Modellen geprägt war: Knöchellange Beinkleider, mit und ohne Matrosenkragen, Badekappen und Halskrausen (zum Schutz des Teints) waren die »Renner«. Dann wurden die Badekleider kürzer, die Hose verschwand, wurde aber durch schwarze Strümpfe ersetzt. Das Oberteil bekam mittels Fischbeinstäben »Figur«. Der nächste »letzte Schrei« war der eng anliegende Einteiler, erstmals getragen von der amerikanischen Schwimmerin Annette Kellermann anno 1900. Vollends durchsetzen sollte er sich erst 20 Jahre später. Etliche Badeanstalten erließen einschränkende »Ausführungsbestimmungen«; so musste vielerorts über dem Einteiler ein Rock getragen werden, der zumindest den Hosenbeinansatz zu verdecken hatte. Aber bunter ging es endlich zu: Am Strand tauchten farbenkräftige, unversteifte Badekleider aus Satin, Kretonne, Taft und anderen feinen Stoffen auf. Seit 1928 wurde der (Männer-)Blick erweitert durch im Rücken, seitlich und unter der Achsel ausgeschnittene Badekleider.
Die wahre Baderevolution erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg und hatte einen ebenso erotischen wie exotischen Namen: »Bikini«, ein Zweiteiler aus Büstenhalter und Schnürhöschen. Bis heute ist der Bikini Inbegriff weiblicher Badebekleidung. Der Erfinder des stofflichen »Nichts« war, wen wundert’s, männlich und, auch das keine Überraschung, Franzose. Aber kein Modeguru hatte die Erfolgsidee, sondern der Maschinenbauingenieur Louis Réard (1903–1984). Den Namen für das neue Textil entnahm sein »Entdecker« der Tagespresse: Am 1. Juli 1946 hatten die Amerikaner auf dem winzigen Pazifikatoll Bikini ihre dritte und vierte Atombombe »zu friedlichen Forschungszwecken« gezündet. Réard bezog sich mit dem Namen sowohl auf die Sparsamkeit des Stoffes wie die »Sprengkraft«, die davon ausgehen sollte. Wie recht er hatte: Erst mit dem Tragen eines Bikinis sollte der just entstandene Begriff »Sexbombe« seine volle Wirkung entfalten. Doch aufgrund der damals geltenden Anstandsregeln wollte kein Mannequin das »süße Nichts« präsentieren. So warb Réard eine Tänzerin aus dem »Casino de Paris« an, Micheline Bernardi. Am 5. Juli 1946 stellte sie im Pariser Nobelbad »Molitor« den Zweiteiler vor. Es war ein »Bombenerfolg«: Das Publikum war entzückt, das Bikinifoto ging um die Welt. In kurzer Zeit trafen über 50 000 begeisterte Zuschriften, meist Briefe männlicher Verehrer, in der Seinestadt ein.
Der Erfinder des stofflichen »Nichts« Bikini war, wen wunderts männlich ...
Wenig später trugen auch die ersten Filmstars Bikinis, allen voran Brigitte Bardot 1953 am Rande der Filmfestspiele in Cannes. Um 1960 hatte sich der Bikini endgültig durchgesetzt, nicht zuletzt nach »offizieller« Absegnung durch das Modemagazin »Harper’s Bazar«. Für kurze Zeit stahl 1970 ein ganz anderer »Einteiler« dem Bikini die Schau: Am Strand von St. Tropez sonnten sich die ersten Damen »oben ohne«. Doch getreu dem Grundsatz, dass eine raffinierte Verhüllung meist erotischer wirkt als pure Nacktheit, kam der Bikini wieder zu Modeehren. Sogar als Geldanlage taugt er, vorausgesetzt er hat die entsprechende »Vergangenheit«: Im Februar 2001 versteigerte das Londoner Auktionshaus »Christie’s« für rund 127 500 DM den berühmtesten Bikini der Welt. In jenem elfenbeinfarbenen Badedress verführte Ursula Andress im James-Bond-Film »Dr. No« Sean Connery alias 007.
Harry D. Schurdel