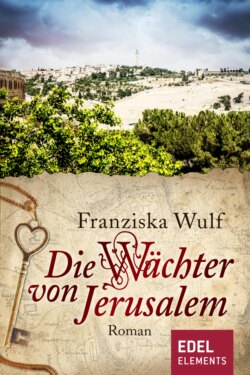Читать книгу Die Wächter von Jerusalem - Franziska Wulf - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Vorbild
ОглавлениеSie hatten kaum das Stadttor hinter sich gelassen und waren außerhalb der Sichtweite der Soldaten, als Stefano taumelte und beinahe gestürzt wäre. Er keuchte, das Blut rauschte in seinen Ohren, seine Knie zitterten und drohten unter ihm nachzugeben. Sie waren weich wie Butter, die lange in der Sonne gestanden hatte.
»Stefano, mein Sohn, was ist mit dir?« Pater Giacomo blieb stehen. Er lächelte immer noch, und Stefano fragte sich, woher er diese Gelassenheit und Zuversicht nahm. »Mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut.«
»Aber ... Pater, dieser ... dieser Soldat ... er hat ...« Er konnte nicht weitersprechen. Bei dem Gedanken, dass der Soldat, ein Moslem, die Flasche berührt hatte, jene Flasche, in der Pater Giacomo das größte Heiligtum aufbewahrte, das die Christenheit kannte, das Blut des Herrn Jesus Christus, wurde ihm schwindlig. Er hatte erwartet, dass dem Frevler auf der Stelle der Arm abfallen würde. Oder doch wenigstens Gottes Zorn in Form eines Blitzes auf das Tor niedergehen und es in Schutt und Asche legen würde, wie damals Sodom und Gomorra. Und doch war nichts geschehen.
»Ich weiß, mein Sohn, dieser Soldat hat die Flasche berührt. Doch wir brauchen uns deshalb nicht zu sorgen. Er hat nur das Gefäß in der Hand gehabt, er hat das Glas angefasst, und das ist unbedeutend. Das heilige Blut unseres Herrn wurde nicht besudelt«, sagte Pater Giacomo. Dann beugte er sich zu Stefano. Sein Mund lag jetzt dicht an seinem Ohr, und er sprach so leise, dass niemand sonst auf der Straße ihn hören konnte. »Glaub mir, dieser Bursche wird für seinen Frevel bezahlen. Gott wird ihn strafen, wenn es an der Zeit ist.« Er richtete sich wieder auf und legte Stefano eine Hand auf die Schulter. Seine Augen glänzten. »Komm jetzt, mein Sohn, lass uns weitergehen. Der Herr hat uns vor der drohenden Gefahr beschützt. Und Er wird uns auch weiterhin Seinen Segen geben, wenn wir treu bleiben und nicht von Seinem Pfad abweichen.«
Pater Giacomo packte seinen Stab wieder fester und schritt voran. Stefano rappelte sich auf und beeilte sich, ihm zu folgen. Pater Giacomo hatte natürlich Recht. Trotzdem konnte er den Soldaten am Tor nicht aus seinem Kopf verbannen. Seine ungewöhnlichen strahlend blauen Augen schienen ihn immer noch mit ihrem Blick zu verfolgen. Deutlich, als würde der Soldat direkt vor ihm stehen, sah er die seltsame hohe, mit goldenen Kordeln verzierte Mütze und die bunte Kleidung vor sich, deren Farben so grell und leuchtend waren, dass sie Stefano fast geblendet hatten. Und immer noch liefen ihm Angstschauer über den Rücken, wenn er an den Säbel dachte, der am Gürtel des Soldaten baumelte. Die blitzende Klinge machte einen tödlich scharfen Eindruck. Vielleicht war sie sogar scharf genug, um Haare damit spalten oder einen Kopf mit nur einem einzigen Hieb vom Rumpf trennen zu können. Obwohl sie weit gereist und bereits seit vielen Jahren unterwegs waren, um von ihrer Heimat, einem einsam gelegenen Kloster in den Bergen von Umbrien, nach Jerusalem zu gelangen, hatte Stefano nie zuvor solche Soldaten gesehen. So schön und so erschreckend gefährlich zugleich.
»Wer sind diese Soldaten am Tor?«, fragte Stefano, als er Pater Giacomo nach ein paar Schritten eingeholt hatte.
»Es sind Janitscharen, mein Sohn«, antwortete dieser so bereitwillig, wie er ihn alle Dinge lehrte, die er wissen musste. »Sie selbst bezeichnen sich gern als die Wächter von Jerusalem, als Mündel des Sultans. Doch in Wahrheit sind sie Kinder aus jenen christlichen Provinzen, die von den Moslems erobert wurden. Ihren richtigen Familien wurden sie gewaltsam entrissen. Sie sind arme Seelen, die unter den Geierschwingen der Osmanen vom rechten Pfad abgedrängt wurden, um anstelle der Wahrheit der Bibel den Lügen des Korans zu folgen.« Pater Giacomo seufzte und schüttelte betrübt den Kopf. »So viele vortreffliche junge Männer sind auf diese Weise dem Feind in die Hände gefallen! Aber noch sind sie nicht verloren, wenigstens nicht alle. Wer weiß, vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen von ihnen wieder zum wahren Glauben zurückzuführen. Auch dies wird hier unsere Aufgabe sein.«
Stefano warf Pater Giacomo einen bewundernden Blick zu. Auf jede seiner Fragen kannte er die Antwort. Sein Wissen war so unermesslich groß, so umfassend. Manchmal glaubte er, dass es ihm die Engel Gottes offenbart haben mussten.
Sie gingen die Straße entlang, die schmal war im Vergleich zu den Straßen in anderen Städten, welche sie auf ihrer Reise gesehen hatten. Und doch war alles erfüllt von Leben. Männer und Frauen in den unterschiedlichsten Gewändern eilten an ihnen vorbei. Schafe blökten, Ziegen meckerten, Kinder spielten auf der Straße Verstecken und andere seltsame Spiele, die Stefano nicht kannte. Ein Mann schleppte einen Käfig voller weißer Tauben auf seinem Rücken. Die Tiere flatterten in ihrem engen Gefängnis aufgeregt umher, sodass weiße Federn den Weg des Mannes säumten. Nein, Jerusalem war anders. Ganz anders als jede Stadt, die er kannte.
In ehrfürchtigem Staunen blickte sich Stefano um. Oft schon hatte er seinen Fuß über die Schwelle der Tore der Heiligen Stadt gesetzt–in seinen Träumen. Doch selbst in den kühnsten unter ihnen war sie ihm nie so prächtig und erhaben erschienen. Jerusalem. Die Stadt, in der der Herr Jesus Christus gepredigt hatte, in der Er, der Sohn des lebendigen Gottes, zum Wohle aller Menschen den Weg des Leidens gegangen war. Hier war Er ans Kreuz geschlagen worden und drei Tage später im Triumph über Tod, Sünde und seine Feinde wieder auferstanden. Jerusalem. Stefano konnte es kaum fassen, dass seine Füße gerade jene Steine berührten, über die der Herr Jesus Christus auch gewandelt war. Am liebsten wäre er auf die Knie gesunken, um die Steine zu küssen.
»Stefano, was ist mit dir?« Pater Giacomos Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Du stehst da und machst Augen, als wäre dir soeben der Engel der Verkündigung erschienen. Es fehlt wohl nicht viel, und du fällst noch mitten auf der Straße auf die Knie.«
Unter Pater Giacomos belustigtem Blick wurde Stefano rot.
»Verzeiht, Pater, aber ...«
»Schon gut, mein Sohn, schon gut.« Pater Giacomo tätschelte ihm die Schulter. »Ich kann dich verstehen. Du bist jung. Doch hebe deine Ehrfurcht und dein Staunen für den Augenblick auf, da wir wahrhaftig am Grab des Herrn stehen werden. Dies hier«, er deutete auf die Mauern und das Tor, das hinter ihnen lag, die Straße vor ihnen und die Häuser ringsum, »dies alles ist lediglich Menschenwerk. Und es kann ebenso leicht wieder zerstört werden, wie es erbaut wurde. Während die Werke unseres Herrn Jesus Christus bis in alle Ewigkeit fortbestehen werden. Komm, Stefano, lass uns unseren Weg fortsetzen.«
Sie gingen durch das verschlungene Labyrinth der Straßen, durchschritten kleine Torbögen, überquerten Plätze und kamen durch Gassen, die so schmal waren, dass Stefanos Schultern die Hauswände rechts und links berührten. Endlich öffnete sich die Straße ein wenig. Sie standen vor einem Säulengang, und dahinter lag ein Platz, an dessen Stirnseite ein großes Gebäude stand.
»Wir sind am Ziel«, sagte Pater Giacomo und schritt lächelnd aus. »In wenigen Augenblicken stehen wir am Grab des Herrn.«
Stefano verharrte in ungläubigem Staunen. Hatte Pater Giacomo ihm nicht erzählt, er sei selbst das erste Mal in Jerusalem? Und doch hatte er durch das Gewirr der Straßen und Gassen den richtigen Weg gefunden, ohne auch nur ein einziges Mal danach fragen zu müssen. Mit der Sicherheit und Unfehlbarkeit einer Brieftaube hatte er seinen Weg gefunden. Oder hatte der Herr ihn geführt? War ihnen ein Engel vorausgeeilt, den Stefano nur deshalb nicht sehen konnte, weil sein Glaube nicht stark genug war?
»Komm, Stefano!«, rief Pater Giacomo, der schon beinahe die große Flügeltür der Kathedrale erreicht hatte. »Nun komm schon!«
Stefano schluckte. Und dann lief er so schnell ihn seine Beine trugen hinter Pater Giacomo her.
Der linke Seitenflügel der Tür stand offen. Langsam und bedächtig traten sie in den Vorraum der Kirche. Das Licht, das durch die geöffnete Tür und die schmalen, hohen Fenster fiel, reichte gerade aus, um den Vorraum zu erhellen. Alles dahinter lag im Dunkeln. Und es war still. Es war so still, dass Stefano sein eigener Atem laut wie das wütende Schnauben eines Stieres vorkam. Außer ihnen schien kein Mensch anwesend zu sein. Umso mehr erschrak er, als ein Mann auf sie zutrat, so plötzlich, als wäre er soeben aus dem Nichts aufgetaucht.
»Willkommen in der Grabeskirche, Pilger«, sagte er. Er trug eine Kopfbedeckung, wie Stefano sie nur von den Moslems kannte. Auch seine Kleidung war muslimisch, und er hatte einen buschigen Bart, der fast bis zu seiner Brust reichte. Er rieb seine Hände wie ein Mann, dessen Laden sie betreten hatten und der jetzt ein lohnendes Geschäft witterte. Was konnte er nur hier wollen?
»Guten Tag«, erwiderte Pater Giacomo und betrachtete den Mann mit gerunzelter Stirn von Kopf bis Fuß. »Wer seid Ihr?«
»Mein Name ist Ali al Nuseibeh«, antwortete er und verneigte sich höflich. »Ich bin der Torwächter dieser christlichen Pilgerstätte. Sofern Ihr sie betreten wollt, muss ich Euch um eine angemessene Summe bitten.«
Er lächelte und streckte ihnen die geöffnete Hand entgegen. Dabei war er gewiss kein Bettler, denn seine Kleidung war sauber und von ausgesuchter Qualität.
»Wer bei allen Engeln im Himmel gibt dir das Recht ...«
»Dieses Recht, Pilger, und die damit verbundene Aufgabe, über diese Pilgerstätte zu wachen, hat meine Familie bereits seit mehr als zweihundert Jahren inne«, erwiderte der Moslem. »Und jeder Christ muss sich fügen. Oder diesen Ort wieder verlassen.«
Pater Giacomo stieß seinen Stab heftig auf den Boden. Das Holz ächzte, und es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre zerbrochen. Dann wühlte er aus einem kleinen ledernen Beutel ein paar Münzen hervor.
»Nun gut«, sagte er, und Stefano wunderte sich, wie er trotzdem so ruhig und freundlich bleiben konnte. Er selbst war entsetzt über die Dreistigkeit des Mannes. »So geben wir denn dem Sultan, was des Sultans ist. Dreißig Silberlinge wären wohl passender, leider besitze ich nur fünf.«
Der Moslem lachte und nahm die Münzen. Dann verneigte er sich und trat einen Schritt zur Seite.
»Bitte, geht, edle Pilger«, sagte er spöttisch. »Ihr dürft so lange bleiben, wie es Euch beliebt. Allerdings werde ich die Tür vor Sonnenuntergang verschließen. Wenn Ihr die Nacht nicht hier verbringen wollt, solltet Ihr die Kirche vorher wieder verlassen haben.«
Er kehrte in seine Nische zurück, die er sich mit Kissen, Fellen, einem Tisch und allerlei anderen Annehmlichkeiten recht behaglich eingerichtet hatte. Es machte fast den Eindruck, als würde er hier wohnen.
Pater Giacomo biss die Zähne zusammen, dass Stefano es knirschen hörte. Jeder Tropfen Blut war aus seinen Wangen gewichen. So aufgebracht hatte er seinen Lehrer nie zuvor gesehen.
»Diese Erben Beelzebubs verlangen Geld«, zischte er voller Entrüstung. »Sie verlangen wirklich Geld von uns, damit wir an der Stätte beten können, an der unser Herr leiden musste, an der Er begraben wurde und wieder auferstand.« Er zitterte vor Zorn. »Diese Höllenbrut! Diese elenden Söhne Satans! Doch das wird sich ändern. Ich schwöre bei Gott und allen seinen Engeln, dass sich das ändern wird. Schon bald wird sich das ändern. Schon bald.«
Sie gingen durch mehrere Kapellen und Seitenschiffe, treppauf und treppab. Stefano war froh, dass Pater Giacomo an seiner Seite war, andernfalls hätte er nie wieder aus diesem Labyrinth von Kapellen, Altären und Säulengängen hinausgefunden. In seinem ganzen Leben hatte er noch kein derart verwinkeltes und verwirrendes Gotteshaus betreten. Es schien nicht aus einer Kirche, sondern aus vielen aneinander gebauten Kapellen zu bestehen. Und wenn sich zur Zeit noch andere christliche Pilger außer ihnen hier aufhielten, so verbargen sie sich irgendwo im unübersichtlichen Gewirr der Nischen, Altäre und Kapellen.
Auf ihrem Weg begegnete ihnen keine Menschenseele. Und nachdem er sich von den Schrecken über den unverschämten Torwächter und die Weitläufigkeit des Gebäudes erholt hatte, begann Stefano sogar die Stille und Einsamkeit zu genießen. Es war eine Wohltat im Vergleich zu dem hektischen orientalischen Treiben vor den Pforten der Kirche, wo Tiere und Menschen in scheinbar heillosem Durcheinander umherliefen und mehr fremde Sprachen auf der Straße erklangen als nach dem Fall des Turmbaus zu Babel.
Und dann – endlich – hatten sie es erreicht. Vor ihnen, mitten zwischen all den anderen Kapellen und Altären, öffnete sich ein kleines bescheidenes Gebäude.
»Das Grab unseres Herrn«, flüsterte Pater Giacomo und zog sich die Kapuze über den Kopf. »Bedecke auch du dein Haupt, Stefano, um dem Herrn die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt.«
Sie betraten den Vorraum des Gebäudes, in dessen Mitte ein Stein stand. Es handelte sich um einen schlichten grauen Block, der aussah, als hätte ihn ein Steinmetz hier vergessen.
»Dies ist der Stein, auf dem der Engel saß«, erklärte Pater Giacomo. »Der Engel aber sagte zu den Frauen: ›Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag.‹« Seine Stimme bebte, als er die Worte aus dem Evangelium zitierte, und seine Hand zitterte, als er sie ausstreckte, um den Stein zu berühren. Ja, er streichelte den rauen Fels, als ob es sich um das Haar eines liebgewonnenen Menschen handelte. Dann legte er Stefano eine Hand auf die Schulter. »Komm, mein Sohn. Wie die Frauen in der Heiligen Schrift, so lass auch uns die Stätte sehen, an welcher der Herr gelegen hat.«
Langsam, einen Schritt vor den anderen setzend, gingen sie auf die schmale Öffnung zu. Sie mussten sich bücken, um das Innere des Grabes zu betreten. Kerzen, dutzende, vielleicht sogar hunderte von Kerzen standen in den Nischen und auf dem Sims, der sich einmal rings um die kleine Grabkammer zog. Auf einem rechteckigen Steinblock, einem Sarkophag nicht unähnlich, lag ein großes weißes Tuch. Ob es das Grabtuch des Herrn war, das die Frauen hier noch liegen gesehen hatten? Stefano erschauerte und sank auf die Knie. Er war in einem Kloster unter Mönchen und Priestern aufgewachsen. Seit er denken konnte, hatte er täglich die Messe besucht. Er hatte gebetet, gefastet und so oft die Worte aus der Bibel gehört, dass er mittlerweile viele Kapitel und Psalmen auswendig kannte. Und doch hatte er sich niemals zuvor in seinem ganzen Leben dem Herrn Jesus Christus näher gefühlt als hier, in diesem kleinen, bescheidenen, schmucklosen, von Kerzen erleuchteten Raum.
Wie lange er da kniete und betete, hätte Stefano nicht sagen können. Er erwachte wie aus einem Traum, als sich eine Hand auf seine Schulter legte. Überrascht sah er in Pater Giacomos Gesicht, der neben ihm kniete und sich nun ächzend und stöhnend erhob. Auch Stefanos Beine waren fast taub, und seine Knie wollten sich nur widerstrebend strecken wie die rostigen Scharniere einer alten Tür, die lange nicht benutzt worden war. Sie sprachen kein Wort. Erst als sie wieder auf dem Platz vor der Kirche standen und das Sonnenlicht und der Lärm der Stadt sie in die diesseitige Welt zurückriss, wich die ehrfürchtige Starre allmählich von ihnen.
»Was sind das nur für Narren!«, sagte Pater Giacomo. Seine Stimme bebte immer noch. Allerdings hatte Stefano den Eindruck, dass jetzt ein deutlich zorniger Unterton mitschwang. »Sie stehen an dieser heiligen Stätte, ihre Füße berühren diese Steine, dieselben, auf denen wir gerade stehen. Und dennoch glauben sie nicht, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, der gesandt wurde, um die Menschen von Sünde und Tod zu erlösen.« Er schüttelte den Kopf und fuhr leise fort. »Für diese Gottlosen gibt es keine Rettung. So viel Dummheit, Ignoranz und Überheblichkeit muss bestraft werden.«
»Was werden wir jetzt tun, Pater? Wir haben nicht mehr viel zu essen. Und unser Geld habt Ihr dem Mann in der Kirche gegeben. Wie sollen wir ...«
»Wie die Lerchen auf dem Feld, so wird auch uns der Herr ernähren«, sagte Pater Giacomo. »Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Zuerst werden wir uns eine Herberge in einem christlichen Haus suchen. Und von dort aus beginnen wir mit der Erfüllung unserer Aufgabe. Anfangs mag noch das Haus unserer Gastgeber ausreichen, wenn wir die wahren Gläubigen zusammenrufen, um mit ihnen zu beten und das Brot zu brechen. Doch schon bald werden wir einen größeren Versammlungsort brauchen, einen Ort, der im Verborgenen liegt, wo wir uns in aller Verschwiegenheit mit jenen Brüdern und Schwestern im Glauben treffen können, bei denen unsere Botschaft auf fruchtbaren Boden gefallen ist.«
»Im Verborgenen? Aber ich dachte ...«
»Anfangs, mein Sohn«, erklärte Pater Giacomo und legte ihm einen Arm um die Schulter, »anfangs werden wir im Geheimen arbeiten müssen, bis wir den Kampf aufnehmen können. Wir haben viele Feinde in dieser Welt, Und damit meine ich nicht nur die gottlosen Moslems mit ihren Janitscharen. Da sind die Juden, an deren Händen das Blut unseres Herrn klebt. Selbst aus den Reihen der Christen werden wir mit Anfeindungen rechnen müssen. Sie werden uns nachspüren, uns jagen, sie werden versuchen, uns zu fangen, denn sie haben Angst vor uns. Sie haben Angst vor uns und unserer Botschaft, die das Ende ihrer eigenen Herrschaft bedeutet. Sie alle werden nicht tatenlos dabei zusehen, wie es uns gelingt, sie aus dieser Stadt zu vertreiben.«
Stefano schluckte. Ihm wurde bewusst, dass er sich auf ihrem ganzen Weg nach Jerusalem keine Gedanken darüber gemacht hatte, woraus nun eigentlich die Aufgabe bestand, von der Pater Giacomo unablässig sprach. Und jetzt, da sie hier in Jerusalem waren und es ihm zum ersten Mal klar wurde, bekam er Angst. Pater Giacomo sprach von einem Kampf. Und ganz gleich, mit welchen Waffen er auch ausgefochten werden würde, er war gefährlich. Stefanos Herz begann schneller zu schlagen, und er hatte nur noch einen Wunsch–weit fort zu sein. Am besten in dem kleinen friedvollen Kloster, in dem er aufgewachsen war.
»Aber ...«
»Mach dir keine Sorgen, mein Sohn«, sagte Pater Giacomo und tätschelte ihm lachend den Kopf. »Denk immer daran, dass der Herr selbst Seine schützende Hand über uns hält. Er wird uns durch alle Gefahren sicher hindurchführen, Er wird Seine Engel aussenden, um unseren Feinden zu schaden, damit wir Ihm den Weg bereiten können.«
Stefano wurde rot. Pater Giacomo war so zuversichtlich, sein Glaube war so stark, dass er sich für seine eigene jämmerliche Furcht schämte. Und dennoch, ein winziger Rest von Zweifel blieb.
»Nun komm, mein Sohn«, sagte Pater Giacomo und packte seinen Stab fester. »Lass uns gehen. Der Herr wird uns in Seiner unermesslichen Güte zu einem geeigneten Haus führen, in dem wir übernachten können.«
Was tue ich hier?, fragte sich Stefano, während er Pater Giacomo nachblickte, der mit langen Schritten den Platz überquerte. Will ich wirklich all diese Menschen aus dieser Stadt vertreiben? Diese Stadt ist schließlich ihre Heimat, und wir sind die Fremden. Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe?
»Diene dem Herrn!«
Stefano wandte sich rasch um. Hatte er die Stimme wirklich gehört? Hatte irgendwo jemand diese Worte gesprochen? Oder war sie nur in seinem Kopf gewesen, diese klare, freundliche Stimme? Er atmete geräuschvoll aus, ein Schauer lief ihm über den Rücken. War das ... war das etwa die Stimme eines Engels, die zu ihm gesprochen hatte? »Diene dem Herrn«, hatte diese Stimme gesagt. Diene dem Herrn. Aber wie?
Pater Giacomo hatte bereits den Säulengang erreicht. Seit Stefano denken konnte, war er nicht von Pater Giacomos Seite gewichen. Von ihm hatte er alles gelernt, was er wusste. Pater Giacomo hatte ihn in den Glauben eingewiesen, an seiner Seite hatte er die Gelübde des Ordens abgelegt. Diene dem Herrn. Er kannte keinen anderen Ort, an dem er den Auftrag der Stimme besser erfüllen konnte als an Pater Giacomos Seite. Ja, das war seine Aufgabe. Gemeinsam mit ihm würde er dem Herrn den Weg bereiten und alle Hindernisse beseitigen. Auch wenn er sich dadurch in Gefahr begeben würde.
Stefano schulterte seine Tasche mit den Resten ihres bescheidenen Mahles und beeilte sich, seinen Lehrer einzuholen.