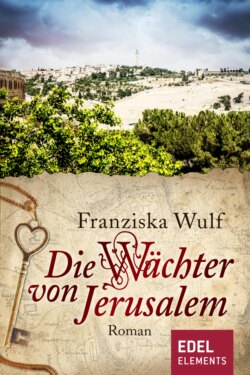Читать книгу Die Wächter von Jerusalem - Franziska Wulf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I Jerusalem, 1530
ОглавлениеNoch wachte der Mond über die Sterne wie ein Hirte über seine Schafe. Doch hinter den Bergen begann allmählich die Sonne emporzusteigen, und sie schickte ihr goldenes Licht über die Wüste und die Stadt, die auf dem Berg thronte wie ein Juwel in der Krone eines Königs. Es war nicht irgendeine Stadt. Es war die Stadt, das weltliche Zentrum des Glaubens. Hier hatte einst der Tempel gestanden, in dem die Bundeslade aufbewahrt worden war. Hier hatten König David und König Salomon regiert. Hier würde auch das Jüngste Gericht über die Menschen kommen. Diese Stadt war die Himmlische, die Friedvolle, die Prächtige. Jerusalem.
Auf der ganzen Welt gab es keinen schöneren Anblick.
Das jedenfalls dachte der alte Meleachim. Langsam, bedächtig einen Schritt vor den anderen setzend, ging er die staubige Straße entlang den Hügeln hinunter und der Stadt entgegen. Bereits lange bevor der Mond seine Bahn vollendet hatte, war er von zu Hause aufgebrochen, dem kleinen Dorf mitten in den Bergen. Und nun, nach langer, beschwerlicher Wanderung, hatte er es geschafft. In einer Entfernung von nicht einmal einer halben Wegstunde erhoben sich vor ihm die mächtigen Mauern von Jerusalem.
Meleachim blieb stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn und die Tränen aus den Augen. Er war alt, schon über sechzig. Bereits als Knabe hatte er jede Woche seinen Vater, einen geschickten Töpfer, auf dem Weg zum Markt begleitet. Sein Vater war mittlerweile lange tot. Er war es jetzt, der die Schüsseln und Krüge herstellte und sie jeden Freitag zum Markt brachte. Seit über fünfzig Jahren ging er nun schon diesen Weg. Dennoch stiegen ihm beim Anblick der Tore Jerusalems jedes Mal erneut die Tränen in die Augen. Tränen der Freude über die Schönheit der Stadt. Tränen der Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Tempels–selbst wenn von seinen Mauern nur noch Reste geblieben waren. Und Tränen der Trauer über die seit Jahrhunderten währende Unterdrückung und Fremdherrschaft. Sie alle waren nach Jerusalem gekommen–erst die Babylonier, dann die Römer, die Christen und nun die Moslems. Und trotzdem war er sicher, dass eines Tages die Heilige Stadt wieder dem Volk der Juden gehören würde, dass eines Tages der Tempel wieder neu errichtet und die Bundeslade an ihren angestammten Platz zurückkehren würde. Selbst wenn es die Kindeskinder seiner Kindeskinder nicht mehr erleben sollten. Eines Tages würde es so weit sein. Und die ganze Welt würde staunen über die Macht und Herrlichkeit des Einzigen und Allmächtigen.
Meleachim setzte seine Bündel ab. Die Tonkrüge und Schüsseln waren schwer, und ihr Gewicht drückte auf seinen Schultern. Es war noch früh am Tag, so früh, dass die Wachfeuer auf den Zinnen der Stadtmauern noch brannten. Im flackernden Schein der Feuer konnte er die Janitscharen erkennen, die auf den Mauern auf und ab gingen und vermutlich auf ihre Ablösung warteten. Ihre Gestalten hoben sich gegen den silbrigen Morgenhimmel ab, winzig klein aus dieser Entfernung und scheinbar harmlos wie Fliegen. Scheinbar. Denn tatsächlich waren die Janitscharen das Einzige, vor dem er sich jede Woche auf seinem Weg zum Markt fürchtete. Manchmal gefiel es ihnen, mit jenen, die wie Meleachim in die Stadt zum Markt wollten, ihren Spott zu treiben. Einmal hätte er sogar um Haaresbreite seine Waren verloren, als zwei von ihnen aus einer puren Laune heraus die Bündel mit den zerbrechlichen Töpfereien gegen die Stadtmauer schleudern wollten. Doch zum Glück war ihm rechtzeitig einer der Janitscharen zu Hilfe gekommen und hatte seine Kumpane davon abgehalten. Ja, viele der Janitscharen waren launisch und unberechenbar. Aber das war nicht immer so gewesen. In den Jahren nach der Eroberung Jerusalems durch den Sultan Suleiman waren sie freundlich und höflich gewesen. Vielleicht waren sie damals ebenso erleichtert wie das Volk, dass nach Jahren der Kämpfe und des Krieges endlich Ruhe und Frieden eingekehrt war. Doch mittlerweile waren sie nervös wie junge Pferde, die man zu lange am Pflock angebunden hatte. Sie waren Soldaten, der Sinn ihres Lebens bestand im Kampf. Aber inzwischen waren die fahrenden Händler und der allmählich einsetzende Verfall die schlimmsten Feinde, vor denen sie die Stadtmauern schützen mussten.
Meleachim warf einen Blick zum Himmel. Bis die Stadt erwacht war und der Markt eröffnet wurde, würden mindestens noch zwei Stunden vergehen. Es blieb also noch genügend Zeit, sich von der beschwerlichen Wanderschaft ein wenig auszuruhen, bevor er sich wieder auf den Weg machen musste, um rechtzeitig vor den ersten Kunden seine Waren auszubreiten. Er konnte warten, bis die Nachtwachen an den Toren abgelöst und die Feuer gelöscht wurden. Zu Beginn ihrer Wache waren die Janitscharen meist besser gestimmt als zu ihrem Ende. Ja, er würde noch eine Weile warten.
Meleachim suchte sich einen dichten Busch, nur zwei Schritte von der Straße entfernt, der ihm ein wenig Schutz vor dem beißenden Wind bot, der in kurzen, aber heftigen Böen über die Straße fegte und ihm Sand und trockene, nadelspitze Blätter ins Gesicht blies. Behutsam setzte er die beiden großen Bündel mit den Töpferwaren neben sich ab und streckte seine müden Glieder aus. Sich ein wenig auszuruhen würde ihm gut tun. Das letzte Stück Weg würde ihm dann umso leichter fallen.
Das ist das Alter, dachte Meleachim und rieb sich die schmerzenden Schultern. Stets hatte er frohen Mutes jeden Freitag seine Last auf sich genommen. Doch seit einiger Zeit schien es ihm, als würden die Bündel von Woche zu Woche schwerer und der Weg immer länger werden.
Aber er wollte sich nicht beklagen. Der Herr hatte es immer gut mit ihm gemeint. Er hatte eine gute, ehrliche Frau und fünf liebevolle Töchter, die ihn bereits mit einem Dutzend Enkelkindern beschenkt hatten. Er liebte seine Familie und seine Arbeit. Die Schüsseln, Krüge, Becher und Teller, die unter seinen geschickten Händen entstanden, zierten sogar die Tafeln der vornehmen Kaufleute in Jerusalem. Und wenn er wieder nach Hause ging, klimperten die Münzen in seinem Beutel, dass es eine Freude war. Mit der Arbeit seiner Hände konnte er seiner Familie ein bescheidenes, aber sorgenfreies Leben ermöglichen. Gebe Gott, dass es auch heute wieder so sein würde.
Meleachim schreckte auf. Stimmen drangen an sein Ohr, und ihm wurde bewusst, dass er gegen seinen Willen eingeschlafen war. Es mochte eine gute Stunde vergangen sein. Die Sonne stand noch nicht sehr hoch, und der Markt hatte gewiss noch nicht begonnen. Dennoch wurde es höchste Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen. Er war gerade im Begriff, seine Bündel zusammenzuraffen und sich zu erheben, als er wieder die Stimmen hörte, die ihn geweckt hatten. Sie kamen näher. Meleachim wollte die Fremden begrüßen und sich bei ihnen für ihren Weckruf bedanken, doch im letzten Augenblick ließ er es bleiben. Ohne sagen zu können, weshalb, mochte er von den Fremden nicht gesehen werden. Statt ihnen also entgegenzugehen und den Rest des Weges zur Stadt in Gesellschaft zu verbringen, duckte er sich hinter dem Busch und spähte hindurch, als gälte es eine Räuberbande zu belauschen.
Es waren zwei Männer. Sie trugen lange Reisemäntel, die Kapuzen hatten sie sich über den Kopf gezogen. Einer von ihnen stützte sich beim Gehen auf einen Stab. Sie sahen aus, als wären sie weit gereist, denn ihre Kleidung war staubig, und die großen ledernen Taschen hingen schlaff von ihren Schultern, als wären sie leer.
Vielleicht sind es Pilger, dachte Meleachim. Ständig kamen Pilger nach Jerusalem–sowohl Juden und Christen als auch Moslems. Die einen wollten zur Klagemauer, die anderen zur Grabeskirche oder zum Felsendom. Manchmal, wenn sich einer der hohen Feiertage näherte, waren sogar so viele Pilger nach Jerusalem unterwegs, dass die Straße von den Bergen aus gesehen einem Ameisenweg glich und er Schwierigkeiten bekam, sich den Weg zum Markt zu bahnen.
Erneut überlegte Meleachim, ob er die beiden nicht doch ansprechen sollte. Pilger waren nicht gefährlich, und wenn sie von weit her kamen, so wussten sie gewiss interessante Geschichten zu erzählen. Dennoch wagte er es nicht. Er schob es darauf, dass er ihre Gesichter nicht sehen konnte. Er wusste aus Erfahrung, dass nicht alle Christen und Moslems einem Juden freundlich gegenübertraten.
Die beiden Männer kamen immer näher und blieben schließlich stehen–ausgerechnet neben dem Busch, hinter dem Meleachim kauerte. Er wagte kaum zu atmen.
Der erste Mann sagte etwas. Seine Stimme klang jung. Doch die Sprache war fremd, und Meleachim verstand kein Wort.
»Sprich hebräisch, Stefano«, erwiderte der andere Mann mit einem starken Akzent. »Es ist schließlich die Sprache unseres Herrn. Außerdem wirst du dich daran gewöhnen müssen.«
Der Mann, der den Namen Stefano trug, neigte ergeben den Kopf.
»Wir sind da, Pater Giacomo«, sagte er langsam, als würde seiner Zunge der Umgang mit der hebräischen Sprache schwer fallen.
»Ja, wir sind da«, sagte der andere. Seine Stimme klang wesentlich älter. »Lange sind wir unterwegs gewesen. Beschwerlich war der Weg, doch nun haben wir sie endlich erreicht. Jerusalem. Die Heilige Stadt. Der Ort, an dem unser Herr den Tod fand. Schon bald werden wir an Seinem Grab stehen, an jener Stelle, an welcher der Engel des Herrn den Jüngern die Kunde von der Auferstehung überbrachte. Wir werden dort beten und um die Kraft flehen, die wir brauchen werden, um hier unsere Aufgabe zu erfüllen.« Die Stimme war sanft und freundlich, und trotzdem lief Meleachim ein eiskalter Schauer über den Rücken. »Endlich ist die Zeit gekommen.«
»Halleluja«, murmelte der junge Mann.
»Heute ist der Tag, an dem sich das Ende der Herrschaft der Frevler über die heiligen Stätten nähert, an dem sich das Kreuz über Halbmond und Davidstern erhebt. Der Tag, an dem endlich der letzte Kreuzzug beginnt.«
»Amen.«
»Komm, Stefano«, sagte der ältere Mann und legte dem Jüngeren die Hand auf die Schulter. »Lass uns durch die Tore schreiten und die Aufgabe beginnen, für die Gott, der Herr, uns auserwählt hat.«
Die beiden Männer gingen weiter. Sie holten aus, als würden sie es kaum erwarten können, endlich die Stadtmauer zu erreichen und ihr Werk zu beginnen–was auch immer sie damit meinen mochten. Der letzte Kreuzzug.
Meleachim zitterte am ganzen Leib. Er selbst hatte die Kreuzzüge nicht erlebt, nicht einmal sein Vater oder Großvater waren dabei gewesen–gottlob. Dennoch erinnerte er sich gut an all die Geschichten, die man sich immer noch erzählte, trotz der vielen Jahre, die seit den Kreuzzügen verstrichen waren. Geschichten von Rittern in schimmernden Rüstungen, von deren Bannern, Schwertern und Lanzen das Blut der erschlagenen Juden und Moslems in Strömen floss. Es waren Geschichten über unvorstellbare Grausamkeiten, über Ereignisse, die so schrecklich waren, dass man nur mit gesenkter Stimme von ihnen sprach, wenn es dunkel war, Türen und Fenster geschlossen waren und die Kinder bereits schliefen. Zum Glück gehörten diese Tage des Entsetzens der Vergangenheit an. Das hatte er wenigstens bisher geglaubt. Und nun kamen diese beiden Christen und sprachen von einem weiteren Kreuzzug. Vom letzten. Waren sie etwa Kundschafter eines Heeres, das hinter den Bergen auf die günstige Gelegenheit wartete, die Stadt zu überfallen?
Meleachim biss sich auf die Lippe. Sollte er etwas tun? Sollte er zu den Janitscharen gehen und sie warnen? Sie auf die beiden Pilger aufmerksam machen? Und was dann? Würden die Soldaten ihm Glauben schenken, oder würden sie ihn nur verspotten und einen alten Narren schimpfen? Und selbst wenn sie ihm glauben wollten, er hatte die Gesichter der beiden Männer nicht gesehen. Er wusste nicht, woher sie kamen, er hatte ihre Sprache nicht erkannt. Er konnte nicht mehr über sie sagen, als dass sie Pilger waren, in staubige Reisemäntel gehüllt, Pilger, wie sie zu hunderten nach Jerusalem kamen. Die Wahrscheinlichkeit, sie im Gewühl der Menschen zu finden, war gering. Abgesehen davon war es möglich, dass er sich getäuscht hatte. Er war aus dem Schlaf geschreckt. Doch das Hebräisch der beiden Männer war keineswegs fehlerlos gewesen. Beide hatten einen mehr oder weniger starken Akzent gehabt.
Meleachim fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die sich plötzlich so spröde anfühlten, als wäre er tagelang durch die Wüste geirrt. Mühsam erhob er sich, raffte seine Sachen zusammen und setzte seinen Weg fort. Je näher er dem Tor kam, umso mehr dachte er, dass er sich wohl geirrt hatte. Die beiden Männer hatten sich wahrscheinlich nur über die Kreuzzüge unterhalten. Vielleicht war einer ihrer Vorfahren auf einem der Kreuzzüge ums Leben gekommen. Und schließlich, als Meleachim das Tor erreicht und der dort stehende Janitschar ihn ungeduldig hindurchgewinkt hatte, war er fest davon überzeugt, dass er sich getäuscht hatte, dass das Gespräch, das er angeblich belauscht hatte, lediglich das Produkt eines wilden Traumes auf dem harten Boden unter dem Busch war. Vielleicht hatte er die beiden Pilger noch nicht einmal wirklich gesehen. Vielleicht waren sie selbst nichts anderes als Traumgestalten.
Ich sollte diese Geschichte für mich behalten, dachte Meleachim, während er der Straße zum Marktplatz folgte. Wenn ich Ruth und den Kindern davon erzähle, werden sie mich auslachen und mich einen alten Narren nennen. Zu Recht.
Und er beschloss, die beiden Pilger und alles, was sie angeblich gesagt hatten, aus seinem Gedächtnis zu streichen.