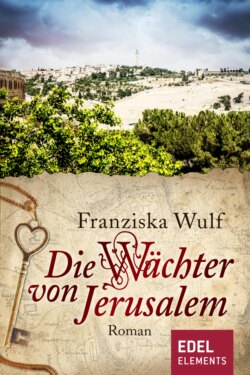Читать книгу Die Wächter von Jerusalem - Franziska Wulf - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II Ansichten eines Narren
ОглавлениеEs klingelte.
Anselmo schlug die Augen auf und sah sich verwirrt um. Er hatte geträumt, er sei auf dem Markt gewesen. Nicht auf einem jener Märkte, wie sie heutzutage überall in Florenz zu finden waren. Märkte, auf denen Libyer, Tunesier und Schwarzafrikaner auf klapprigen Tapeziertischen und staubigen Wolldecken lautstark Kleidung, Stoffe, Schuhe, Handtaschen und Sonnenbrillen anboten–billige Ware, deren Lebensdauer kaum bis Sonnenuntergang reichte. Nein, er war auf einem Markt gewesen, wie er ihn noch aus seiner Kindheit und Jugend kannte. Einem Markt, auf dem es verlockend nach Räucherwaren, würzigem Käse, heißen Würsten und knusprigem Brot duftete, wo Händler kostbare Stoffe und erlesene Gewürze aus dem unvorstellbar fernen Indien anpriesen und Gaukler in bunten Gewändern für ein paar Kupfermünzen ihre Kunststücke zeigten. Im Traum hatte er sein altes Harlekinkostüm getragen und hatte das getan, was er am besten konnte. Er hatte die armen Leute mit scharfzüngiger Rede erheitert und dabei Ausschau nach jemandem gehalten, den er von der qualvollen Bürde einer prallen Geldbörse befreien konnte.
Es klingelte wieder. Anselmo rieb sich die Augen, um endlich in die Realität zurückzufinden. Über ihm wölbte sich keineswegs der blassblaue Himmel eines florentinischen Sommermorgens, und es duftete auch nicht mehr nach deftigen Würsten, Speck und knusprigem Brot. Der Geruch von Waschmittel und Weichspüler stieg ihm in die Nase. Und er blickte empor zu einer beigefarben getünchten Zimmerdecke, in die mehr als ein Dutzend Halogenstrahler eingelassen waren. So widerwillig er sich auch von seinem Traumbild trennen wollte, er befand sich nicht mehr auf dem Marktplatz. Er war ...
»Zu Hause«, sagte er leise und wunderte sich, welch seltsamen Geschmack diese Worte auf seiner Zunge zu hinterlassen schienen. Sie waren schal und staubig wie eine von Dilettanten gestrickte Lüge.
Und erneut klingelte es, diesmal schon deutlich drängender. Es war die Türklingel, ein überaus melodischer Gong, keinesfalls vergleichbar mit der Glocke, die früher in Cosimos Palazzo gehangen hatte. Die war so laut gewesen, dass Anselmo jedes Mal beinahe aus dem Bett gefallen war, wenn ein morgendlicher Besucher an der Schnur gezogen hatte. Trotzdem klang das Geräusch in diesem Moment hässlich und schrill in seinen Ohren. Und wer auch immer dort unten stand und um Einlass begehrte, er schien immer ungeduldiger zu werden. Anselmo sprang von dem Sofa auf, auf dem er eingeschlafen war. Es war hell, groß und viel weicher als jedes Bett, in dem er früher geschlafen hatte. Und dennoch ...
Er lief die Treppe hinunter zur Eingangstür. Durch das schmale Milchglasfenster in ihrer Mitte erkannte er die Silhouette eines Menschen. Anselmo öffnete die Tür. Es war eine junge Frau.
»Oh, es ist doch jemand da«, sagte sie, steckte einen Kugelschreiber in ihre Hosentasche und bückte sich nach einem großen offenen Pappkarton voller Briefe, der vor ihr auf der Türschwelle stand. »Ich wollte schon ...«
Sie hob den Blick, und ihr Gesicht überzog sich mit flammender Röte. Mit gerunzelter Stirn sah Anselmo an sich hinab, um herauszufinden, ob er vielleicht–wie in seinem Traum–die Kleidung eines Narren trug. Doch er hatte gewöhnliche Jeans an und ein T-Shirt. Er trug zwar weder Schuhe noch Strümpfe, doch es war gewiss nichts Besonderes, im eigenen Heim barfuß umherzulaufen. Trotzdem starrte sie ihn an, als hätte sie nicht erwartet, ausgerechnet ihn hier anzutreffen.
»Guten Tag«, sagte er, weil ihm in diesem Augenblick einfach nichts Besseres einfiel.
»Ja ... äh, guten Tag«, stammelte die Frau. Sie war jung, zwanzig, vielleicht zweiundzwanzig. Jung, farblos und unglaublich nervös. »Ich wollte nur ...«
Verlegen strich sie sich das dunkle Haar aus dem Gesicht.
»Die Post?«, half Anselmo ihr weiter und versuchte es mit einem Lächeln. Manchmal nützte das etwas. »Sie wollten uns wohl die Post bringen? Aber wo ist Luigi?« Luigi war ein liebenswürdiger alter Mann, der bereits seit mehr als zwanzig Jahren jeden Tag die Post für Cosimo aus dem gemieteten Postfach holte und vorbeibrachte. Niemand sonst wusste, welche Adresse sich hinter der fünfstelligen Ziffer des Postfachs verbarg. Für diesen Dienst wurde Luigi beinahe königlich bezahlt–allerdings eher für seine Verschwiegenheit denn für die Tätigkeit an sich. »Und wer sind Sie?«
»O ja, natürlich!« Die Briefträgerin kicherte wie ein schüchterner Teenager. »Ich bin die Lungenentzündung. Ich meine, Luigi ist meine Enkelin ... äh ...« Sie lief erneut so dunkelrot an, dass Anselmo befürchtete, gleich nach einem Arzt rufen zu müssen. Sie holte tief Luft. »Mein Großvater ist krank. Lungenentzündung. Ich soll Ihnen heute die Post bringen.« Sie sprach so hastig, als fürchtete sie ihre Rede zu vergessen, wenn sie nur ein bisschen langsamer sprechen würde. Dann hob sie den Karton auf, drückte ihn Anselmo in die Arme und drehte sich so abrupt um, dass er erschrocken einen Schritt zurücksprang.
»Auf Wiedersehen. Und Ihrem Großvater gute Besserung!«, rief er ihr hinterher. Sie rannte die Treppe hinunter, schwang sich auf ihr Fahrrad und fuhr die Einfahrt hinab, als hätte sie Angst davor, er könnte es sich anders überlegen und sie mit einer Axt in der Hand verfolgen.
Kopfschüttelnd schloss Anselmo die Haustür. Für einen kurzen Augenblick spiegelte sich sein Gesicht in der Milchglasscheibe, das jugendlich glatte Gesicht eines Mannes in den Zwanzigern. Er gehörte nicht zu den Männern, die stundenlang ihr Spiegelbild betrachteten. Und da Cosimo bereits vor vielen Jahren sämtliche Spiegel aus seinem Haus verbannt hatte, hatte er ohnehin nicht oft die Gelegenheit dazu. Doch manchmal, wenn er sich in einem Schaufenster sah oder in dem Spiegel einer Boutique, wunderte er sich, dass er eigentlich immer noch genauso aussah wie früher. Wie damals, als er auf den Märkten von Florenz in der Kleidung eines Narren umhergesprungen war und den reichen Bürgern ihre Börsen aus den Taschen gestohlen hatte.
Das ist lange her, dachte Anselmo und rieb sich nachdenklich das Kinn. Fünfhundert Jahre sind eine verdammt lange Zeit.
Er stellte den Karton auf einem Tisch in der Eingangshalle ab. Wie er erwartet hatte, war er randvoll mit Briefen, die an Herrn Cosimo Mecidea adressiert waren. Anselmo nahm ein paar heraus und betrachtete die teuren Umschläge. Wahrscheinlich waren es die üblichen Briefe der Gäste, die sich für das gelungene Fest am Samstagabend bei ihrem Gastgeber bedanken wollten. Anselmo seufzte. Jedes Mal, wenn Cosimo seinen Kostümball veranstaltete, wurde ihnen ein paar Tage später die Post gleich säckeweise ins Haus getragen. Und da Cosimo nach einem derartigen Fest immer in tiefe Schwermut und Depressionen versank und die zahlreichen Dankesschreiben kaum beachtete, blieb es stets an ihm hängen, jeden einzelnen der Briefe zu beantworten. Früher, vor sehr vielen Jahren, war Anselmo so stolz darauf gewesen, die Kunst des Schreibens zu beherrschen, dass er sich mit Feuereifer auf jeden Brief gestürzt hatte, um dessen Beantwortung Cosimo ihn gebeten hatte. Inzwischen aber hatte das Schreiben für ihn schon lange den Reiz des Neuen verloren. Es war langweilig, lästig, zeitraubend, eine Pflicht, auf deren Erfüllung er liebend gern verzichtet hätte.
Auch wenn er kaum einen Blick darauf werfen wird, ich werde ihm die Post trotzdem zeigen, dachte Anselmo, legte die Briefe in den Karton zurück und klemmte ihn sich unter den Arm. Vielleicht bringt es ihn auf andere Gedanken.
Wie Anselmo es erwartet hatte, fand er Cosimo in der Bibliothek. Er saß vor dem Fenster in seinem Lieblingssessel und sah hinaus. Von hier aus hatte man einen fantastischen Blick über die Dächer von Florenz. Es war eine Aussicht, die schon so manchen befreundeten Künstler und Fotografen restlos begeistert und zu wundervollen Arbeiten inspiriert hatte. Doch Anselmo hätte Wetten darauf abschließen können, dass Cosimo die Stadt in diesem Moment gar nicht sah–wenigstens nicht so, wie sich Florenz den Menschen des 21. Jahrhunderts präsentierte.
Regungslos wie eine Statue saß er in dem Sessel und starrte hinaus. In seinen Händen hielt er eine Teeschale, ein winziges dünnwandiges Ding, das schon beim Hinsehen zu zerbrechen drohte, in Wirklichkeit aber geradezu beängstigend solide war. Anselmo erkannte sie sofort, und er spürte, wie sich seine Nackenhaare sträubten. Er hasste diese Tasse. Sie gehörte zu einem chinesischen Teeservice aus der Zeit der Ming-Dynastie. Die anderen Schalen und die passende Kanne standen auf einem Ebenholztablett, kaum eine Armlänge von Cosimo entfernt, als hätte er Angst, jemand könnte es ihm wegnehmen. Auf Auktionen erzielten so erstklassig erhaltene Stücke wie dieses geradezu astronomische Preise. Mehr als einmal hatte Anselmo versucht Cosimo dazu zu überreden, das Service endlich zu verkaufen. Aber es war vergebene Liebesmüh. Cosimo behauptete dann immer, dass zu viele Erinnerungen damit verbunden seien. Erinnerungen, die zu kostbar seien, um sie gegen Geld einzutauschen.
Kostbare Erinnerungen. Anselmo biss die Zähne zusammen. Er konnte nicht verstehen, weshalb Cosimo sich immer wieder freiwillig diesen Qualen hingab, warum er sich nicht einfach von dem Porzellan trennte und endlich vergaß.
Das Service war in so mancher Hinsicht eines der letzten Überreste einer glorreichen Dynastie. Von den mächtigen chinesischen Kaisern, die dem Porzellan ihren Stempel aufgedrückt hatten, waren nichts als klangvolle Namen in den Abhandlungen der Historiker und Antiquitätenhändler geblieben. Ebenso wie von der florentinischen Familie Medici, in deren Auftrag das Porzellan vor rund fünfhundert Jahren auf einer überaus abenteuerlichen Reise nach Europa gebracht worden war. Sie alle waren nichts als Staub und Asche, begraben und vergessen. Und Anselmo wünschte, dass das Service endlich das Schicksal seiner ehemaligen Besitzer teilen möge. Mehr als einmal hatte er schon mit dem Gedanken gespielt, das Hausmädchen zu bestechen, damit es beim Putzen »versehentlich- das Tablett umstieß. Doch er wagte es nicht. Cosimos Verdacht würde sofort auf ihn fallen, und es gab nichts auf dieser Welt, das er mehr fürchtete als Cosimos Zorn. Wenn er aber dieses unselige Teeservice schon nicht zerstören konnte, so gehörte es doch wenigstens in die Obhut eines Museums. Oder in die Hände eines Sammlers, der sich beim Betrachten der Schalen nicht von jedem einzelnen Pinselstrich mit schmerzhaften Erinnerungen quälen ließ.
»Anselmo«, sagte Cosimo plötzlich, ohne seinen Blick von dem Panorama der Stadt abzuwenden, »nimm dir auch eine Schale Tee. Kommst du, um einen Versuch zu starten, mich aus meiner Trübsal zu reißen?«
»Ich wusste, dass ich dich hier finden würde, Cosimo«, antwortete Anselmo, trat rasch neben den Sessel und schenkte sich die duftende Flüssigkeit in eine der zarten Schalen. Jasmintee. Ein weiteres Zeichen für Cosimos depressive Stimmung. Er trank diesen Tee ausschließlich in Phasen der Schwermut. »Du liebst den Platz vor dem Fenster, den ungehinderten Blick über die Stadt.«
»Ja. Und der Sessel ist überaus bequem. Viel bequemer als alle Stühle, die wir früher hatten. Er schlingt sich um mich und nimmt mich in sich auf, sodass ich mich geborgen fühle wie im Schoß meiner Mutter.«
Er machte eine Pause, um einen Schluck zu trinken, und Anselmo warf ihm einen raschen Blick zu. Über Cosimos Gesicht huschte ein Lächeln, flüchtig zwar und kaum wahrnehmbar, aber dennoch war Anselmo erleichtert. Dieses Lächeln bedeutete ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht hielt die Melancholie ihn dieses Mal nicht ganz so fest in seinen Klauen wie gewöhnlich.
»Wenn du hinausschaust, Anselmo, kannst du dann auch immer noch die Dächer sehen, so wie sie einst waren? Kannst du das Klappern der Räder der Kutschen auf den Straßen hören, den Unrat riechen, um den sich die Ratten in den Gassen balgten?« Er schloss die Augen und sog tief die Luft ein, als ob er diesen eigentümlichen Geruch tatsächlich wahrnehmen könnte.
Anselmo schüttelte sich. Manche Dinge aus der Vergangenheit vermisste sogar er, aber der Gestank des langsam in der Gosse verfaulenden Abfalls gehörte bestimmt nicht dazu. Doch er sagte nichts. Die Jahre, die seit damals verstrichen waren, verklärten manches. Und vielleicht konnte man sich selbst nach Fäulnis und Verwesung zurücksehnen, wenn man nie gezwungen gewesen war, darin zu leben.
»In all den Jahren hat sich so viel geändert, Anselmo. Ehrbare Familien sind verschwunden. Viele der Palazzi, in denen ich dereinst zu Besuch war, sind schon vor langer Zeit abgerissen oder so umgebaut worden, dass man sie kaum noch wiedererkennt. Ganze Straßenzüge haben sich verändert. Die Stadt ist gewachsen. Wo früher die Hütten der Weber standen, fahren jetzt Züge in den Bahnhof ein. Und wo einst unsere Rinder weideten, erheben sich heutzutage Hochhäuser.«
Anselmo zuckte mit den Schultern. »Na und? Die Welt muss sich schließlich ändern, sich weiterentwickeln. Um vieles, was wir noch gekannt haben, ist es noch nicht einmal schade. Und manches ist auch gleich geblieben«, sagte er und lächelte. »Da ist zum Beispiel der Dom. Die anderen Kirchen. Die alte Brücke. Selbst viele der alten Häuser stehen noch. Denk doch nur an den Palazzo Medici-Riccardi. Er ist ...«
»Mittlerweile ein Museum«, unterbrach ihn Cosimo. »Und an den anderen Häusern und Kirchen, von denen du gesprochen hast, wird ständig gebaut. Sie müssen von Bauingenieuren und Restauratoren gehegt und gepflegt werden, damit sie nicht verfallen.« Er seufzte. »Manchmal fühle ich mich wie sie. Zwar ist die Fassade frisch gestrichen, doch innen drin, der Kern, das Herz, ist alt und morsch, von Schimmel und Holzwürmern zerfressen, beklagenswerte Residuen einer längst vergessenen Epoche.« Er schüttelte langsam den Kopf. »Nein, Anselmo, der Mensch ist wahrlich nicht für die Ewigkeit geschaffen.«
Anselmo holte tief Luft und schwieg. Darin war er mit Cosimo einer Meinung. Der Mensch war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Doch es hatte keinen Zweck, sich deswegen selbst zu zerfleischen. Sie hatten keine andere Wahl, als die Ewigkeit zu akzeptieren–wenigstens jetzt noch nicht.
Nachdenklich drehte Cosimo die Teeschale in seiner Hand und fuhr mit dem Zeigefinger über die kunstvolle Glasur.
»Dieses Service gehörte einer meiner Nichten. Vielleicht erinnerst du dich noch an sie, Anselmo.« Anselmo nickte. Und ob er sich daran erinnerte. »Ich weiß noch genau, wie es war, als sie das Service geschenkt bekommen hatte. Es war ihr fünfzigster Geburtstag. Ich sehe noch ihre vor maßlosem Entzücken aufgeworfenen Lippen, die vor Freude strahlenden Augen vor mir. Wie hat sie dieses Service geliebt. Sie hat so an ihm gehangen, dass sie sogar auf dem Sterbebett ihre Zofe darum gebeten hatte, es doch auf einem Tablett neben sie zu stellen, damit sie es wenigstens noch ein letztes Mal sehen könne. Wie alt war sie noch bei ihrem Tod gewesen? Dreiundachtzig? Oder fünfundachtzig?«
»Sechsundachtzig«, sagte Anselmo. »Eure Nichte Francesca di Sgubbio wurde sechsundachtzig.«
Cosimo trank einen Schluck und schüttelte betrübt den Kopf.
»Ich habe es vergessen, Anselmo. Wenn ich ehrlich bin, konnte ich mich noch nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern.«
»Das ist wahrlich kein Wunder, Cosimo. Es ist lange her.«
»Aber das ist nicht der einzige Grund, Anselmo. Ich habe im Laufe der Jahre so viele Nichten, Großnichten und Urgroßnichten aufwachsen und sterben sehen, dass ich sie kaum noch voneinander unterscheiden kann. Mit der Zeit wurden es immer weniger. Und am Ende bin nur noch ich übrig geblieben. Ich, der Letzte der einst so glorreichen Medici. Einigen Mitgliedern meiner Familie haben wenigstens die Historiker ein paar Zeilen gewidmet. Die meisten jedoch–wie auch Francesca – sind nichts als Staub. Und eine Hand voll löchriger Erinnerungen im Gehirn eines Verdammten, der eigentlich schon längst nichts mehr auf dieser Welt verloren hat.«
»Cosimo, das ist ...«
Doch Cosimo winkte ab und begann die Teeschale zu streicheln. Er liebkoste das Porzellan wie ein lebendiges Wesen, und sein Gesicht sah aus, als ob ihm diese Berührungen Schmerz zufügen würden.
»Es sind einfach zu viele gewesen, Anselmo. Zu viele Menschen, die ich im Laufe der Jahre hinter mir gelassen habe.« Er seufzte. »Zu ihren Lebzeiten habe ich die meisten von ihnen nicht einmal besonders geschätzt. Doch soll ich dir etwas Seltsames verraten? Mit jedem Tag, der seit ihrem Ableben verstrichen ist, vermisse ich sie mehr. Ja, ich vermisse ihre anödende Gesellschaft. Ich vermisse sogar ihre Engstirnigkeit, ihre Dummheit, ihre langweiligen Gespräche, die sich stets nur um das Geld und seine effiziente Vermehrung gedreht haben. Jetzt sind sie fort. Sie alle sind zu Staub zerfallen. Und eigentlich gehöre ich zu ihnen, Anselmo. Ich gehöre dahin, wo sie jetzt sind. Wir beide gehören dorthin.«
Anselmo biss die Zähne zusammen und ballte die Hand zur Faust. Nur mühsam unterdrückte er den Wunsch, Cosimo die Schale aus der Hand zu schlagen und sie genauso wie auch den Rest des Services in einen Scherbenhaufen zu verwandeln. Doch er beherrschte sich. Stattdessen nahm er Cosimo behutsam die Tasse aus der Hand und kniete vor dem Sessel nieder, sodass Cosimo ihm ins Gesicht sehen konnte, ohne den Blick heben zu müssen.
»Cosimo, lass es nicht zu, dass die Schwermut und die Dunkelheit von deinem Verstand und deinem Herzen Besitz ergreifen. Dies ist nur die Laune des Augenblicks, die Nachwehen des Festes, wie du sie jedes Jahr verspürst. Und sie wird auch wieder vergehen. Wie jedes Mal. Du musst es nur zulassen.«
Cosimo sah ihn an. Sein Blick war so trostlos, so voller Aussichtslosigkeit und Verzweiflung, dass es Anselmo die Kehle zuschnürte.
»Vielleicht hast du Recht. Aber ich bin müde, Anselmo«, er rieb sich die Augen »so entsetzlich müde. Ich sehne mich nach der kühlen Ruhe, dem stillen Frieden der Gruft. Vielleicht kannst du mich verstehen. Vielleicht...«
Anselmo erhob sich. Natürlich konnte er Cosimo verstehen. Trotzdem. Er hatte in seinem Leben schon oft schwere Zeiten durchgemacht. Er hatte eine Woche lang angekettet auf dem Pranger stehen müssen, weil man ihn beim Stehlen erwischt hatte. Er war von seinen Ziehvätern grün und blau geprügelt worden, weil seine Diebesbeute unter ihren Erwartungen geblieben war. Es hatte Tage gegeben, an denen er vor Hunger kaum mehr hatte stehen können und sich seine Eingeweide zu einem schmerzhaften Klumpen verwandelt hatten. Doch er hatte sich davon nicht unterkriegen lassen. Er hatte gekämpft, bis er schließlich alt genug gewesen war, seine eigenen Wege zu gehen. Und als niemandem als sich selbst verantwortlichem Dieb zu leben. Und er war auch nicht bereit, jetzt aufzugeben. Sie alle–seine Ziehväter, die unbarmherzigen Richter, die fetten Kaufleute, die ihre Essensreste lieber in die Gosse warfen als sie den hungrigen Bettlern vor ihrer Haustür zu geben–sie alle waren tot und begraben. Doch er lebte. Jetzt. Hier. Die Vergangenheit war vorbei. Was zählte, war die Gegenwart. Und die Tage, die noch vor ihnen lagen, ganz gleich, wie viele es noch sein mochten.
»Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, Cosimo, bis dein Wunsch in Erfüllung geht«, sagte er mit dem festen Willen, Cosimo aus seinem tiefen Loch herauszureißen. »Signorina Anne war schließlich da. Sie war am Samstagabend auf dem Fest. Du selbst hast mit ihr gesprochen. Der Stein ist ins Rollen gekommen.«
»Ja, Anselmo, der Stein ist ins Rollen gekommen. Endlich. Doch ich weiß nicht, wann ich sie wiedertreffen werde. Wann ich sie auf ihre nächste Reise schicken kann. Und ich weiß schon gar nicht, wann es ihr gelingen wird, uns endlich das Gegenmittel zu beschaffen. Es mögen bis dahin nur zehn Wochen sein. Vielleicht auch weniger. Doch ebenso gut kann es noch zehn Jahre dauern. Oder gar mehr.«
»Wenn dich der Gedanke an die Wartezeit quält, weshalb machst du nicht den ersten Schritt?«, schlug Anselmo vor. »Wir kennen ihren Namen. Wir wissen, dass sie aus Hamburg kommt. Es sollte leicht sein, sie ausfindig zu machen und um ein Treffen ...«
»Nein, Anselmo!«, unterbrach Cosimo ihn heftig. »Du weißt, dass ich geschworen habe, mich nicht in den Lauf der Dinge einzumischen. Und daran halte ich mich.«
»Ja, Cosimo, aber ...«
»Nichts aber. Wir werden warten, bis Anne Niemeyer sich bei uns meldet. Ganz gleich, wie lange es dauern mag.«
Anselmo verzog das Gesicht. Er kannte Cosimos Ansicht darüber, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, zur Genüge. Doch in diesem Fall war das Abwarten falsch, vielleicht sogar die größte Dummheit, die sie begehen konnten. Cosimo hatte wohl vergessen, dass er sich bereits vor Jahrzehnten aus den Telefon- und Adressenlisten der Behörden hatte streichen lassen. Anne Niemeyer würde es nahezu unmöglich sein, Cosimos Adresse oder Telefonnummer ausfindig zu machen. Nicht einmal Giancarlo kannte sie, dabei zählte er zu Cosimos engeren Freunden. Sie würde also nach Florenz kommen und darauf hoffen müssen, ihnen irgendwann einmal wieder über den Weg zu laufen. Und welcher Mensch mit Verstand würde das tun? Wenn sie darauf warteten, würden wohl noch fünfzig Jahre vergehen. Anselmo biss sich auf die Lippe. Also würde er nachhelfen. Er hatte niemals geschworen, sich aus dem Lauf des Schicksals herauszuhalten. Er brauchte noch nicht einmal viel zu tun. Er musste nur ihre Adresse ausfindig machen. Oder ihre E-Mail-Adresse. Anne Niemeyer war Journalistin. Sie verfügte bestimmt über einen Computer mit Internetzugang. Und dann ...
»Sie wird sich bei uns melden, Cosimo«, sagte Anselmo. »Schon bald. Sie ist eine kluge Frau. Sie wird Erklärungen von uns fordern. Sie wird ihren Sohn suchen wollen. Und damit wird sie nicht lange warten. Da bin ich ganz sicher.«
Cosimo stieß einen tiefen Seufzer aus. Dann lächelte er Anselmo an. Endlich. Die Krise war überwunden.
»Mein lieber Freund«, sagte er und streckte ihm seine Hand entgegen. »Jener Tag, an dem du meine Börse gestohlen hast und ich dich zur Strafe dafür zu meinem persönlichen Diener gemacht habe, gehört wahrlich zu den besten meines Lebens.«
Anselmo drückte die Hand und lächelte vor Erleichterung und vor Freude. Worte waren nicht nötig. Er und Cosimo kannten sich schon lange genug, um sich auch schweigend verständigen zu können.
Als Anselmo wenig später in sein Zimmer im ersten Stockwerk des Hauses trat, hörte er die Klänge des Saxophons von Stan Getz, die aus dem Wohnzimmer zu ihm empordrangen.
Das ist gut, dachte er. Wenn er Musik hört, hat er nicht nur seine Schwermut überwunden, sondern er ist auch beschäftigt. Und ich habe genug Zeit.
Zufrieden schloss er die Tür hinter sich und schaltete seinen Computer an. Für gewöhnlich meldete ein Blinken auf dem Bildschirm des Computers in der Bibliothek Cosimo seine Aktivität, doch Anselmo hatte schon vor langer Zeit eine Möglichkeit gefunden, das zu umgehen. Noch während der Computer hochfuhr, gab Anselmo ein paar Befehle ein, die sein System vom Computernetz des Hauses abkoppelten und alle Spuren seiner Aktivitäten verwischten. Er war ein Dieb mit Leib und Seele. Das galt nicht nur für die Geldbörsen wohlhabender Leute. Mittlerweile stahl er bevorzugt Daten, und jetzt würde er sich die E-Mail-Adresse von Anne Niemeyer beschaffen.
Im Jahre 1477 waren er und Cosimo Anne Niemeyer in Florenz zum ersten Mal begegnet. Damals war sie mit Cosimos Vetter Giuliano liiert gewesen, und sie hätte ihn auch gewiss geheiratet, wenn nicht das, was als »Pazzi-Verschwörung« in die Annalen der Geschichte eingegangen war, Giulianos Leben ein vorzeitiges, gewaltsames Ende bereitet hätte. Diese Begegnung im Jahre 1477 war der Grund, weshalb Cosimo Jahr für Jahr seinen Kostümball veranstaltete. Und er tat es, weil sie ihm 1477 eine Einladung zu diesem Ball unter die Nase gehalten hatte. Bei einem seiner Kostümfeste hatte Anne offenbar von ihm das Elixier der Ewigkeit zu trinken bekommen und war mit Hilfe dieses wundersamen Elixiers in die Vergangenheit gereist–eben ins Jahr 1477. Und weil man am Rad des Schicksals nicht drehen darf, hatte Cosimo gewartet, all die Jahre. Dass dieses langersehnte Ereignis am Samstag nun endlich eingetroffen war, änderte nichts an Cosimos Grundhaltung. Er würde wohl weiter warten, zur Not bis zum Jüngsten Tag. Anselmo brachte diese Geduld nicht auf.
Anne Niemeyers E-Mail-Adresse ausfindig zu machen war eine Kleinigkeit. Anselmo brauchte keine halbe Stunde, um alles zu erledigen. Anne würde beim Einschalten ihres Computers eine E-Mail vorfinden, die sich so lange nicht löschen ließ, bis von ihrem Anschluss aus Cosimos Telefonnummer gewählt worden war. Anselmo streckte seine Glieder und schaltete den Computer wieder aus. Er war zufrieden mit seiner Arbeit. Dann ging er zu einer Truhe, die in der Ecke seines Zimmers stand. Die Truhe war nicht besonders groß, aber sie war sehr alt.
So alt wie ich, dachte Anselmo. Allerdings habe ich mich deutlich besser gehalten.
Das wurmzerfressene Holz war im Laufe der Jahrhunderte fast schwarz geworden, und die schweren Eisenbeschläge waren rau und verrostet. Er kniete vor der Truhe nieder, steckte einen großen, nach modernen Maßstäben unförmigen Schlüssel in das kompliziert aussehende Schloss und klappte den Deckel auf. Vor ihm lag ein Harlekinkostüm. Sein Kostüm.
Anselmos Finger zitterten leicht, als er über den groben Stoff strich. Wie hatte er dieses Kostüm geliebt. Er hatte es geliebt, obgleich es an Ellbogen und Knien mehrfach geflickt war, obwohl einige Schellen an den Ärmelsäumen fehlten. Er selbst hatte das Kostüm ständig ausgebessert und regelmäßig nachgefärbt. Manchmal sogar mit Indigo oder Purpur–wenn er gerade genügend Geld gehabt hatte oder es ihm gelungen war, irgendwo ein wenig des kostbaren Farbpulvers zu stehlen. Mittlerweile waren die Farben natürlich ziemlich verblasst. Das Gelb, Grün und Rot der Rhomben konnte man nur noch erahnen. Doch wenn er sein Gesicht im Stoff vergrub und tief einatmete, vermochte er sie immer noch wahrzunehmen–die Gerüche des Marktes, den Duft von Würsten, Brot und Gewürzen. Anselmo legte das Kostüm zur Seite und holte weitere Gegenstände aus der Truhe hervor. Da war ein schmaler Streifen aus glattem schwarzem Leder. Er selbst hatte die Löcher für die Augen hineingeschnitten und mit einer geliehenen Nadel umsäumt. Mit dieser Maske hatte er jedes Mal sein Gesicht unkenntlich gemacht, bevor er auf dem Markt seine Spaße getrieben hatte. Die Kappe mit den mehr als zwei Dutzend Schellen, die bei jeder Bewegung leise klingelten. Der mit bunten Bändern umwickelte Stab ...
Mit einer heftigen Bewegung schlug Anselmo den Deckel der Truhe zu, erhob sich und trat ans Fenster. Er presste die Stirn gegen die Scheibe. Das Glas war angenehm kühl, obwohl die Luft draußen auf der Dachterrasse vor Hitze flimmerte.
In den ersten Jahren, nachdem er das geheimnisvolle Elixier der Ewigkeit getrunken hatte, das nicht nur Reisen in die Vergangenheit ermöglichte, sondern auch das Leben verlängerte, hatte er das alles als Spaß empfunden. Die Vorstellung, nicht sterben zu können, sondern ewig zu leben, hatte ihm gefallen. Bis er die Kehrseite kennen gelernt hatte. Er hatte zwar immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen, sich an die Veränderungen in der Stadt, im Land und in der Welt zu gewöhnen, aber dennoch war er immer noch überrascht, wenn er eine der ihm seit Ewigkeiten vertrauten Straßen in Florenz entlangging und plötzlich in einem Park stand, den es dort früher nicht gegeben hatte. Manchmal kam es ihm so vor, als würde sich die Welt um ihn herum immer schneller drehen. Oder lag es einfach daran, dass er selbst sich so wenig änderte–trotz all der Jahre, die mittlerweile seit dem Tag seiner Geburt verstrichen waren? Ja, er konnte Cosimo verstehen. Manchmal sehnte auch er sich danach, endlich sterben zu können. So wie all jene Menschen, die er im Laufe seines Lebens geliebt hatte.
Anselmo schlug mit der flachen Hand gegen die Scheibe.
»Verdammt, das muss wohl ansteckend sein!«, sagte er wütend zu seinem Abbild, das sich schwach auf der Fensterscheibe spiegelte. »Hör auf damit. Wenn du schon von Cosimo verlangst, sich von seinem Teeservice zu trennen, so solltest du wenigstens mit gutem Beispiel vorangehen und dieses Narrenkostüm in den Müll werfen.«
Er holte tief Luft. Ja, das würde er tun. Er würde endlich das Kostüm wegwerfen, verbrennen, verschenken–was auch immer. Jetzt. Gleich. Gleich morgen früh ...