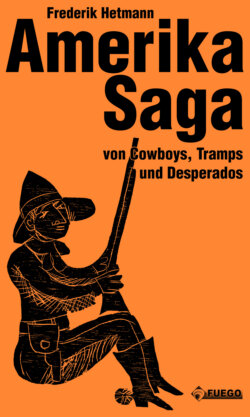Читать книгу Amerika Saga - Frederik Hetmann - Страница 12
Der Teufel und Tom Walker
ОглавлениеDie folgende Geschichte erschien zuerst unter dem Titel »Tales of a Traveller«. Als Autorenname war bei dieser Publikation »Geoffrey Crayon, Gent« angegeben. 1849 jedoch taucht sie in den gesammelten Werken des ersten großen amerikanischen Dichters, Washington Irving, auf.
Wenige Meilen von Boston in Massachusetts liegt an der Küste des Ozeans eine fjordartige Meeresbucht, die sich viele Meilen landeinwärts hinzieht und schließlich in einem dichtbewaldeten Sumpf und Morast endet. An dem einen Ufer ist die Bucht mit schönen dunklen Bäumen bewachsen, das andere Ufer fällt steil ab, und auf den nackten Felsklippen stehen nur hier und da ein paar große alte Eichen. Unter einem dieser Bäume soll – so heißt es in alten Geschichten – der Pirat Captain Kid einen unermesslich großen Schatz versteckt haben.
Tatsächlich erscheint das Gelände als Schatzversteck sehr geeignet. Durch die Bucht konnte das Geld mit Booten von den Schiffen landeinwärts geschafft und bei Nacht heimlich an das schmale Sandufer am Fuße der Felsklippen gebracht werden. Die Erhebung ließ sich gut als Ausguck benutzen, und die Eichenbäume als markante Orientierungspunkte ermöglichten es, jederzeit den Ort wiederzufinden. Die alten Geschichten wissen auch zu berichten, dass der Teufel selbst seine Hand im Spiel hatte, als der Schatz versteckt wurde, und diesen dann in Verwahrung nahm, aber das ist, wie man weiß, bei großen Schätzen nichts Ungewöhnliches, zumal dann nicht, wenn sie ihr Besitzer auf unrechtmäßige Art erworben hat. Wie dem auch sei: Captain Kid kehrte nie zurück, um die Reichtümer, die er versteckt hatte, wiederzuholen. Er wurde in Boston gefangengenommen, nach England geschickt und dort als Seeräuber gehängt.
Um das Jahr 1727, als New England häufig von Erdbeben heimgesucht wurde und es manchem großen Sünder weich in den Knien wurde, lebte nahe diesem Ort ein hässlicher böser Mann mit Namen Tom Walker. Sein Weib war nicht viel besser als er selbst, und so rabenschwarz waren ihre Seelen, dass sie gar versuchten, sich gegenseitig zu betrügen. Was immer der Frau in die Hände fiel: Sie versteckte es. Gackerte eine Henne, schon war sie im Stall und suchte nach dem frisch gelegten Ei, um es an sich zu bringen. Ihr Mann war immer damit beschäftigt, ihre Verstecke aufzuspüren, und oft gab es über das, was doch ihr gemeinsames Eigentum hätte sein sollen, wilden Streit zwischen den beiden. Sie lebten in einem heruntergekommenen Haus, das einsam stand und aussah, als sei es von der Schwindsucht befallen. Die Bäume im Garten waren verkümmert, nie stieg Rauch aus dem Schornstein, nie wagte es ein des Weges ziehender Reisender, vor dieser Tür haltzumachen.
Das Gehöft und seine Bewohner hatten einen schlechten Ruf. Toms Weib war groß und dürr, von wildem Temperament. Sie sprach laut und hatte lange Arme. Oft konnte man ihre schrille Stimme weithin hören, wenn sie mit ihrem Mann stritt, dessen Gesicht deutliche Spuren von Tätlichkeiten zeigte. Eines Tages kam Tom Walker von einem Besuch bei einem weit entfernt wohnenden Bekannten zurück. Da er den Heimweg abkürzen wollte, hielt er sich nicht auf dem Pfad, sondern lief quer durch den Sumpf. Und wie es oft mit den Abkürzungen geht, es stellte sich bald heraus, dass er hier langsamer vorwärts kam als auf dem ausgetretenen Weg. Das Sumpfland war bewaldet mit düster ausschauenden Kiefern und Ulmen, von denen manche bis zu neunzig Fuß hoch waren. Ihr dichtes Blattwerk ließ kaum einen Schimmer des Tageslichts bis zum Boden dringen, und in ihren Zweigen nisteten Eulen. Oft stolperte Tom in Sumpflöcher, die mit Weiden und Moosen überwuchert waren. Dann musste er sich mühsam aus knöcheltiefem Schlamm hervorarbeiten. Es gab auch schwarze Sumpftümpel mit stehendem brackigem Wasser, in dem Kaulquappen, Ochsenfrösche und Wasserschlangen lebten. Hier und da dösten halbverfaulte Baumstümpfe wie schlafende Krokodile aus dem Zwielicht hervor.
Tom bahnte sich vorsichtig seinen Weg durch den Sumpfwald. Er sprang von Wurzelstock zu Wurzelstock oder balancierte wie eine Katze über umgestürzte Bäume. Ab und zu schrak er von dem grell-höhnischen Ruf der wilden Enten zusammen, die er von einem der fauligen Tümpel aufschreckte. Schließlich gelangte er auf ein Stück Land mit festem Untergrund, das wie eine Halbinsel in die Sümpfe hineinragte. Hier hatten in den Kämpfen mit den ersten Siedlern die Indianer ihr Lager gehabt und eine Art Fort errichtet, in dem sie bei Kriegszügen ihre Frauen und Kinder zurückließen. Von der alten Indianerfestung war nichts geblieben als ein paar Grundmauern, die im Laufe der Zeit in den Boden eingesunken und von Büschen überwuchert worden waren.
Schon spät, bei Abenddämmerung, kam Tom Walker an das alte Fort und beschloss, dort einen Augenblick auszuruhen. Jeder andere Mensch hätte wohl diesen düsteren Ort, über den unheimliche Geschichten umgingen, gemieden. Tom Walker aber war nicht der Mann, sich vor solchem Altweibergeschwätz zu fürchten. Er setzte sich auf einen umgestürzten Stamm, hörte auf den Schrei einer Baumkröte und lehnte sich vorn über auf seinen Spazierstock.
Da war es ihm, als stoße die Stockspitze gegen etwas Hartes. Er stocherte mit dem Stock in der Erde herum, und siehe da, ein gespaltener Schädel, in dem noch ein Tomahawk steckte, kam zum Vorschein.
»Ha«, sagte Tom Walker und stieß mit der Fußspitze an den Schädel, um so die Erde, die daran hing, abzuklopfen. – »Lass den Schädel in Ruhe«, sagte eine tiefe Stimme. Tom blickte auf, und da saß auf einem Baumstamm, ihm gegenüber, ein großer schwarzer Mann.
Tom wunderte sich, denn er hatte zuvor nicht das leiseste Geräusch gehört. Sein Erstaunen wuchs, als er bemerkte, dass der Mann, der weder ein Indianer noch ein Schwarzer sein konnte, von einem seltsam glühenden Licht umgeben war. Sein Gesicht war rußverschmiert. Er hatte langes schwarzes Haar, das nach allen Seiten hin von seinem Kopf abstand, und trug eine Axt über der Schulter. Eine Weile sah er Tom. mit rotglühenden Augen schweigend an. Dann sagte er:
»Was stocherst du hier auf meinem Grund herum, he!«
»Dein Grund«, antwortete Tom höhnisch, »nicht mehr dein Grund und Boden als meiner. Das Land gehört dem Diakon Peabody.« – »Diakon Peabody soll verdammt sein«, sagte der Fremde, »und eines Tages wird er zur Hölle fahren, wenn er sich nicht bald mehr um seine eigenen Sünden kümmert. Schau einmal dorthin, da kannst du sehen, wie es mit diesem Peabody steht.«
In der Richtung, in die der Fremde deutete, sah Tom einen großen kräftigen Baum, der an den Wurzeln schon so verfault war, dass ihn der nächste kräftige Wind fällen musste. Auf der Borke des Baumes aber stand zu lesen: Diakon Peabody, ein bedeutender Mann, der seinen Reichtum damit erwarb, dass er die Indianer betrog.
Und als sich Tom nun weiter umsah, entdeckte er, dass viele der großen Bäume, die hier standen, den Namen eines angesehenen Mannes trugen. Alle waren sie mehr oder minder krank oder angefault, und jener Stamm, auf dem Tom selbst saß, musste eben gerade gefällt worden sein. Auch er trug einen Namen. Crowningshield stand darauf. Und Tom erinnerte sich, dass so ein mächtiger und reicher Mann hieß, der gern mit seinem Reichtum prahlte, den er, wie man sich zuflüsterte, als Pirat erworben hatte.
»Dieser Stamm hier wird gleich verbrannt«, sagte der schwarze Mann in triumphierendem Ton, »du siehst, an Feuerholz für den Winter habe ich keinen Mangel.«
»Aber was für ein Recht hast du, hier auf Diakon Peabodys Grund und Boden Holz zu fällen?«, fragte Tom.
»Ich habe ein Vorzugsrecht«, antwortete der andere, »dieser Wald war mein Eigentum, lange bevor es je weiße Männer in dieser Gegend gab.«
»Ich bitte dich, sage mir dann, wer du bist«, fragte Tom.
»Ach, weißt du, ich habe verschiedene Namen. In manchen Gegenden bin ich ein wilder Jäger, in anderen ein Bergmann. Hier nennt man mich meist den schwarzen Waldgänger. Ich bin der, dem bei den Indianern dieser Ort geweiht war und dem zu Ehren sie ab und zu hier einen weißen Mann am Marterpfahl verbrannten. Seitdem die roten Männer von euch weißen Wilden ausgerottet worden sind, mache ich mir oft ein Vergnügen daraus, die Progrome gegen Quäker und Wiedertäufer anzuführen. Ich bin der Schutzherr der Sklavenhändler und der Großmeister der Hexen von Salem.«
»Woraus, wenn ich mich nicht gewaltig täusche, doch wohl folgert, dass man dich gemeinhin den Teufel heißt«, sagte Tom.
»Du hast recht. Ich stehe zu deinen Diensten«, antwortete der schwarze Mann.
So soll das Gespräch zwischen den beiden begonnen haben. Man könnte nun meinen, einem Menschen, der an einem solch wilden und einsamen Ort dem Teufel begegne, müsse vor Schreck das Blut in den Adern geronnen sein. Aber Tom war ein hartgesottener Bursche und zu lange lebte er schon mit einem zänkischen Weib zusammen, um sich noch vor dem Teufel zu fürchten.
Man erzählt, dass die beiden nach dieser Vorstellung noch ein langes und ernstes Gespräch miteinander führten, ehe Tom sich auf den Heimweg machte. Der schwarze Mann soll ihm dabei von den Schätzen des Captain Kid erzählt haben. Er gab zu verstehen, dass dessen Reichtümer sich in seiner Verwahrung befänden und nur durch ihn einem Menschen zugänglich gemacht werden könnten. Schließlich bot er an, all das Geld und Gold an einen Ort zu schaffen, wo es immer für Tom zur Hand sei. Natürlich stellte er auch Bedingungen. Doch wie sie lauteten, wurde nie bekannt, da sich Tom Walker über diesen Punkt des Gespräches immer ausschwieg. Doch müssen sie sehr hart gewesen sein, denn Walker, der gewöhnlich sehr hinter dem Geld her war, bat sich Bedenkzeit aus. Auch hatte er seine Zweifel: »Was für einen Beweis«, so fragte er, »gibt es dafür, dass du die Wahrheit sprichst?« – »Ich will dir ein Zeichen geben«, sagte der schwarze Mann und legte seinen Finger auf Toms Stirn. Dann wandte er sich rasch um und war im nächsten Augenblick im Gebüsch verschwunden. Als Tom zu Hause ankam, stellte er fest, dass das schwarze Zeichen auf seiner Stirn mit nichts abzuwaschen war. Es schien in die Haut hineingebrannt zu sein.
Das Erste aber, was ihm seine Frau erzählte, war, dass Absalom Crowningshield, der reiche Seeräuber, plötzlich gestorben sei. »Mag der Freibeuter in der Hölle schmoren«, dachte Tom bei sich, »ich habe jetzt wenigstens die Gewissheit, dass ich nicht nur geträumt habe. Es gibt den schwarzen Mann. Und auch mit dem Schatz mag es dann wohl seine Richtigkeit haben.«
Gewöhnlich hätte Tom ein Geheimnis wie das Wissen um einen verborgenen Schatz wohl für sich behalten, aber unter diesen besonderen Umständen fand er es doch besser, sein Weib ins Vertrauen zu ziehen. Das hatte aber nur zur Folge, dass ihre Habgier noch wuchs. Sie drängte ihren Mann, rasch das Angebot des Teufels anzunehmen und den Schatz an sich zu bringen.
Nun war Tom eigentlich gar nicht abgeneigt, für Geld seine Seele dem Teufel zu verkaufen. Als ihm aber seine Frau dazu riet, widersprach er, ganz einfach, weil der jahrelange Streit mit seinem Weib ihn dahin gebracht hatte, immer gerade das nicht zu tun, was sie von ihm verlangte. Natürlich schalt sie ihn nur wieder, aber das bewirkte nur, dass er noch eigensinniger auf seinem Willen beharrte.
Endlich entschloss sich das Weib, selbst mit dem Teufel ins Geschäft zu kommen. Sollte ihr der Schatz zufallen, so würde ihr Mann nichts davon erfahren. Auch sie kannte keine Furcht, und so ging sie am Abend eines Sommertages zu den Ruinen des alten Indianerforts. Viele Stunden blieb sie fort. Als sie zurückkam, war sie verschlossen und gab nur ausweichende Antworten. »Ja«, sagte sie, dem schwarzen Mann sei sie tatsächlich begegnet, doch hätten sie nicht handelseinig werden können. Sie müsse wohl noch einmal mit ihm reden, doch warum dieses zweite Gespräch nötig sei, wollte sie nicht sagen.
Am nächsten Abend lief sie wieder in die Sümpfe und trug in ihrer Schürze etwas Schweres mit. Tom.wartete und wartete. Sie kam nicht.zurück. Es wurde Mitternacht, es wurde Morgen und schließlich Mittag, und immer noch wartete er vergebens.
Mit der Zeit wurde Tom unruhig und fürchtete, es könne ihr etwas zugestoßen sein. Inzwischen hatte er auch herausgefunden, dass sie in der Schürze wohl die silberne Teekanne, die Löffel und überhaupt alles, was es im Haus an Wertgegenständen gab, mitgenommen haben musste. Noch ein Tag und noch eine Nacht vergingen. Die Frau kam nicht zurück. Mit anderen Worten, und um die lange Geschichte kurz zu machen, Tom Walkers Weib blieb verschwunden, und nie wieder hörte man etwas von ihr. Natürlich nahm Tom das Verschwinden seines Weibes nicht untätig hin. Er suchte den Sumpfwald nach ihr ab, aber er fand nichts als ihre Schürze, die an einer Zypresse hing. Als er aber nach dem Kleidungsstück greifen wollte, schwebte es wie ein Vogel ohne Körper davon.
Mit der Zeit fand sich Tom Walker mit dem Verlust seiner Frau und der Wertsachen ab. Ja er begann langsam so etwas wie Dankbarkeit für den schwarzen Mann aus dem Wald zu empfinden, der ihn von seiner zänkischen Alten erlöst hatte. Das; gab ihm schließlich den Wunsch ein, den Teufel doch wieder einmal zu treffen, aber was immer er auch tat, der schwarze Mann ließ sich nicht mehr sehen. Denn man muss wissen, auch der Teufel macht sich gern rar. Es ist nicht so leicht, ihn zu beschwören, und er weiß sehr genau, wann er seine Karten ausspielen muss, um ein Spiel zu gewinnen.
Endlich, als Tom schon jede Hoffnung aufgegeben hatte, den Schatz doch noch zu gewinnen, traf er den schwarzen Mann, der die Kleidung eines Holzfällers trug und ein Lied pfiff, auf einer. Waldlichtung. Er schien sich wenig um Tom zu scheren und wollte pfeifend weitergehen, und erst als Walker lange vergeblich auf ihn eingeredet hatte, ließ er sich dazu herab, stehen zu bleiben, um noch einmal über den Seeräuberschatz zu verhandeln. Über die eine Bedingung braucht hier kein Wort verloren zu werden, denn sie ist aus allen Verträgen, die der Teufel je einem menschlichen Wesen vorgeschlagen hat, nur zu wohl bekannt. Doch in diesem Fall bestand der Böse noch auf einer zweiten Klausel. Er forderte von Tom Walker, dass alles Geld und Gold wiederum in einem teuflischen Unternehmen angelegt werden müsse. Mit anderen Worten, er schlug Tom Walker vor, Sklavenhändler zu werden. Das lehnte Tom ab. Er war ein böser Mensch, ohne Zweifel, das war er. Aber selbst der Teufel konnte ihn nicht dazu verleiten, sich am Sklavenhandel zu beteiligen.
Als der Teufel merkte, dass Tom in diesem Punkt auf keinen Fall mit sich reden ließ, machte er einen anderen Vorschlag. Er verlangte, Tom solle seinen neu gewonnenen Reichtum im Geldleihgeschäft anlegen.
Hiergegen hatte Tom nichts einzuwenden, denn es war ein Geschäftszweig, in dem er sich schon immer zu arbeiten gewünscht hatte.
»Du wirst also nächsten Monat in Boston eine Geldleihe eröffnen«, sagte der schwarze Mann.
»Schon morgen, wenn du willst«, sagte Tom Walker.
»Du wirst das Geld mit zwei Prozent im Monat ausleihen.«
»Ich schlage vor, ich nehme vier Prozent.«
»Du wirst viele Kaufleute in den Bankrott treiben!«
»Ich werde sie dem Teufel in die Hölle schicken«, schrie Tom Walker eifrig.
»Du wirst mein Wucherer werden«, sagte der Schwarze freudig, »wann soll ich dir den Schatz geben?«
»Noch heute Nacht.«
»Abgemacht«, sagte der Teufel.
»Abgemacht«, sagte Tom Walker. Sie schüttelten sich die Hände und besiegelten den Vertrag. Schon ein paar Tage später saß Tom Walker hinter dem Schalter einer Geldverleihe in Boston. Sein Ruf verbreitete sich schnell. Er konnte immer Geld beschaffen. Und man wird sich erinnern, dass damals zur Amtszeit von Gouverneur Belcher das Bargeld knapp war. Es war die Zeit der Kredite, die nur auf dem Papier standen. Das Land war überschwemmt mit Schuldverschreibungen der Regierung. Die berühmte Bodenbank war soeben gegründet worden. Jedermann spekulierte. Die Leute verloren den Kopf über den gewagtesten Plänen mit neuen Siedlungen in der Wildnis. Überall wiesen Bodenspekulanten Landkarten vor, auf denen sagenhafte Bodenschätze verzeichnet standen.
Zu dieser Zeit und unter diesen Umständen wird es verständlich erscheinen, dass Tom Walkers Geschäft blühte. Die Kunden rannten ihm die Türen ein. Arme kamen, die Abenteuerlustigen kamen. Die hochspielenden Glücksritter, die Bodenspekulanten und die ruinierten Geschäftsleute blieben nicht aus. Sie alle liefen zu Tom Walker. Und scheinbar war er für alle der gute Helfer in der Not. Jedoch nur, um sie am Ende desto erbarmungsloser und grausamer auszubeuten oder sie ganz und gar zu vernichten.
Auf diese Art brachte er es zu großem Reichtum. Er baute sich ein großes Haus, schaffte sich schöne Karossen an und trieb großen Aufwand mit seiner Kleidung.
Als Tom alt und grau wurde; kamen ihm ganz andere Gedanken. Alles, was diese Welt zu bieten hatte, besaß er, aber wie würde er in jener anderen Welt einmal dastehen? Mit Bedauern dachte er an den Vertrag, den er einst im Sumpfwald mit dem schwarzen Mann geschlossen hatte, und er sann darauf, den Teufel um seinen Lohn zu betrügen. Plötzlich wurde er ein eifriger Kirchgänger. Er betete laut und viel, ja er setzte sich sogar dafür ein, dass Quäker und Wiedertäufer nicht verfolgt werden sollten. Trotz alledem konnte er die Angst nicht loswerden, dass der Böse doch eines Tages unbarmherzig von ihm die Schulden eintreiben werde, die auf jenem alten Vertrag verzeichnet standen. Der Teufel, so dachte er sich, solle ihn nicht unvorbereitet überraschen, und deshalb lag auf dem Tresen seiner Geldausleihe stets eine Foliobibel, in der er las, wenn er gerade einmal keinen Kunden bediente.
Auch erzählt man sich, Tom Walker sei auf seine alten Tage etwas seltsam geworden. So habe er seine Pferde mit umgekehrten Hufen beschlagen lassen und ihnen auch den Sattel auf den Bauch gebunden, weil er gelesen hatte, dass am Tag des Jüngsten Gerichts alles von oben nach unten gekehrt.werden würde. Doch muss der Erzähler hier einfügen, dass er solche Verrücktheiten einfach nicht glauben will und es den alten Weibern überlässt, sie für bare Münze zu nehmen.
An einem heißen Sommernachmittag in den Hundstagen war es, als in Boston eine schwarze Gewitterwand am Himmel aufzog. Tom saß in seinem Geschäft. Er trug eine weiße Leinenkappe und einen Morgenmantel aus indischer Seide. Er war gerade damit beschäftigt, die Schulden eines Bodenspekulanten zu berechnen, für den er angeblich immer große Freundschaft empfunden hatte, und den diese Abrechnung nun endgültig ruinieren musste. Sein Gläubiger stand bei ihm und bat um ein paar Tage Aufschub.
»Wenn du auf der Stelle das Geld von mir forderst, bin ich bankrott, und du bringst meine Familie ans Hungertuch«, jammerte der Mann.
»Nächstenliebe beginnt im eigenen Haus«, antwortete Tom, »in schweren Zeiten ist sich jeder selbst der Nächste.«
»Du hast doch soviel Geld mit mir verdient«, sagte der Spekulant, »bitte, hab doch wenigstens diesmal ein Einsehen!«
»Der Teufel soll mich holen«, schrie ihm Walker ins Gesicht, »wenn ich auch nur einen Pfennig an dir verdient habe.«
In diesem Augenblick klopfte jemand laut an der Eingangstür. Tom ging hin, um zu öffnen. Und wen sah er da? Draußen stand ein schwarzer Mann, der am Halfter ein schwarzes Pferd hielt, das ungeduldig mit den Hufen stampfte.
»Tom«, sagte der schwarze Mann mit finsterer Stimme, »ich komme dich holen.«
Tom sprang zurück. Aber es war zu spät. Nichts half ihm die kleine Bibel, die er immer in der Westentasche bei sich trug. Nichts half ihm die große Foliobibel, die auf dem Tresen lag. Der schwarze Mann packte ihn im Nacken, hob ihn auf das Pferd, sprang selbst hinter Tom auf und jagte mit ihm durch den Gewitterregen davon. Der Morgenrock flatterte im Wind, und bei jedem Schritt sprangen Funken unter den Hufen des Pferdes hervor. Im Nu waren die beiden Reiter verschwunden.
Tom Walker kehrte nie zurück, um jene Schuldenberechnung abzuschließen. Ein Landmann aber will an diesem Tag die beiden Reiter auf einem Pferd gesehen haben, wie sie in die Sümpfe hineingaloppierten. Dann soll ein Blitzschlag zur Erde gezuckt sein, so stark und mächtig, dass er ein ganzes Waldstück in Brand steckte. Die guten Leute von Boston schüttelten ihre Köpfe und zuckten die Schultern, aber sie waren so vertraut mit Hexen, Gespenstern und mit den Gewohnheiten des Teufels, dass sie sich über all diese seltsamen Vorkommnisse weniger ängstigten, als man annehmen sollte.