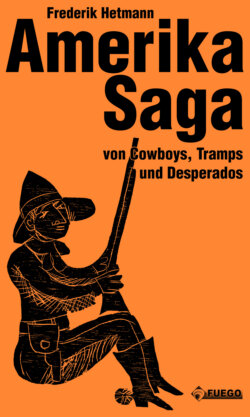Читать книгу Amerika Saga - Frederik Hetmann - Страница 21
– Das abenteuerliche Leben des Davy Crockett – Der Ritt nach Texas
ОглавлениеEs war Herbst geworden. Das Thermometer zeigte schon Frost an, als ich Frau und Kinder verließ. Ich zog einen sauberen Jagdanzug an, setzte eine Fuchspelzkappe auf, von der hinten der Schwanz herunterhing, und nahm mein Gewehr Betsey, das mir, wie jeder weiß, von den Bürgern von Philadelphia in Anerkennung meiner Verdienste im Kampf gegen tyrannische Maßnahmen der Regierung geschenkt worden war. So ausgerüstet, brach ich schweren Herzens in Mill Point auf und fuhr mit einem Dampfboot den Mississippi hinunter, einem neuen Land entgegen. Nach längerer Reise und manchen Abenteuern gelangte ich nach Nacogdoches, einer kleinen Stadt mit Poststation und Gericht in Louisiana, am rechten Ufer des Red-River. Hier lernte ich einen seltsamen Mann kennen. Er war Bienenjäger. Er war weit gereist und erklärte mir, dass er den weiten Ozean der Prärien gut kenne: Besonders in Texas fänden sich viele wilde Bienenschwärme, die einen Honig von ganz ausgezeichneter Qualität sammelten. Es gäbe Menschen, die einen besonderen Sinn für die Gewohnheiten dieser Tiere mitbekommen hätten und deshalb leicht jeden wilden Bienenstock aufspüren könnten. Diese Beschäftigung sei nicht nur bloßer Zeitvertreib, sondern recht einträglich. Allein das Wachs erziele in Mexiko drüben hohe Preise; da in den Kirchen überall Wachskerzen von der Länge und Stärke eines Männerarms brennen. Viele der Bienenjäger würden deshalb aus den Stöcken nur das Wachs entnehmen. »Es ist seltsam«, sagte mir der Mann, »fast nie finden sich Bienenstöcke in einem noch unberührten Landstrich. Für die Indianer sind Bienenschwärme die Vorboten des weißen Mannes. Und es scheint so, als ob sie mit der Grenze der Zivilisation immer weiter nach Westen wanderten.«
Mit dem Bienenjäger und einem Mann namens Thimblerig setzte ich meine Reise fort, und als wir einige Tage über die endlos weite Prärie geritten waren, kam mich eine große Lust auf einen Jagdausflug an.
Wir sprachen davon und der Bienenjäger schenkte mir noch eine Tüte Kaffee und Biskuits, die ihm sein Mädchen in Nacogdoches mitgegeben hatte. Wir tranken auf das Wohl der kleinen Kate und wünschten dem Bienenjäger, der voll Ungeduld auf den Tag wartete, da er sie zur Frau nehmen würde, viel Glück. Während wir tranken und sprachen und einige Einwände gegen meinen einsamen Ausflug geäußert wurden, bemerkte ich, dass der Bienenjäger in einem fort seine Blicke zum Horizont schweifen ließ. Plötzlich hielt er inne, sprang auf, rannte wie vom Wahnsinn gepackt zu seinem Pferd und preschte in die Prärie hinaus. Wir beobachteten, wie Pferd und Reiter kleiner und kleiner wurden und schließlich in der Ferne verschwanden. Ich war völlig verblüfft, und auch Thimblerig meinte, der gute Mann müsse wohl verrückt geworden sein.
Kurz nachdem der Bienenjäger verschwunden war, hörten wir in der Ferne ein Geräusch, das wie das Grollen eines heraufziehenden Gewitters klang. Der Himmel war klar, kein Anzeichen für einen Sturm war zu bemerken; also schlossen wir, dass das Grollen wohl eine andere Ursache haben müsse. Als wir nach Westen schauten, sahen wir am Horizont eine gewaltige Staubwolke.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte ich.
»Du darfst meine Schuhe ins Feuer werfen, wenn ich es weiß«, sagte mein Gefährte und stülpte sich seinen Hut auf den Kopf.
Wir starrten weiter in die Richtung, aus der der Lärm zu uns herüberdrang. Vielleicht war es ein Tornado, doch was immer es sein mochte, es kam genau auf uns zu. Unsere Pferde hatten aufgehört zu grasen und legten die Ohren an. Wir liefen zu ihnen, fingen sie ein und ritten zu einem Wäldchen – und immer noch schwoll das Geräusch an. Kaum dass wir die schützenden Bäume erreicht hatten, als das heulende und donnernde Etwas nahe genug heran war, um erkennen zu lassen, worum es sich handelte.
Eine Herde Büffel, vier- oder fünfhundert Tiere, stürmte auf uns zu. Und es war, als seien alle Teufel der Hölle losgelassen. Die Tiere galoppierten am Wäldchen vorbei und wären wir ihnen draußen, auf der freien Prärie, begegnet, so hätten sie uns bestimmt totgetrampelt. Mein armes Pferd scheute. Es war so nervös wie ein Politiker, den man eben aus seinem Amt gejagt hat.
An der Spitze der Herde, etwas voraus, lief ein schwarzer Büffelbulle, der das Leittier zu sein schien. Er kam wie ein Wirbelsturm angeprescht und sein Schwanz stand steil in die Höhe. Von Zeit zu Zeit bohrte er wütend seine Hörner in den Boden und warf Erdklumpen auf. Als er ganz nahe herangekommen war, nahm ich mein schönes Gewehr Betsey auf und schoss. Er brüllte und blieb dann plötzlich stehen. Die Tiere hinter ihm taten das Gleiche. Und es ist mir bis heute unverständlich, dass sie sich dem entstehenden Gewühl, nicht die Beine brachen. Der schwarze Bulle stand für ein paar Augenblicke regungslos da, dann warf er seinen schweren Körper herum und preschte davon.
Die ganze Herde folgte ihm, und ich gestehe gern, dass ich bei all meinen Jagdabenteuern nie einen schöneren Anblick gesehen habe. Ich sah den Tieren ein paar Minuten nach, dann gab ich meinem Pferd die Sporen und ritt hinterher.
Ich folgte den Spuren der Herde etwa zwei Stunden. Zuerst sah ich vor mir eine große Staubwolke, die sich nach und nach in eine kleine Wolke am Horizont verwandelte, als der Abstand wuchs. Ich war ganz gefangen genommen von der Erregung dieser Verfolgungsjagd, bis der Horizont auch dieses letzte Anzeichen der Herde verschluckte. Ich hielt an, ließ mein Pferd verschnaufen und ritt dann weiter nach Westen. Nach einer Stunde musste ich mir eingestehen, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich sah mich um und erblickte vor mir, so weit das Auge sehen konnte, Felder, kleine Wäldchen und Weiden, die durch Bachläufe voneinander abgetrennt waren. Aber nirgends war hier der Ton einer menschlichen Stimme oder ein anderes Geräusch zu vernehmen, das von Menschen stammte. Da merkte ich, dass die ganze Szenerie nur eine Täuschung war, die mir die Luft und meine erregten Sinne vorgaukelten.
Vorwärts, der Sonne nach, dachte ich, denn du hast keinen Kompass, und hier ist kein anderer Pfad als jener, den die Hufe deines Mustangs in den Boden graben. Und wahrlich, wenn ich hier auf einen Pfad oder eine Spur gestoßen wäre, hätte ich arge Zweifel gehabt, ob es klug sei, ihr zu folgen. Denn mein Freund, der Bienenjäger, hatte mir erzählt, dass er sich einst in der Prärie verirrt hatte und zufällig, ohne sie zu erkennen, auf seine eigene Spur gestoßen und auf diese Weise einen ganzen Tag im Kreis geritten sei. Ich entschloss mich deshalb, zuzureiten, bis ich an einen Fluss käme, und
dann seinem Lauf zu folgen. Ich ritt eine weitere Stunde dahin, ohne auf die Spur einer menschlichen Behausung zu stoßen. Wild sah ich selten, und in Gedanken beschäftigte mich das Schicksal meines Gefährten, der ganz allein zurückgeblieben war; auch dachte ich über das mysteriöse Verschwinden des Bienenjägers nach. Und während meine Gedanken mit so unerfreulichen Überlegungen beschäftigt waren, wurde ich plötzlich von einer anderen Neuheit überrascht, die nicht weniger wunderbar war als jene, die mir kurz zuvor begegnet war.
Ich war aus einem Wäldchen hervorgeritten, und vor mir lag eine ausgedehnte Prärie, die sich wohl mit einer üppigen Weide eines sehr reichen Ranchers vergleichen lässt, und als ob auch nichts fehlen dürfe, sah ich da eine Herde von nahezu Hundert der schönsten Pferde ruhig grasen. Es dauerte eine Weile, bis sich mein Verstand klargemacht hatte, dass dies nicht das Werk eines Menschen sei. Dann aber rief ich bewundernd aus: »Gott, wie viel wunderbare Werke hast du für den Menschen erschaffen, und wie wenig haben die Menschen für dich getan!«
Jetzt hatten mich die Mustangs entdeckt. Sie hoben die Köpfe, schwärmten aus und umkreisten mich. Sie kamen zutraulich ganz nahe heran, und dies gefiel meinem eigenen Pferd. Es begann, mit den Wildpferden zu spielen. Hier biss es einen der Mustangs zärtlich am Hals, dort rieb es seine Nase an einem Fell. Mir war nicht ganz geheuer bei alledem. Ich versuchte mein Pferd aus der Herde herauszulenken, aber es war beharrlich und tat, was ihm gefiel. Als es schließlich ermüdete und meinem Willen gehorchte, folgte uns die ganze Herde, dicht gedrängt, mit erhobenen Köpfen und strömenden Mähnen und Schweifen.
Mein Pferd schien Gefallen daran zu finden, die Herde anzuführen, es galoppierte an, und so begann, sehr wider meinen Wunsch und Willen, ein Pferderennen, wie ich es zuvor noch nie erlebt hatte. Wir schossen dahin über die offene Prärie. Mein Pferd immer noch an der Spitze, aber je länger das Rennen dauerte, desto deutlicher wurde es, dass sich mein armer Klepper etwas zu viel vorgenommen hatte. Erst lagen die Wildpferde mit uns Kopf an Kopf, da warf sich mein Pferd noch einmal mächtig ins Zeug, aber schon überholte uns eines der Wildpferde, dann ein Zweites und ein Drittes, und schließlich schoss die ganze Herde an uns vorbei. Inzwischen hatten wir uns dem Ufer eines Flusses genähert. Während meine erschöpfte Mähre im Sand zusammenbrach, durchschwamm die Herde den Fluss. Es war ein großartiger Anblick, wie dieser Strom aus lebendigen Pferdeleibern den anderen Strom kreuzte und sich von dessen Gewalt nicht beirren ließ.
Es dauerte eine Stunde, bis ich mein Pferd wieder auf den Beinen hatte. Da es schon zu dunkeln begann, beschloss ich, mich nach einem Plätzchen für die Nacht umzuschauen. Nahe am Ufer sah ich einen großen Baum mit weit überhängenden Zweigen. Ich machte einige Schritte darauf zu, da hörte ich ein lautes Grölen, das zu besagen schien: »Fremder, dieses Zimmer ist schon besetzt«. Nun wollte ich freilich ganz genau wissen, mit wem ich da mein Schlafgemach zu teilen hätte, und siehe da, fünf oder sechs Schritt von mir entfernt stand sprungbereit eine große mexikanische Wildkatze von jener Art, die man Cougar nennt, und offenbar willens, sich vor dem Schlaf mit einem Nachtessen zu versorgen. Und ohne Zweifel war der Braten, den sie dafür in Aussicht genommen hatte, ich. Strahlenbündel schossen aus ihren großen Augen, und sie fletschte die Zähne wie ein hysterisch gewordener Irrer. Ich riss mein Gewehr hoch und feuerte. Was folgte, war ein wütendes Geheul, aber das Tier stand noch auf den Beinen. Die Kugel hatte es in den Kopf getroffen, und obwohl man im Fell den Einschuss deutlich sah, zeigte sich keine Wirkung. Ich war noch nicht drei Schritte zurückgetreten, da sprang mich die Katze auch schon an. Glücklicherweise konnte ich mich auf die Seite werfen, und das Tier fiel hart zu Boden. Ich schlug mit dem Gewehrkolben zu, aber die Katze wirbelte herum und bekam mich nun zu fassen.
Ich warf das Gewehr von mir und zog mein Jagdmesser. Die Krallen hatten sich in meinen linken Arm gebohrt, aber als ich ihr das Jagdmesser in die Seite schlug, ließ die Wildkatze von mir ab, jedoch nur für einen Augenblick. Gleich darauf sprang sie mich wütend wieder an. Ich versuchte nun, sie zu blenden, aber mein Schlag mit dem Gewehr traf nur die Nase. Sie knurrte wütend, umklammerte mich dann mit den Vorderpfoten, und da mein Fuß sich in den Ranken von wildem Wein verfangen hatte, stürzte ich zu Boden. Das Tier stieß auf mich nieder. Es verbiss sich an meiner linken Hüfte, während ich immer wieder und nun mit letzter Kraft mein Messer in seine Rippen stieß. Wir wälzten uns am Boden und ich versuchte verzweifelt, mich zu befreien.
Schließlich gelang es mir, den rechten Arm freizubekommen, und ich führte einen kräftigen Stoß gegen den Nacken der Katze. Das Messer muss wohl durch Fell und Haut bis ins Herz gedrungen, sein, denn nun spürte ich, wie die Kräfte des Tieres langsam erlahmten. Nach ein paar Minuten brach es tot zusammen. Ich habe oft mit Bären gekämpft, aber das war ein Kinderspiel gegen diesen Kampf mit der Wildkatze.
Ich kletterte nun auf den Baum und bereitete mir in einer Astgabel mit Moos und meiner Pferdedecke ein bequemes Lager. Dann sah ich noch einmal nach meinem Pferd. Es schien so, als werde es den Morgen nicht mehr erleben. Mit dem Sattel auf dem Rücken kroch ich zu meinem Lager zurück und schlief bald unter sorgenvollen Gedanken ein.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich mich schlecht. Meine Wunden schmerzten. Als ich aber den Kadaver des Cougar auf dem Sandstreifen am Fluss sah, fasste ich wieder Mut bei der Überlegung, dass elend immer noch besser sei als tot. Ich erwartete, ein totes Pferd zu finden. Aber nichts da. Von der Mähre fehlte jede Spur. Mir kam die Idee, das arme Vieh könne über Nacht von wilden Tieren zerrissen worden sein, aber dann hätte ich wenigstens doch sein Gerippe finden müssen. Nichts. Ich hatte Hunger. Unten am Fluss schoss ich eine fette Wildgans und briet sie am Feuer. Kaffee und Biskuit hatte ich in meinen Taschen bei mir. Und während ich noch mein Frühstück verzehrte und mir überlegte, in welcher Richtung ich wohl anschließend meine Füße bewegen sollte, hörte ich Pferdegetrappel und sah dann, in einiger Entfernung, etwa fünfzig Indianer, Komantschen, deren Speere in der Morgensonne glitzerten. Sie kamen herangeritten, und ich sprang zu meinem Gewehr. Aber im gleichen Augenblick war mir klar, dass Widerstand gegen eine solche Übermacht völlig sinnlos war.
Dem Häuptling schien mein Gewehr gut zu gefallen. Er betrachtete es begierig. Und da es immer besser ist, wenn man in einer zweideutigen Lage gleich klare Fronten schafft, fragte ich ihn, ob seine Nation mit den Amerikanern Krieg führe.
»Nein«, antwortete er. – »Ihr seid also Freund der Amerikaner?« – »Ja, wir sind ihre Freunde.« – »Und woher habt ihr eure Speerspitzen, eure Gewehre, eure Decken und eure Messer?« – »Von unseren Freunden, den Amerikanern.« – »Nun gut, und was meint ihr, würden euch die Amerikaner berauben, wenn ihr durch ihr Land zieht, so wie ich jetzt durch euer Land ziehe?« – »Nein, sie würden uns Nahrung geben und uns beschützen, und die Komantschen werden dies ihrem weißen Bruder vergelten.« Ich fragte ihn nun, wie er mich entdeckt habe, und er erklärte, er habe über eine weite Entfernung den Rauch meines Feuers gesehen. Dann fragte er mich, was mich hierher gebracht habe, und ich berichtete von meinem Missgeschick.
Der Häuptling gab mir ein neues Pferd, und nachdem ich mich mit diesem vertraut gemacht hatte, brachen wir auf. Wir ritten den ganzen Tag und stießen am Abend auf eine kleine Büffelherde. Es war eine Freude, den Indianern bei der Jagd zuzusehen. Es gibt keine besseren Reiter als die Komantschen. Sie sitzen so fest im Sattel und haben ihr Pferd so vollständig unter Kontrolle, als seien sie mit ihm verwachsen. Ich schoss ein junges Kalb, und da es das einzige Stück Wild war, aus dem man Fleisch zum Essen schneiden konnte, nannte mich der Häuptling einen tapferen Jäger, und wir erzählten uns am Feuer beim Essen manch gute Jagdgeschichte.
Nichts von Bedeutung geschah, bis wir den Colorado-River erreichten. Wir folgten dem Fluss bis zu einem Ort, an dem die Straße nach Bexar abbiegt. Schließlich sahen wir vor uns eine dünne Rauchfahne in der Prärie und ritten zu ihr hin. Wer beschreibt mein Erstaunen, als wir am Feuer einen einzigen Mann sitzen sahen. Es war niemand anderes als mein Gefährte Thimblerig. Ich erklärte dem Häuptling, dass dieser Mann einer meiner Freunde wäre und dass ich froh sei, ihn endlich gefunden zu haben. Die Indianer verabschiedeten sich dann und ich gab dem Häuptling als Geschenk ein großes Bowiemesser, das er als Andenken an den tapferen Jäger zu bewahren versprach.
Thimblerig war außer sich vor Freude mich wieder getroffen zu haben, doch dauerte es einige Zeit, ehe er sich von der Angst erholt hatte, die ihm die plötzlich in voller Kriegsbemalung heranreitenden Indianer eingeflösst hatten. Er erzählte mir, wie verzweifelt er gewesen sei, als er sich plötzlich allein fand. Nach zwei Stunden war er zu der Straße zurück geritten, auf der wir gekommen waren, und hatte dort auch den Bienenjäger wieder getroffen, der mit reicher Beute dahinzog. Das Geheimnis seines seltsamen Verschwindens klärte sich nun. Er hatte eine einsame Biene erspäht, die ihrem Stock zustrebte. In diesem Augenblick hatte ihn seine alte Leidenschaft übermannt und ohne an die Gefahren zu denken, in die er seine Gefährten durch sein unüberlegtes Verhalten bringen konnte, war er auf Suche nach Beute gezogen.
Ich erfuhr weiter, dass der Bienenjäger gerade fortgegangen sei, um ein Stück Wild zu schießen. Und tatsächlich, kurz darauf tauchte er auf, tief gebeugt unter der Last eines wilden Truthahns. Auch er freute sich, mich wiederzusehen, und trug Thimblerig auf, den Truthahn zu rupfen, damit wir bald mit einem Festessen unser Wiedersehen feiern könnten.
Früh am nächsten Morgen überquerten wir den Fluss und zogen weiter in Richtung auf Fort Alamo. Bis zwanzig Meilen vor San Antonio geschah nichts, was der Erwähnung wert gewesen wäre, außer dass sich uns ein alter, freundlicher Flusspirat anschloss. Dann aber, wir ritten gerade durch eine baumlose Prärie, erblickten wir plötzlich eine Bande von fünfzehn oder zwanzig Männern, die in vollem Galopp auf uns zugeritten kamen. »Seht euch diese Burschen an«, sagte der alte Flusspirat, der sonst oft stundenlang kein Wort redete, »ich wette, das ist ein Spähtrupp der Mexikaner«. – »Sie sind drei- oder viermal soviel wie wir«, sagte Thimblerig ängstlich. »Macht nichts«, erwiderte der alte Mann, »ich wette, es sind lauter Sträflinge, Galgenvögel und feige Schurken, die schon zu zittern beginnen, wenn sie ein lautes Wort hören. Wir wollen ausschwärmen, absteigen und auf unsere Waffen vertrauen!«
Wir folgten seiner Anweisung und stellten uns hinter unsere Pferde, die uns als Deckung dienten. Als unsere Gegner bemerkten, was wir taten, ritten sie langsamer und schienen ein paar Minuten miteinander zu beraten. Dann schwärmten sie aus und kamen auf Schussweite heran. Ihr Anführer rief uns etwas auf Spanisch zu. Wir verstanden diese Sprache nicht, aber der alte Mann erklärte uns, es sei die Aufforderung, uns zu ergeben.
»Jetzt wird es ernst«, fuhr der Flusspirat fort, »jeder von euch nimmt einen aufs Korn, danach gleich noch einen. Denn ehe sie sich vom ersten Schreck erholt haben, werden wir bestimmt zwei Schuss abgeben können. Sie, Oberst, sind ein guter Schütze. Deshalb bitte ich Sie, feuern Sie auf den großsprecherischen Kerl mit der roten Feder. Er zählt für drei.«
»Ergebt euch, oder wir schießen«, rief der Bursche mit der roten Feder auf Spanisch.
»Feuert und seid verflucht«, rief der Pirat mit lauter Stimme auf Englisch.
Sie folgten seinem Rat und in der nächsten Minute rollte eine Salve aus ihren Musketen so laut über uns hin, dass wir sicher waren, dass alle von ihnen abgedrückt hatten. Ehe der Rauch sich noch verzogen hatte, visierte jeder von uns seinen Mann an, und dann schossen wir. Nie habe ich ein solches Durcheinander in einer Schützenkette gesehen. Mehrere Pferde schossen ohne Reiter in die Prärie davon. Der Rest der Bande befand sich in wilder Flucht.
Wir bestiegen eilig unsere Pferde und nahmen die Verfolgung auf. So lange jagten wir diesen Buschräubern nach, bis wir vor uns auf den Schanzwerken von Alamo die Flagge der Freiheit erblickten.
Die Flüchtenden entkamen, wir aber ritten vor die Tore des Forts und ließen die Wachen wissen, wer wir waren. Die Tore wurden geöffnet, und unter den Willkommensrufen unserer Landsleute zogen wir in das Fort ein.