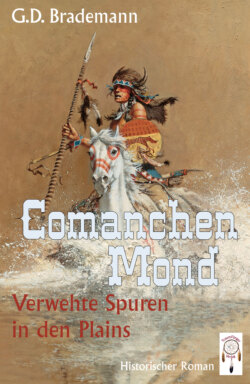Читать книгу Comanchen Mond Band 3 - G. D. Brademann - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Kapitel
ОглавлениеDie Vierte Kavallerie unter Three Fingers Mackenzie durchstreifte, unterstützt von seinen 20 Tonkawa-Spähern, den Texas Panhandle auf der Suche nach immer noch freilebenden Comanchen. Sie suchten sie an den Seitenarmen des Red River und ritten Meile für Meile weiter auf die Staked Plains zu. Es war nicht nur unbekanntes Terrain für die Armee, sondern auch für die Tonkawa. Den Quahari-Kriegern unter ihrem Anführer Quanah, den die Weißen wenig später Quanah Parker nennen sollten, gelang es, sich ihnen erfolgreich entgegenzustellen, bis Mackenzie sich wieder auf die alten Methoden der Texas Rangers besann und mit Scharfschützen und kleinen Grüppchen Jagd auf sie machte. Denn die Kavallerie, wie sie bisher vorgegangen war, richtete nichts gegen die Guerillakriegsführung eines Häuptlings, wie Quanah es war, aus.
Schon in einem Passus der Lederstrumpf-Erzählungen stand, dass Indianer nur auf Art der Indianer erfolgversprechend bekämpft werden konnten. James Fenimore Cooper wusste das schon damals.
Die Regierung der Vereinigten Staaten hatte allen noch immer freilebenden Comanchen, Kiowa-Apachen und Kiowa ein Ultimatum gestellt: Wenn sie sich nicht bis zum 15. Dezember des Jahres 1872 in der Nähe von Fort Sill einfänden, würde man sie als Feinde der amerikanischen Regierung betrachten. Das kam einer Kriegserklärung gleich. Was Quanah mit seinen Kriegern tat, war also nichts weiter, als Krieg gegen die Vereinigten Staaten zu führen. Es bedeutete auch, dass er und sein Volk im Falle einer Niederlage als Kriegsgefangene galten – nicht als Verbrecher oder Vertragsbrüchige, denn niemand von ihnen hatte jemals einen Vertrag mit den Weißen unterzeichnet. Jahre später sollte diese Tatsache ausschlaggebend für ihre Behandlung werden.
Was den Termin bis Mitte Dezember betraf, sollten sie sich bis dahin in Fort Sill melden, ihre Pferde und ihre gesamten Waffen abgeben, ihr bisheriges freies Leben aufgeben und von einem Tag auf den anderen „wie jeder normale Mensch“ von Ackerbau und Viehzucht leben. Welch ein Hohn, dass ausgerechnet Quäker für die Comanchen in der Reservation zuständig sein sollten. Schon allein diese Tatsache zeugte von der Unfähigkeit der Regierung der Vereinigten Staaten. Trotz der Knappheit der Zeit und der Ungeheuerlichkeit dieser Forderungen befolgte ein Großteil der Comanchen diesen Aufruf, denn sie waren am Verhungern, verzweifelt und demoralisiert. Nur die Quahari-Comanchen weigerten sich weiterhin beharrlich, in die Reservation zu gehen. Mackenzie war es nach und nach gelungen, ihre Lager ausfindig zu machen. Er ließ sämtliche Tipis niederbrennen, ihre Pferde erschießen und vernichtete ihre Vorräte für den Winter. Dann trieb er die Frauen und Kinder zusammen, verfrachtete sie in die Reservation – und dort brauchte man nur noch darauf zu warten, dass der Rest der Krieger ihnen folgte – denn sie konnten es nicht über sich bringen, ohne ihre Familien zu leben. Sie im Stich zu lassen, kam für sie nicht in Frage. Das war Mackenzies Art der Kriegsführung, doch er war kein Indianerschlächter.
Lieutenant Colonel Andy Fisher dagegen, der etwa sechs Wochen, nachdem Summer-Rain mit Storm-Rider durch den Red River entwischen konnte mit einer Abteilung Artillerie bei seiner Truppe eintraf, war einer. Bisher hatten seine Leute – zwei Schwadronen Kavallerie – die Furt am Red River bewacht, um aus der Reservation fliehende Indianer dort abzufangen. Tag und Nacht war die Kavallerie den Fluss abgeritten, hatte den Auftrag ernstgenommen, doch ohne Erfolg. Auf diesem Streckenabschnitt, den sie bewachen sollten, versuchte niemand, die Furt oder sogar den Fluss zu überqueren.
Endlich hatte Fisher einen Marschbefehl in der Tasche, der ihm ausdrücklich gestattete, gen Westen zu ziehen, um noch immer frei herumstreifende Comanchen aufzubringen – wie es so schön hieß. In Wirklichkeit war etwas ganz anderes gemeint. Er hielt den dortigen Posten noch eine Woche besetzt und lauerte verbissen an der Furt auf Indianer, die den Fluss in Richtung Westen überqueren wollten. Es gab nur diesen einen Weg durch den Red River, um aus der Reservation zu entfliehen. Auch hielt er Ausschau nach Indianern, die unterhalb des Arkansas River auf Büffeljagd gehen wollten. Vertraglich stand ihnen das noch immer zu – solange das Wasser fließt und das Gras wächst. Doch wen scherte das schon? Der Weiße Mann hatte nicht vor, einen einzigen der Friedensverträge, die in den letzten zehn Jahren mit großem Aufwand abgeschlossen worden waren, auch nur ansatzweise einzuhalten. Sie nahmen das Recht für sich in Anspruch, vertragsbrüchig zu werden; niemand bestrafte sie jemals dafür – auch nicht nach 100 Jahren, als sie es eigentlich besser wissen mussten. Das arrogante Amerika stellte sich gleichberechtigt mit Gott vor. Gott hatte beschlossen, dass nur der Weiße Mann berechtigt ist, das Land vom Atlantik bis zum Pazifik für sich zu beanspruchen; Gott hatte beschlossen, dass jeder Amerikaner eine Waffe besitzen darf. Noch heute sind viele Amerikaner fest davon überzeugt. Welch eine Anmaßung! Haben diese Amerikaner etwa mit Gott beim Frühstück zusammengesessen? Oder einen Deal ausgehandelt?
Die Indianer, die nur ihre Freiheit behalten wollten – auf die fiel diese Anmaßung wie ein Fallbeil herunter, und einer der Weißen – Lieutenant Colonel Andy Fisher – war wild entschlossen, genau dieses Fallbeil zu sein.
Doch sehr zu seinem Ärger kam dort, wo er mit seiner Truppe die Furt belauerte, niemand über den Fluss. Weder von Osten aus der Reservation, noch fand er Spuren, die nach Norden zum Arkansas River führten – es gab nicht das geringste Anzeichen von Indianern; es war, als ob die Erde sie verschluckt hätte.
Lieutenant Colonel Fisher dachte jedoch nicht daran, die Suche schon so bald aufzugeben. Sein Ehrgeiz ließ den Männern keine Ruhe. Immer wieder schickte er sie auf Patrouille über den Fluss. Der Freibrief der Regierung, der den Indianern noch bis zum Dezember Zeit ließ, interessierte ihn und andere Gleichgesinnte nicht die Bohne. Bereits jetzt waren die Indianer für sie Freiwild. Seiner Überzeugung nach – und da war er nicht der Einzige – sollte dieser Termin niemanden, der bei klarem Verstand war, daran hindern, auf Indianerjagd zu gehen. Nicht nur für ihn bedeuteten General Shermans Worte, dass er bisher nur tote Indianer gesehen hätte, die gute Indianer gewesen waren, das Maß aller Dinge. Und solche guten Indianer würden, nach Zahlen aufgelistet, bald in seinem Bericht stehen.
Schließlich brachten seine Pawnee-Späher ihm eine Nachricht, die ihn veranlasste, den Wachposten am Red River aufzugeben. Von Mackenzies Vorstoß in die Plains wusste er zu diesem Zeitpunkt nichts, und es würde an seiner Entscheidung auch nichts geändert haben. Nachdem er sich den Bericht der Scouts angehört hatte, war er sicher, dass sie auf eine vielversprechende Spur gestoßen waren, die nach Nordwesten führte. Anscheinend kamen diese Indianer – Comanchen, als die die Pawnee sie anhand von gefundenen Jagdpfeilen identifizierten, mit ihren Travois, Pferden und allem Besitz von Süden. Es waren noch immer sich frei auf den Plains bewegende Quahari, die sich außerhalb der Reichweite der Armee befanden. Sollten sie dennoch versuchen, sich in Sicherheit zu bringen – er, Andy Fisher, würde sie überall aufspüren, selbst noch im äußersten Zipfel der Comancheria, diesem großen Comanchenland, das nach Meinung der Comanchen noch immer bis in den Süden von Colorado hineinreichte. Das jedoch erkannte der Weiße Mann schon lange nicht mehr an. Eigenmächtig hatte er die Grenzen verschoben. Was interessierten ihn Verträge, die vor zehn oder noch mehr Jahren abgeschlossen worden waren?
Auch das Zehnte Kavallerieregiment mit seinen „Negersoldaten“, der so genannten Büffelarmee, war jetzt auf der Suche nach Indianern. Grierson, der es – sehr zum Ärger seines Vorgesetzten General Sheridan – aufgestellt hatte, war von Fort Davis aus losgezogen, bevor das Jahr 1872 oder der angekündigte Termin überhaupt vorüber war. Manchmal stieß dieser Teil der Armee auf halbverhungerte kleine Gruppen von Comanchen, die auf dem Weg nach Fort Sill waren, um sich der Gnade des Weißen Mannes zu ergeben. Sie konnten von Glück reden, wenn sie dann auf einen Kommandeur trafen, der sie einfach nur weiterziehen ließ, statt sie zu massakrieren, denn die Jagd auf die letzten Comanchen war in vollem Gange.
Lieutenant Colonel Fisher war entschlossen, dabei nicht untätig zuzusehen; er brannte darauf, allen seine Fähigkeiten zu beweisen. Da er nicht mehr der Jüngste war, saß ihm die Zeit im Nacken. Wenn er auf der Karriereleiter vorankommen wollte, dann musste er sich beeilen. Als er nach dem Krieg notgedrungen gezwungen war, die Seiten zu wechseln – er kämpfte in der Rebellenarmee gegen den Norden – war er in seinem Rang wie jeder Andere herabgestuft worden. Jetzt, mit Ende 40, ließ sein Ehrgeiz es nicht zu, weitere Jahre nur als Lieutenant Colonel sein Dasein zu fristen. Also entschloss er sich, der Spur, die die Pawnee entdeckt hatten, zu folgen. Den Befehl dafür hatte er ja bereits in der Tasche und war von General Sherman legalisiert worden, dass er jegliche Maßnahmen zu ergreifen bevollmächtigt war, um: „aller noch frei herumstreifenden Comanchen habhaft zu werden und diese wenn möglich unverzüglich in die Reservation zu verbringen“. Weiter hieß es noch: „Sich der Armee widersetzende Indianer sind nach eigenem Ermessen zu behandeln. Ich überlasse es Ihrer Entscheidung, wie Sie mit ihnen weiter verfahren.“
Das kam einem Freibrief gleich und ließ ihm genügend Spielraum. Also machte sich seine Abteilung, bestehend aus zwei Schwadronen – etwa 160 Mann Kavallerie, vier Pawnee-Scouts und einer Batterie Artillerie – 80 Mann – auf den Weg. Der Tross – unter ihnen ein Proviantwagen mit einem Koch, der zuvor einen Saloon geführt hatte – rumpelte hinter ihnen her.
Lieutenant Colonel Fisher war kein Mann von halben Sachen. Wenn, dann machte er etwas gründlich oder gar nicht. Seine Pawnee-Scouts führten die Truppe sicher durch unbekanntes Terrain bis zum Canadian River, dann überquerten sie den Fluss und zogen nach Westen weiter. Unterwegs stießen die aufmerksamen Indianerscouts immer wieder auf Spuren, die ohne Zweifel von einem wandernden Volk stammten. Egal, wohin sie auch ziehen mochten, Fisher würde ihnen auf der Spur bleiben. Doch plötzlich fanden sie nichts mehr. Tagelang ließ der Lieutenant Colonel die Gegend durchsuchen – vergeblich. Wie es aussah, hatte irgendein Unwetter sämtliche Spuren beseitigt. Selbst die tiefen Abdrücke der Travois, die vor Wochen hier entlanggekommen sein mussten, waren nicht mehr zu sehen. Allmählich verließ Fisher seine anfängliche Zuversicht, und Enttäuschung machte sich breit. Die Moral der Truppe befand sich auf dem Tiefpunkt. Der Mangel an frischem Trinkwasser und die immer gleichbleibende Verpflegung trugen auch nicht gerade zur Verbesserung bei, und die Hitze war kaum noch zu ertragen.
Das Terrain, in dem sie sich jetzt vorwärtsbewegten, war für die Armee unbekanntes Land und die Gegend menschenleer. Keine Ranch, keine Farm – nur vertrocknete Erde, Klapperschlangen, Wind und sprödes, gelbes Gras, das ihre Pferde nicht mochten. Manch einer der Soldaten fragte sich, warum man diesen verfluchten Landstrich nicht einfach den Indianern überließ. Allmählich ging auch das Futter für die Pferde aus. Fisher trieb sie unbarmherzig weiter und schickte die Pawnee immer wieder los. Irgendwo mussten sie doch wieder auf die Spur der Comanchen stoßen. Schließlich konnten sie sich doch wohl nicht in Luft aufgelöst haben. Endlich erreichten sie besseres Gelände. Die Vegetation wurde grün, wenn auch nicht üppig, aber immer noch besser als das, was hinter ihnen lag. Und am nächsten Tag kehrten die Späher mit guten Nachrichten zurück. Die Scouts, die über zehn Meilen vor ihnen gewesen waren, hatten eine Schleppspur entdeckt, die durch die Berge bis hinein nach Neu-Mexiko führte – dicht am Apachengebiet entlang, was die Pawnee nachdrücklich betonten.
Lieutenant Colonel Fisher hatte keine Ahnung, woher sie ihre Kenntnisse nahmen, denn selbst die Armee wusste nicht genau, wo das Apachengebiet begann und wo es endete. Egal, sie hatten etwas Brauchbares gefunden. Apachen interessierten hier niemanden – jetzt jedenfalls noch nicht und Fisher schon gar nicht. Um die sollten sich andere kümmern, sagte sich Fisher; er war hinter Comanchen her. Die Spur, der sie jetzt folgten, führte nach Norden in Richtung Rio Grande del Norte, den sie hier den Rio Bravo nannten oder auch einfach nur den großen Fluss. Obwohl den Lieutenant Colonel die Apachen nicht kümmerten, spornte er seine Scouts an, nach Hinweisen zu suchen, während seine Truppe die Berge überquerte.
Fisher hatte eine feste Meinung, was Indianer betraf. Von den erbärmlichen Zuständen im Reservat einmal ganz abgesehen, waren es diese Menschen nicht wert, überhaupt zu existieren, denn sie lagen den wahren Amerikanern nur auf der Tasche – niemandem nützte ein lebender Indianer. In A. Fishers Welt hatten weder Indianer noch Schwarze Platz; jeden Hund hätte er besser behandelt als einen von ihnen.
Nachdem sie nun wieder ein Ziel vor Augen hatten, besserte sich die allgemeine Stimmung. Seinen Männern ließ der Lieutenant Colonel nur die allernötigste Zeit zum Rasten. Unerbittlich trieb er sie mit harter Hand vorwärts. Es war auch nicht mehr so heiß. Einmal regnete es sogar, und sie füllten an einem ihnen unbekannten Fluss, der auf keiner Landkarte, die einer der beiden Adjutanten bei sich führte, verzeichnet war – ihre Wasservorräte auf. Die Stimmung unter den Soldaten konnte nicht besser sein. Im Laufe der nächsten Tage kamen die Pawnee-Späher immer wieder mit guten Nachrichten zurück.
Die breite Spur der Travois, tief eingegraben in das Gras der Prärie, führte sie geradewegs nach Nordwesten ins Colorado-Territorium.