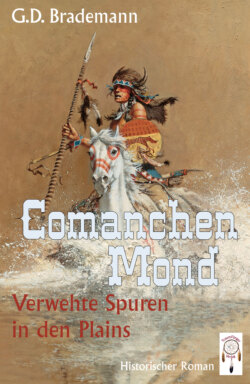Читать книгу Comanchen Mond Band 3 - G. D. Brademann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеAuf ihrem Platz vor dem Tipi hatte Großmutter nur kurz in ihrer Arbeit innegehalten, um ihren Rücken durchzudrücken und ein wenig zu verschnaufen. Seit dem frühen Morgen war sie nun schon damit beschäftigt, Büffelhäute zu gerben. Sie stammten noch von der letzten Jagd und sollten ältere Exemplare auf dem Boden ihres Tipis ersetzen, deshalb mussten sie besonders weich und anschmiegsam werden. Müde wischte sie sich den Schweiß von der Stirn, dann machte sie weiter. Whirl, wie Summer-Rain ihre Gescheckte nannte, stand grasend in der Nähe. Wo sich ihre Reiterin aufhielt, konnte sie nur erahnen. Seit sie zurück war, musste sie einen Besuch nach dem anderen machen. Für sie und ihren Ehemann war inzwischen in dem kleineren Tipi alles bereit – wenn sie denn irgendwann einmal kommen würden. Egal, wie viele Verpflichtungen die beiden auch hatten, Großmutter fand es unmöglich, dass sie sich hier nicht sehen ließen. Noch lagen alle Hochzeitsgeschenke vor dem Tipi, das man von hier aus gerade noch sehen konnte, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte. Storm-Rider und Summer-Rain würden sie zusammen begutachten und dann weiterverteilen. Großmutter seufzte – sie hatte es noch nicht übers Herz gebracht, ihr von dem Fremden zu erzählen, denn das konnte sie noch früh genug. Sollte jemand anderes den Mund nicht halten können, dann ersparte er ihr damit die unangenehme Aufgabe, ihr diesen Tag zu verderben. Sie wischte den Gedanken an den toten Cheyenne mit einem Kopfschütteln weg, sah hoch und entdeckte Magic-Flower, die vom Fluss heraufkam, einen Wassersack unter dem Arm.
Unwillkürlich zog sich Großmutters Stirn in Falten. Der Hass der jungen Frau auf Summer-Rain war allgemein bekannt – spätestens seit der Sache mit Icy-Wind. Wenn man ihr auch nichts nachweisen konnte – allein der Verdacht, dass sie daran nicht ganz unschuldig war, genügte. Seitdem konnte ihre Schönheit niemanden mehr über ihren Charakter hinwegtäuschen. Nachdem Storm-Rider Icy-Wind getötet hatte, kam heraus – Light-Cloud hielt die Wahrheit nicht zurück – dass sie es gewesen war, die ihm vom Angriff auf Summer-Rain berichtet und ihn so zu Icy-Wind gelockt hatte. Zu dumm für Icy-Wind, dass Running-Fox in das Kampfgeschehen eingegriffen hatte und so seinen Tod verhindern konnte. Großmutter wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Doch anstatt sich reumütig zurückzuziehen, spielte sich das junge Mädchen weiter in den Vordergrund. Das war ihre Art, mit all dem Geschehen umzugehen. Ihr triumphierendes Auftreten hatte aber nicht mehr die Wirkung wie früher und kehrte sich in das Gegenteil, denn immer mehr ihrer Freundinnen trennten sich von ihr. An Magic-Flower jedoch prallte das alles ab. Sie wollte es nicht wahrhaben; nur so konnte man sich ihr Verhalten erklären.
Das alles ging Großmutter jetzt durch den Kopf, während sie sich wieder über die Büffelhäute hermachte. Aus heiterem Himmel erinnerte sie sich an ihre eigene Jugend. Einmal hatte sie sich die Schwäche erlaubt, sich in einen jungen Kiowa zu verlieben. Daraus war nichts geworden, denn die Kiowa heirateten nur innerhalb ihres eigenen Volkes. Das war so nicht ganz richtig, es gab natürlich auch Ausnahmen. Sie hatte nicht um ihre Liebe gekämpft und den einfacheren Weg gewählt.
Großmutter seufzte – danach war sie eine Zweckehe eingegangen. Nun ja, sie konnte sich wahrlich nicht beklagen. Ihr Mann war immer bemüht gewesen, ihr alles rechtzumachen, und hatte sie gut behandelt. Trotz all der vielen Fehlgeburten, der Kinder, die nur ein, zwei Tage überlebten, war er bei ihr geblieben. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Nein, murmelte sie leise vor sich hin, ich kann mich nicht beklagen. Er war bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen; seitdem war sie allein. Sie wollte keine Ehe mehr eingehen, obwohl Great-Mountain ihr das immer wieder nahegelegt hatte, und genügend Bewerber hatte es gegeben. Am aufdringlichsten war Antelope-Son gewesen. Er hatte ihr schon vor der Geschichte mit dem Kiowa nachgestellt.
Sie erinnerte sich wieder an den Tag, als Sun-In-The-Red-Hair mit den Kriegern ins Lager gekommen war. Bei ihr und ihren beiden Kindern hatte sie ihr Glück gefunden. Später, als ihr kleiner Schmetterling in ihr Tipi flatterte, hätte sie mit niemandem mehr tauschen mögen. Wieder fiel ihr Antelope-Son ein. Er war damals über ihre Ablehnung nicht hinweggekommen. Nur um sich abzulenken, hatte er an diesem Kriegszug teilgenommen, von dem die Männer Sun-In-The-Red-Hair und drei Kinder mit zurückbrachten – Moon-Night und diese beiden Jungen, Raven-Feather, der einer ihrer besten Pferdemänner wurde, und sein jüngerer Bruder Arrow-Head.
Als käme die Vergangenheit auf sie zu, sah sie Antelope-Son plötzlich leibhaftig vor sich. Ungläubig kniff sie die Augen zusammen. Was machte er denn hier? Gerade eben hatte sie an ihn gedacht. Leicht amüsiert verbiss sie sich ein Lachen. Der stolze Krieger von damals kam jetzt auf einen gebogenen Stock gestützt, schlurfenden Schrittes näher. Alt und gebrechlich, mit zerfurchtem Narbengesicht, hielt er direkt vor ihr. Den Kopf mit den weißen Haaren, ordentlich zu zwei langen Zöpfen geflochten, schief gelegt, überlegte er, wo er war. Endlich hob er den Zeigefinger und tippte ihr damit an die Schulter. Großmutter ließ ihn gewähren, denn sie wusste um seine Vergesslichkeit.
Dieser Zustand hatte sich erst in den letzten sechs Monden so sehr verschlechtert, dass man ihn eigentlich niemals mehr allein umhergehen lassen konnte. Immer war jemand schnell zur Stelle, um ihn wieder zu seinem Zuhause zu bringen. Noch einmal tippte er sie an. Auf einmal huschte es wie ein Erkennen über sein eingefallenes Gesicht. Die fast nicht mehr sichtbaren Lippen kräuselten sich in tausend Fältchen, verschwanden in seinem zahnlosen Mund. Dann öffnete er ihn und erstrahlte in einem wissenden Lächeln. Es erreichte die Augen, die wie kleine runde Kieselsteine in dunklen Höhlen wohnten. „Ich gehe jetzt in die Berge, meine Liebste“, murmelte er geheimnisvoll. „So weit weg, wie ich kann, doch das darfst du niemandem sagen. Ich will nicht, dass man mir folgt und mich wieder zurückbringt.“
Seine Handflächen strichen sanft über ihre Schultern. Unverkennbar war er bei völlig klarem Verstand. „Wenn du mich damals nur gewollt hättest, meine Schöne, dann wäre manches anders gekommen. Der, der den Bruder deiner Nichte getötet hat, diesen Cheyenne – er stand mir damals nahe. Ich bin mit ihm auf diesen Kriegszug geritten, du weißt schon, um zu sterben oder dich zu vergessen – hat beides nicht geklappt.“
Den Kopf hochgereckt, lauschte er in den Wind – kicherte und sagte: „Sun-In-The-Red-Hair hat ihm damals, genau wie du mir einmal, das Herz herausgerissen. Danach ist er unempfindlich geworden gegen alle Freuden des Lebens. Dein Bruder hätte sich heraushalten sollen. So viel ist deshalb passiert – vor 34 Wintern – ich hab sie alle gezählt. Du und ich, wir sind keine jungen Leute mehr, wir sind mit dem Wind alt geworden. So ist das eben, und nun werde ich heimgehen, heim zu dem Schöpfer, der uns gemacht hat. Es wird endlich Zeit.“
Großmutter, die ihm bis jetzt nur stumm zugehört hatte, blickte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Wäre in diesem Moment ein Blitz neben ihr eingeschlagen, sie hätte sich nicht gerührt. Was wusste Antelope-Son von Icy-Wind und Sun-In-The-Red-Hair? Dann wurde sie wütend. „Du sprichst von Dingen, die lange vorbei sind; lass sie endlich ruhen.“ Sie meinte das mit ihm und ihr.
„Oh, Feet-That-Sing-When-They-Walk kann ja reden“, nannte er sie bei ihrem Mädchennamen. Verwegen blinzelte er mit einem Auge. Großmutter löste sich von seiner Berührung, indem sie einen Schritt nach hinten machte. „Es ist erstaunlich, an was du dich noch alles erinnerst, Antelope-Son“, erwiderte sie scharf. „Du solltest deine Erinnerungen in die Berge mitnehmen, anstatt sie hier vor mir auszubreiten. Du verschwendest nur meine Zeit!“
„Du hast recht, meine Liebste“, sagte er, bedauernd die Hände betrachtend, die nun nicht mehr auf ihrer Schulter lagen. „Es ist ohnehin schon zu lange her. Die Zeit hat dich und mich in verschiedene Richtungen gehen lassen. Dabei hätte ich deinen Weg leichter machen können, es hätte mich nur ein einziges Wort gekostet.“ Die in seinen Worten mitschwingende Drohung erkannte Großmutter wohl. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich jäh. In seinen Augen erschien ein seltsamer Glanz, und sie wurden groß und rund – so, als ob sich dort etwas hervordrängen wollte, was nicht aus seinem Mund kommen durfte.
Großmutter aber musste es wissen. Entgegen ihrer vorangegangenen Worte überwand sie ihren Abscheu und sagte in mildem, versöhnlichen Ton: „Ich sehe doch, dass dich etwas bedrückt, du solltest das, was dir auf dem Herzen liegt, nicht weiter mit dir herumschleppen.“
„Meine Zeit ist vorbei“, meinte er leichthin, den Blick in die Ferne gerichtet.
Sie wartete, ebenfalls ihre Augen nach dort gerichtet, nicht auf etwas Bestimmtes, nur irgendwohin; sie konnte ihn nicht einmal ansehen.
Den Kopf wieder der Frau zuwendend, die er einst so sehr begehrt hatte, sprühte es förmlich aus ihm heraus. „Siehst du, ich habe mich an deinen Namen erinnert, als du ein junges Mädchen gewesen bist:
Feet-That-Sing-When-They-Walk. Ich weiß noch genau, dass du deinen Bruder damals zu ihr geschickt hattest“, erinnerte er sich wieder an seine Worte von eben. Oh ja, ein einziges Wort von ihm hätte genügt – doch es nicht zu auszusprechen, war seine Rache gewesen, seine Rache wegen ihrer Abfuhr. Soll sie doch jetzt erkennen, welchen Fehler sie damals gemacht hatte! Antelope-Son wischte sich mit der Zunge über die welken Lippen. „Ja“, stieß er hervor und ihm war durchaus klar, was er da sagte. „Sie haben Sun-In-The-Red-Hair verfolgt – damals, als wir Männer sie ins Lager brachten, und Crow-Wing war die Schlimmste von allen. Du dagegen hast ihr Essen gegeben und eine Decke. Ich weiß das, denn ich habe es gesehen; ich wusste immer, wo du warst, auch in jener Nacht.“
Zufrieden betrachtete er das entsetzte Gesicht von Großmutter. Ja, das hatte sie nicht gewusst – und das war noch lange nicht alles. Beinahe triumphierend sprach er weiter. „In dieser Nacht wollte Crow-Wing dafür sorgen, dass sie stirbt. Das wäre sie auch, wenn Icy-Wind sie nicht aus dem Wasser gezogen und das verhindert hätte, denn jetzt wollte er Sun-In-The-Red-Hair, obwohl er vorher etwas anderes behauptet hatte. Dieser Mann war sich mit seiner Arroganz immer schon selbst im Wege. Als dein Bruder und er dann aufeinandertrafen, konnte er die entscheidenden Worte doch nicht sagen; er brachte es einfach nicht fertig, stattdessen gingen sie im Unfrieden auseinander.“
Antelope-Son hielt inne; seine alten Augen sahen nicht mehr so gut wie früher. Was sich jetzt jedoch vor seiner Nase abspielte, das bemerkte er in lichten Momenten wie diesen noch gut: Großmutters gequälter Ausdruck entging ihm nicht, doch es war ihm immer noch nicht genug. „Dein Bruder, der von den Gefühlen Icy-Winds nichts ahnte, machte sich ihn dort bei diesem Zusammentreffen für immer zum Feind“, fuhr er fort, sie zu quälen. „Dieser Mann, der jetzt tot ist, umgekommen in einem fairen Kampf, hat das Erlebnis von damals nie verwunden, und der Hass hat ihn aufgefressen. Eure ganze Familie musste dafür büßen; nur dafür hat er noch gelebt. Ich habe es gesehen, mit eigenen Augen, in dieser Nacht. Damals entschied sich das Schicksal von Sun-In-The-Red-Hair und Icy-Wind. Dieser Mann hat gelitten, unendlich gelitten und es nicht ertragen können, dass dein Bruder über ihn triumphiert hat. Der Schmerz, den auch ich einst gefühlt habe, hat ihn Wege gehen lassen, die er sonst niemals gegangen wäre. Begreifst du, wie leicht es gewesen wäre, all das kommende Unglück, all den Kummer von deiner Familie abzuwehren? Ein Wort von mir an deinen Bruder hätte genügt.“
Großmutter starrte ihn an, als wäre er ein Dämon. Er wollte ihr wehtun, erkannte sie in diesem Moment. Sie hatte es einmal getan, aber auf andere Weise, doch das war jetzt egal; sie konnte nicht zulassen, dass er zuletzt noch triumphierte. „Wenn du dir einbildest“, fuhr sie ihn an, „mein Bruder hätte diese Frau, von der du sprichst, zurückgewiesen, nur um allem Ärger aus dem Weg zu gehen, dann irrst du dich gewaltig, alter Mann – nie im Leben! Wenn du damals zu mir gekommen wärest, um mir all das zu sagen, was du heute hier hergetragen hast, um mir weh zu tun, so muss ich dich enttäuschen. Dieses Wissen hätte uns nur stärker gemacht – es hätte nichts, überhaupt nichts, geändert.“
Ihr Herz schlug schneller. Dieser alte, boshafte Mann hier sprach doch tatsächlich von Unglück und Kummer! Was wusste er denn schon! Eines aber wurde ihr klar: Wenn Three-Bears davon etwas gewusst hätte, wäre er sicher auf Icy-Wind zugegangen, um mit ihm Auge in Auge darüber zu reden. Wie das ausgegangen wäre, konnte niemand im Nachhinein wissen; zumindest hätte er es versucht. Schon wollte sie Antelope-Son das vorwerfen, da besann sie sich. Welch ein Irrsinn, denn eigentlich sollte man doch wohl mit dem Alter klüger werden; der hier jedenfalls nicht.
Verletzter Stolz nagte noch immer an seinen Knochen. Sein Groll auf sie hatte ihn damals daran gehindert, mit ihr darüber zu sprechen. Egal, ob es etwas genützt hätte oder nicht – er hätte es einfach nur tun sollen.
Sie sah ihn an und fragte sich, ob sie an all dem Unglück die Schuld trug. Dark-Night, Light-Cloud, Summer- Rain, Running-Fox, zählte sie in Gedanken auf. Zuletzt hätte es auch Storm-Rider beinahe das Leben gekostet. Nein, wusste sie plötzlich, nein, das alles war nicht meine Schuld. Mit diesem Mann hier hätte sie nie ihr Leben teilen können, auch nicht um den Preis seines Geständnisses. „Vielleicht hättest du mir tatsächlich viel Kummer und Leid ersparen können, Antelope-Son“, wies sie ihn mit fester Stimme zurecht.
„Hätte ich, hab ich aber nicht“, unterbrach er sie, freudig erregt. Ein schlaues Lächeln ließ seine Mundwinkel zucken. Sein Kopf wackelte belustigt hin und her; er schien sich an dieser Vorstellung zu weiden.
Großmutter hatte noch nicht zu Ende gesprochen. „Aber“, fuhr sie fort, ihn mit hochgerecktem Kinn betrachtend, „heute bin ich fest davon überzeugt, dass aus unserer Verbindung ein viel größeres Unglück hervorgegangen wäre. Ich muss dir daher dankbar dafür sein, dass du mir das alles nicht erzählt hast. Vielleicht hätte ich ja den Fehler begangen und meine Entscheidung gegen dich damals noch einmal überdacht.“
Oh? Antelope-Sons Gesicht, alt und runzlig, fiel in sich zusammen. Großmutter konnte regelrecht sehen, welche Gedanken ihm im Kopf herumsprangen. Umständlich verlagerte er sein Gewicht; kurz schwankte er, doch dann umklammerte er mit seinen Fingern, die voller Gichtknoten waren, den Stock nur fester. Großmutter sah, wie er vor Schmerzen das Gesicht verzog; seine Arthritis machte ihm zu schaffen – oder waren es ihre Worte? Es tat ihr nicht einmal leid, ihn so zu sehen. Die Jahre hatten alte Leute aus ihnen beiden gemacht. So viel Zeit war seit damals vergangen. Was geschehen war, konnte niemand mehr rückgängig machen. Den Entscheidungen, die man einmal getroffen hatte, folgten andere; wer konnte da schon vorher wissen, wohin sie führten?
Ob sie gut oder schlecht waren, richtig oder falsch? Dieser alte Mann bildete sich ein, die Geschichte beeinflusst zu haben und damit auch ihre Zukunft und die ihrer Lieben. Lachhaft, sagte sie sich, einfach nur lachhaft – diese Macht besaß kein Mensch; genauso wenig hätte er den Wind beeinflussen können. Kurz war sie versucht, ihn ins Gras zu stoßen. So sieht deine Macht aus, alter Mann, wollte sie ihm damit zeigen, so schwach bist du damals gewesen und bist es auch heute noch.
Was war aus ihm geworden? Antelope-Son, einst ungebührlich arrogant und anmaßend – jemand, der sich einbildete, anderer Leute Schicksal bestimmt zu haben – stand jetzt am Rande des Todes. Die letzten Worte von Großmutter trafen diesen ehemals starken und tapferen Krieger zutiefst. Heute war er nichts mehr von beidem, heute war er einfach nur seines Lebens überdrüssig. Jetzt aber hatte er sich unbewusst etwas aufgeladen, worüber er auf seiner letzten Wanderung nachgrübeln konnte – wenn er denn klar im Kopf sein würde. Sein Blick glitt über Großmutters Gestalt, als wollte er sich jede Einzelheit für den kurzen Rest seines Lebens einprägen – obwohl er es ja doch schon bald wieder vergessen würde. Vielleicht sah er sie ja in diesen Augenblicken der Erinnerung, wie sie als junges Mädchen gewesen war – als die, deren Füße sangen, wenn sie ging.
Ohne sich von ihr zu verabschieden, drehte er sich um. Sein letzter Weg würde ihn in die Berge führen, so weit ihn die alten, müden Beine trugen.
Gerade schlurfte er einen langgezogenen Hügel hinauf, da tauchte Great-Mountain atemlos auf einem kleinen Mustang auf, und Großmutter rief ihn an. Mit ihrer bestimmten, keinen Widerspruch duldenden Art machte sie ihm begreiflich, dass es sinnlos war, Antelope-Son aufzuhalten.
Great-Mountain stand lange neben ihr. Beide blickten sie dem alten Mann nach – jeder für sich allein.
„Hat er noch etwas gesagt?“
Großmutter wandte dem Friedenshäuptling langsam den Kopf zu. In ihren Augen war keinerlei Regung. „Nein“, log sie mit fester Stimme. „Nur Belangloses, nichts von Bedeutung. Er ist froh, diesen Weg noch allein gehen zu können – lassen wir ihn sein Leben zu Ende bringen.“ Und mögest du niemals Ruhe finden – nach dem, was du angerichtet hast. Aber das sprach Großmutter nicht aus.
Great-Mountain nickte. Die Gestalt des alten Mannes war längst verschwunden. Großmutter schloss die Augen. Ich bin alt, dachte sie, so alt und ebenfalls müde.
Summer-Rain holte Whirl, ihre Gescheckte, und warf ihrer Großmutter einen prüfenden Blick zu. Die stand noch immer neben den Büffelhäuten, aber Great-Mountain war nicht mehr bei ihr. „Warum hast du mir nicht erzählt, dass da ein weißer Mann ist, der mich sprechen will?“ Ein leiser Vorwurf schwang in ihrer Stimme mit. Sie griff nach dem Widerrist ihres Ponys und schwang sich auf seinen Rücken.
„Das hat keine Eile – lass ihn warten.“ Unwillig schob Großmutter die Unterlippe vor. Irgendjemand musste geplaudert haben. Doch nun wusste sie ja Bescheid, anscheinend aber nicht über alles.
„Wir haben uns um ihn gekümmert“, meinte sie dann doch. „Mach dir keine Sorgen; ich wollte, dass er in meinem Tipi auf dich warten soll – er zog aber die Nähe der Pferdeherde vor.“ Das stimmte zwar, und doch war sie erleichtert gewesen, als er sich so entschieden hatte. Summer-Rain verlagerte ihren Oberkörper leicht nach vorn, und Whirl setzte sich in Bewegung. „Ich reite zu ihm.“ Mehr sagte sie nicht, unzufrieden die Stirn runzelnd. Warum glaubte Großmutter noch immer, besser zu wissen, was für sie gut war? Oder was sie tun sollte? Ihr Pony wurde hinter dem dichten Gesträuch, das zwischen dem Fluss und der Ebene lag, schneller, preschte weiter bis hin zu den Hügeln im Osten, vor denen die ersten Pferde der riesigen Herde grasten. Einige Stuten, deren im Frühjahr geborene Fohlen miteinander spielten, hoben die Köpfe. Summer-Rain ritt mitten durch sie hindurch, überquerte einen Hügel und grüßte laut die Pferdejungen – überwiegend mexikanische Kriegsbeute, die schon seit langem bei ihnen lebten. Ein hellblonder älterer Mann saß auf einem der Pferde, die ihrem Bruder Light-Cloud gehörten. Er kam heran und hielt neben ihr. Aus seinem braungebrannten Gesicht stachen die hellen Augen besonders deutlich hervor. Ansonsten erinnerte nichts mehr an den kleinen Jungen, der einst so verängstigt auf Red-Eagles Pferd gesessen hatte. Seine Muttersprache kannte er schon lange nicht mehr – er war zu einem vollwertigen Comanchen geworden. Auch sein Bruder musste irgendwo in der Nähe sein; beide blieben nie lange voneinander getrennt.
„Du suchst sicher den weißen Mann, Summer-Rain“, redete er sie freundlich an. Dass sie mit Storm-Rider zurück war, hatte sich bereits bis hier herumgesprochen.
„Wo ist er?“ Mit einer Hand die Augen gegen die Sonne abschirmend, blickte sie sich suchend um.
Über das Gesicht des Mannes glitt ein wissendes Lächeln. Wenn der Fremde seit seiner Ankunft hier draußen lebte, dann war es wahrscheinlich, dass er wusste, wo er steckte. „Hinter den großen Felsen“, kam es prompt. Sich eine ergrauende Haarsträhne aus der Stirn streichend, zeigte er ihr die Richtung. „Manchmal denke ich, er traut uns nicht. Glaubt wahrscheinlich, wir stehlen seine beiden Pferde. Dabei müsste er doch wissen, dass sie hier in unserem Lager sicherer sind als irgendwo sonst.“ Tief luftholend grinste er jetzt. „Obwohl“, sagte er, bevor er weitersprach, vor sich hin kichernd, „das eine Pferd, dass da bei ihm ist, dass wäre es schon wert, gestohlen zu werden.“ Jetzt strahlte er über das ganze Gesicht, in dem man die Falten schon nicht mehr zählen konnte. „So eines hast du noch nie gesehen, Summer-Rain, es ist irgendwie“, um Worte verlegen formte er mit den Händen einen viereckigen Rahmen. „Etwa so!“
Sie hörte schon nicht mehr hin. Wenn sie sich auch sonst brennend für Pferde interessierte – auf einmal hatte sie es eilig. Sie wollte endlich wissen, wer der Fremde war, denn eine Ahnung kam ihr, die ihr Angst machte.
Je näher sie der kleinen Felsengruppe kam, desto mehr verstärkte sich dieses Gefühl. Der Gedanke, dass dieser Mann etwas mit Running-Fox zu tun haben könnte, ließ ihr Herz schneller schlagen. Warum sonst fragte er ausgerechnet nach ihr? Nein, nein, sie wollte nicht an diesen schrecklichen Tag erinnert werden. Nicht jetzt, nicht heute – nicht an diesem wunderschönen Tag.
Whirl stob dahin, als gelte es, ein Wettrennen zu gewinnen. Sie bemerkte gar nicht, dass sie sie zur Eile antrieb. Schon hatten sie die Felsengruppe fast erreicht. Mit ungewohnt harter Hand stoppte sie ihre Gescheckte, glitt von ihrem Rücken und ließ den kleinen Mustang frei laufen.
Ein Wiehern kam von der anderen Seite der Felsengruppe. Zuerst zögernd, dann schneller gehend, erreichte Summer-Rain sie. Das Erste, was sie dann sah, war ein Pferd, nicht viel größer als ihr eigenes, jedoch mit einer sehr kräftigen Statur, einem kleinen, geraden Kopf, wachem Ohrenspiel und Augen, die sie mit einem fast menschlichen Ausdruck neugierig musterten. Der vordere Teil bis zum Widerrist war tief dunkelbraun, fast schwarz – sogar die Beine. Dann sah es so aus, als hätte jemand eine Decke über sie ausgebreitet – eine weiße Decke mit dunklen, unregelmäßig großen Punkten und Flecken. Der Schweif wiederum hatte die gleiche Farbe wie der vordere Teil des Pferdes. Dort, wo man kein Fell sehen konnte – an den Nüstern und unter dem Bauch – war auch die Haut gefleckt. Ihr geübter Blick erkannte sofort seine Stärken. Der kurze, mit Muskelsträngen durchzogene Rücken und die schräg abfallende ebenfalls kräftig ausgebildete Kruppe zeichneten die Stute als einen sehr wendigen, schnellen Renner aus.
Summer-Rain konnte kaum den Blick von ihr abwenden. Für einen langen Augenblick vergaß sie, warum sie eigentlich hergekommen war. Eine Palouse, konnte sie nur noch denken, eine Palouse! Sie hatte den Atem angehalten, ihr ganzer Körper kribbelte bis in die Zehenspitzen. Der Blick des schönen Tieres wandte sich von ihr ab, und der Zauber verging in dem Moment, als sie den Weißen sah. Ihre Ahnung hatte sie nicht getrogen. Nach allem, was sie über ihn wusste, konnte das nur Erik Machel sein – Erik Machel, Running-Fox´ weißer Ziehvater. Sie zwang all ihre Empfindungen zurück, und ihr Herz fand allmählich wieder in seinen normalen Rhythmus. Tief luftholend stellte sie sich ihm und seinen Fragen.
Er saß vor einem kleinen Feuer, die langen Beine ausgestreckt. Seine schlanken Finger hantierten an einem Stück Leder, das sie als Zaumzeug erkannte. Es sah seltsam aus – ganz anders, als das, das sie selbst benutzte; doch darum ging es jetzt nicht. Ihr Blick glitt über ihn, musterte ihn unverhohlen, da sie sah, dass er das jetzt auch mit ihr machte.
Erik Machel sah jünger aus als 36. Sein längliches, von der Sonne dunkel verbranntes Gesicht mit den eingefallenen Wangenpartien hatte etwas männlich Herbes, das von einem harten Leben zeugte. Sein schmaler, ausdrucksvoller Mund öffnete sich leicht, als wollte er etwas zu ihr sagen, doch nach einem kurzen Zögern stand er nur auf. Irgendwie wirkte das unbeholfen, fast plump, aber das lag sicher nur an dieser Situation, denn er wusste sofort, wer sie war. Man konnte es ihm ansehen: Seine ganze aufgestaute Wut stand ihm ins Gesicht geschrieben, und Summer-Rain erschrak. In seinen eisgrauen Augen erkannte sie all den Schmerz, all die Trauer, die sie selbst noch immer empfand – das hatte sie nicht erwartet. Stumm streckte sie ihm eine Hand entgegen, die er aber nicht beachtete – ja, sein Mund zuckte nur verächtlich; auch das hatte sie nicht erwartet. Dann kam ihr eine Ahnung. Oh nein, woher sollte er es denn wissen? Sie ließ ihren Gefühlen freien Lauf, ihr Gesicht verzerrte sich – und plötzlich, ohne dass sie es verhindern konnte, brach sie in Schluchzen aus. So stand sie vor ihm, beide Hände, unter denen Tränen hervorquollen, vor dem Gesicht. Endlich wurde sie ruhiger – und er auf einmal unsicher. Seine Gedanken flatterten durcheinander, er wusste nicht, was er von ihrem Verhalten denken sollte – wusste gar nichts mehr. Nachdem er hier erfahren hatte, was mit Running-Fox passiert war, hatte ihn tiefe Verzweiflung ergriffen und grenzenlose Trauer. Dann hatte sich das in Unverständnis gekehrt, danach in Wut über dieses Mädchen.
Summer-Rain wischte ihre Tränen nicht fort – der Wind würde sie trocknen.
„Setz dich“, kam es unfreundlich, harsch aus Erik Machels Mund in der Sprache der Comanchen.
Summer-Rain hatte sich zwar gefasst, kam der Aufforderung jedoch nicht nach. Unschlüssig glitt ihr Blick hinüber zu der Palouse, dann wieder zu dem weißen Mann.
„Ich hab gesagt, du sollst dich setzen“, sagte der jetzt in einem scharfen Ton.
Noch immer stand sie unschlüssig neben dem Feuer. Jetzt setzte er sich wieder, das Zaumzeug noch immer in der Hand. Es diente ihm wie ein Rettungsanker, an dem er sich festhalten konnte. „Ich bin Erik Machel, wie du dir vielleicht schon denken kannst“, kam es von ihm, noch immer unfreundlich.
Bevor er sie noch mehr anherrschen würde, setzte sie sich schnell – auch, damit er nicht zu ihr aufsehen musste, denn das wäre eine schreckliche Zumutung gewesen. Erst in diesem Moment begriff sie, dass er Comanche sprach, und zuckte zusammen. Was wusste sie denn schon über ihren Bruder Running-Fox? Gar nichts, durchfuhr es sie, überhaupt nichts – genauso wenig wie über seinen Ziehvater. Nichts, nichts, nichts, hämmerte es in ihrem Kopf. „Er hat viel von dir gesprochen“, begann sie zögernd, bemüht, die richtigen Worte zu finden.
„Verflucht, was soll das? Du hast ihn doch schon vergessen – tu doch nicht so, als würdest du groß um ihn trauern!“ Jetzt sprach er englisch; fluchen konnte man nur in dieser Sprache, das wusste auch Summer-Rain. Erik rieb sich über das Kinn; er hatte sich erst heute am frühen Morgen rasiert. „Verdammt, verdammt, verdammt!“ Wieder bediente er sich der englischen Sprache. „Deine Leute haben nicht viel mehr gesagt, als dass mein Sohn im Kampf gestorben ist.“ Das Zaumzeug in seinen Fingern hin- und herdrehend, dachte er verärgert an die verunstaltete Mexikanerin, die ihn im Tipi dieser uralten Frau einquartieren wollte. Da hatte er sein Lager lieber hier aufgeschlagen.
Niemand wollte so recht mit der Sprache heraus. Nur dieser Light-Cloud, der hatte sich ausweichend mit ihm unterhalten, war aber nicht näher auf die Umstände von Running-Fox‘ Tod eingegangen. So war er geblieben, um auf das Mädchen, wegen dem sein Sohn überhaupt hierher gekommen war, zu warten. Und genau dieses Mädchen war mit ihrem Ehemann in die Berge geritten. Das hatte ihn so sehr erbost, dass er mit niemandem mehr reden wollte. Jetzt sollte sie ihm endlich eine Antwort geben!
Wieder ins Comanche wechselnd, seine Empfindungen hinunterschluckend, kam er gleich zur Sache: „Ich will wissen, was genau geschehen ist. Dass du dich inzwischen mit einem anderen Mann getröstet hast, geht mich nichts an – so sehr ich dich dafür auch verachte.“
Sie hob eine Hand, wollte ihm Einhalt gebieten, ihn stoppen, sah den Zorn in seinen Augen und senkte sie wieder.
Erik schwitzte vor Erregung, seine Lippen bebten. Am liebsten hätte er ihr seine Verachtung gezeigt, indem er aufstand und einfach wegritt. Aber zuerst musste er wissen, weshalb sein Sohn gestorben war – alle Umstände erfahren. „Also rede schon, Weib!“, forderte er sie auf, den harten Zug um seine Lippen noch verstärkend.
Ich muss es ihm sagen, wurde ihr klar, ob er mir glauben wird oder nicht; ich muss es wenigstens versuchen. Sie schloss die Augen, berührte sie sanft mit Zeigefinger und Daumen, ließ das Bild ihres Bruders vor sich entstehen, beschwor seinen Geist herauf. Es war nicht schwer. Sie konnte dem weißen Mann in ihrer Sprache – nicht in der seinen, die ohne Gefühle war – beschreiben, was für ein wunderbarer Mensch Running-Fox gewesen war. Damit wollte sie beginnen.
Und das tat sie, löste die Finger von ihren Augen und blickte ihn an. Erzählte ihm, wie sie ihn kennengelernt hatte, ihre Versprechen, seine Suche nach ihr. Wie er sie gefunden und ihr damit das Leben gerettet hatte. Sie erzählte vom Sand-Creek-Massaker und wie sie als Kinder voneinander getrennt worden waren und wie sie all das in ihrem tiefsten Innern vergraben hatte. Sie berichtete weiter, wie Running-Fox herausgefunden hatte, wer sie war, wer sie beide tatsächlich waren. Zuletzt erzählte sie ihm von dem Versprechen, sie zu beschützen – damals, als sie mit ihrer Mutter zum Sand Creek aufgebrochen waren und er es doch nicht hatte halten können. Sie erzählte ihm vom Kampf mit Icy-Wind – jede Einzelheit, die tief in ihrem Gedächtnis eingebrannt war. So hatte er doch noch sein Versprechen eingelöst. Ihr Bruder war für sie gestorben, hatte sein Leben für das ihre hergegeben. Doch dafür konnte sie keine Dankbarkeit empfinden – dieser Preis war einfach zu hoch gewesen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hörte er nur zu. Seine Miene blieb starr, und er zeigte keinerlei Regung. Dann endlich begriff er. Entgeistert starrte er sie an, griff nach ihren Fingern, fühlte, dass sie nass von Tränen waren – und kalt, eisig kalt. Er betrachtete sie, als sähe er in ihren Augen die Bilder entstehen – wie sein Junge in all diesen Situationen gehandelt hatte; dann drehte er sich wortlos von ihr weg. Plötzlich bereute er, vorhin so unbeherrscht und grob gewesen zu sein. Er hatte sie angeschrien, ihr böse Dinge unterstellt, ohne die Wahrheit zu kennen. In ihm stieg die Erinnerung wieder hoch. Diese grässlichen Ereignisse, die sich am Sand Creek abgespielt hatten – denn wenn sie auch dort gewesen war, wenn sie als kleines Kind diese Schrecken hatte miterleben müssen, dann war es denkbar, dass sie all das völlig verdrängt hatte. Er kannte den medizinischen Ausdruck dafür nicht, doch er wusste, dass es so etwas gab. Im Krieg hatte er selbst erlebt, wie ein gestandener Mann nach einem Beschuss sein Gedächtnis verloren hatte.
Summer-Rain hockte neben ihm, die Beine untergeschlagen, den Rücken durchgedrückt, regungslos, wartend. Lange Zeit herrschte Stille. Es war eine heilsame Stille – eine Stille, die offene Wunden schließen konnte; beide wussten es. Sie ließen die Sonne über den Himmel wandern; nur der Wind war zu hören und das leise Schnaufen der drei Pferde, die sich dicht aneinanderdrängten.
Das also war Jeremiahs kleine Schwester. Wenn er von ihr gesprochen hatte, dann immer nur mit Vorwürfen gegen sich selbst. Er hatte sie nicht beschützen können, nicht damals, das wusste Erik von ihm – doch an diesem anderen Tag. Als Erik das endlich begriff, liefen ihm Tränen über die Wangen. Wie glücklich musste sein Sohn gewesen sein, die Schuld, die ihn so lange gequält hatte, doch noch zu begleichen. Vorbei, sagte er sich und hätte beinahe laut aufgeschrien. Die Sonne war ein beträchtliches Stück weiter über den Horizont gewandert, da regte sich der weiße Mann endlich. „Wo ist dieser Ort?“, fragte er tonlos mit trockenen Lippen.
Sie wusste, was er meinte, und nickte. Umständlich zog sie einen trockenen Ast aus dem Stapel, der als Feuerholz diente, und wollte es ihm aufmalen. Aber er griff nach ihrer Hand und löste ihn ihr aus den Fingern. „Warte, nimm das hier.“ Aus einer der beiden Satteltaschen, die hinter ihm lagen, kramte er einen Bleistift sowie ein dick eingebundenes Buch hervor. Normalerweise notierte er dort die Anzahl der gekauften oder verkauften Rinder. Er schlug eine leere Seite ganz hinten auf. „Mal es mir hier hinein.“
Summer-Rain nahm den Stift wie selbstverständlich in ihre rechte Hand, obwohl es schon lange her war, dass sie mit so etwas geschrieben hatte. Während sie zu zeichnen begann, betrachtete er sie jetzt zum ersten Mal genauer. Konnte er eine Ähnlichkeit mit Jeremiah erkennen? Nicht wirklich. Ihre Augen sind dunkelblau, stellte er fest, während seine so schwarz wie Kohle gewesen waren. Fasziniert verfolgte er jeden Strich, den sie aus dem Gedächtnis heraus machte. Am Ende sah ihre Zeichnung so aus, als blickte man von oben auf eine Landschaft herunter. Sie schrieb sogar den Namen des Flusses auf, in dessen Nähe sie damals gelagert hatten. Sie schrieb den Namen auf Englisch – aber so, wie die Comanchen ihn aussprachen. Erstaunt sah ihr Erik dabei zu. Das kleine Flüsschen jedoch – dort, wo Running-Fox gestorben war – hatte keinen Namen, nicht, dass sie sich an einen solchen erinnern konnte, aber sie zeichnete ihn aus dem Gedächtnis auf.
Ihr dankbar zulächelnd nahm er ihr das Buch und den Stift aus der Hand. Sie zeigte mit dem Finger auf einen Kreis, in dem sie eine Stelle besonders gekennzeichnet hatte. Neben dem Baum, auf dem ihr Bruder ruhte, zeichnete sie ein Ahornblatt. Sich in die Richtung drehend, wo sich dieser Ort befand, legte sie andächtig die Rechte auf ihr Herz. Dann ließ sie ihre Finger wie einen kleinen Vogel nach dort flattern, hin zu ihrem Bruder Running-Fox. Ihre Geste sagte mehr, als Worte es jemals gekonnt hätten.
„Ich danke dir, Mädchen, Comes-Through-The-Summer-Rain“, kam es leise, während er das Buch zuklappte. Sorgfältig verstaute er es wieder in seiner Satteltasche.
Dabei fiel Summer-Rains Blick auf den Griff der Waffe, die in dem großen Holster an seinem Gürtel steckte. Die andere Satteltasche war offen. Ganz deutlich konnte man darin Munitionsschachteln und ein Bündel Dollarscheine sehen. Er hatte ihren Blick bemerkt. „Ich war auf dem Weg zu einem Rinderzüchter, einige 100 Meilen nordöstlich von hier, da kam ich auf die Idee, dass Jeremiah vielleicht hier sein könnte.“
Jetzt war er an der Reihe, um ihr einiges zu erklären. Seine Stimme hatte einen weichen, angenehmen Klang, wie sie jetzt feststellte – ganz im Gegensatz zu vorhin. Das machte es ihr leichter, Vertrauen zu ihm zu fassen. Er war zwar Running-Fox‘ Ziehvater gewesen, aber mit ihm verband sie nicht das Geringste – sie war noch immer auf Abstand bedacht.
„Der, der von uns gegangen ist“, begann er zögernd, nach Art der Comanchen den Namen eines Toten nicht aussprechend, „hat mir von diesem Land hier erzählt. Er wusste aber nicht, wann oder ob deine Leute überhaupt herkommen würden. Von einem Fort in Wyoming machte er sich auf den Weg, um dich zu suchen. Ich habe ihm einen Mann genannt, den er in Tuckerville zu finden hoffte, um vielleicht etwas über dich zu erfahren. Denn dass sie dich hierher geschickt hatten, war ihm inzwischen klar. Ich bin zurück zu unserer Ranch geritten, in das Windriver-Gebiet. Danach führten mich meine Geschäfte zurück nach Colorado. Da dachte ich, wenn ich schon einmal hier bin, kann ich genauso gut bis nach Tuckerville reiten, um mich dort nach ihm umzusehen und gleichzeitig einen alten Kriegskameraden zu besuchen. Leider waren er und seine Frau nicht da. Man sagte mir, sie wären auf einer Reise nach Boston. Dann erfuhr ich, dass deine Leute hergekommen sind. Da hoffte ich, dass mein Sohn, mein Jeremiah“, konnte er sich doch nicht beherrschen und nannte ihn beim Namen, „dass mein Jeremiah auch hier sein würde. Anders konnte es gar nicht sein.“
Er schwieg jetzt, weil er nicht weiterwusste, denn er hatte sehr wohl die Stimmung in Tuckerville mitbekommen.
Summer-Rain legte sein Schweigen anders aus. Sie dachte, es fiele ihm schwer, über den Zeitpunkt zu sprechen, als er die Nachricht vom Tod Running-Fox‘ erhalten hatte. Erik dagegen überlegte, ob er ihr etwas über die Geschichten, die in der Stadt kursierten, erzählen sollte. Noch darüber nachdenkend hörte er, wie sie leise den englischen Namen seines Sohnes vor sich hin sagte.
Zu ihm aufsehend fragte sie: „Du nanntest ihn – Jeh-reh-mia-ha?“
Es klang völlig anders, als er es jemals ausgesprochen hatte. Es war Comanche, und es ging ihm durch und durch.
„Jeh-reh-mia-ha“, hauchte sie die Laute über ihre Zunge, als zerflössen sie dabei zu Rauch. Noch einmal wiederholte sie: Jeh-reh-mia-ha. Es war, als nehme der Wind jeden einzelnen Buchstaben von ihren Lippen.
Erik lief es eiskalt den Rücken hinunter. Oh nein, tu mir das nicht an, riss er sich zusammen. Die ganze Wucht der Trauer fiel wieder über ihn herein. Ihre Stimme, so voller Gefühl und Hingabe, war kaum zu ertragen. Der Schmerz war zurück, aber anders. Die Augen auf diese junge Frau gerichtet, die diesen geliebten Namen so voller Gefühl aussprach, war ihm, wie wenn sich tief in ihm etwas verschlösse. Als würde die Wunde, die der Tod in ihn gerissen hatte, jetzt aufhören zu bluten und eine Narbe zurücklassen. Mit einem Mal erkannte er, warum Comanchen den Namen ihrer Toten nie mehr leichtfertig laut aussprachen. Kostbare Erinnerungen – die Toten gingen zu den Toten. Eines fernen Tages würde er seinem Sohn in die Ewigkeit hinein folgen.
Summer-Rain betrachtete ihn nachdenklich. „Ich weiß nicht, ob die Namen in der Sprache der Weißen auch etwas zu bedeuten haben“, überlegte sie still vor sich hin und dachte in diesem Moment auch an John Black. Sein Name wurde ihm überhaupt nicht gerecht. „Der Name meines Bruders – er klingt wie der Wind, der den Morgentau auf dem Gras trocknet.“
„Jeh-reh-mia-ha“, versuchte es Erik mit geschlossenen Augen und wusste, dass es stimmte. Das englische Jeremiah hatte nicht diese Bedeutung wie ihr Jeh-reh-mia-ha – niemals, und das war gut so.
Er konnte nur nicken. Dann wiederholte er: „Wind-That-Dries-The-Morning-Dew-On-The-Grass. Wind, der den Morgentau auf dem Gras trocknet“, noch einmal in Comanche. Es war für ihn wie eine Offenbarung. Jeh-reh-mia-ha, mein Sohn, konnte er nur immer wieder denken – mein guter, geliebter, tapferer Sohn. Seine Stimme krächzte, als er jetzt etwas sagen wollte, es nicht richtig herausbekam, sich räusperte, um den Kloß in seinem Hals loszuwerden. Endlich konnte er sprechen. „Meinem Sohn und mir gehört eine Ranch in Wyoming. Ich möchte, dass du seinen Anteil erhältst; komm mit mir, Schwester meines Sohnes!“
„Nein“, kam es sofort hart, laut und deutlich. Wusste er denn nicht, dass sie einen Ehemann hatte, eine Familie, ein Zuhause hier bei ihrem Volk?
Erik schien das tatsächlich vergessen zu haben und war sichtlich enttäuscht. Verstand er denn nicht?
„Nein.“ Noch einmal sprach sie dieses Wort aus, diesmal in einem freundlicheren Ton.
Da fiel es ihm ein. Verdammt, sie ist ja verheiratet. Aber was ist, wenn sich die Stimmung in Tuckerville weiter gegen ihre Leute zuspitzt? Sie würde trotzdem nicht mit ihm kommen. Nie würde sie ihr Volk verlassen.
Summer-Rain betrachtete ihn lächelnd. Dann sagte sie in seine Überlegungen hinein: „Ich wäre mit ihm gegangen, wenn er es verlangt hätte. Doch er hätte mich nie dazu gezwungen.“
Erik starrte sie an. Ihm fielen seine Gedanken wieder ein, während er hier in das Lager geritten war und die ersten Tipis gesichtet hatte. Was der Anblick der Krieger und der Kinder in ihm ausgelöst hatte – die Stimmen, die in Comanche zu ihm herüberschwirrten, das Wiehern und der Anblick ihrer Mustangs. Ihn fröstelte. Da wusste er, sie hatte recht. Jeremiah wäre hiergeblieben, als Running-Fox – hier bei ihrem Volk. War er nicht einer von ihnen geworden? Ein Comanche? So oder so hätte er ins Windriver-Gebiet allein zurückreiten müssen. Jetzt aber mit der Gewissheit, ihn niemals wiedersehen zu können, nie wieder mit ihm reden zu können – niemals wieder. Der Traum von einer gemeinsamen Ranch war zerstoben.
Erik erhob sich, verwirrt von all den Empfindungen, die auf ihn einstürmten. Lange stand er unbeweglich, in seine Gedanken versunken. Zwar blickte er nach Westen, wo die schneebedeckten Berge zu sehen waren, aber er nahm sie nicht wirklich wahr.
Summer-Rain wartete geduldig. Auch sie hatte sich erhoben. Ihre Blicke glitten zu den Pferden, die eng beieinander nur ein paar Schritte weiter grasten.
Endlich drehte er sich wieder zu ihr um, bückte sich nach dem Zaumzeug, das er vorhin achtlos auf den Boden geworfen hatte. „Ich weiß nicht, was kommen wird – niemand weiß das. Ich werde immer einen Platz für dich und deine Familie freihalten – dort, wo mein Junge einen Platz für dich erschaffen wollte. Sein Teil soll dein Teil sein, solange ich lebe und darüber hinaus. Für dich, deine Kinder und die Kinder deiner Kinder.“ Es war ein Versprechen, das er zu halten gedachte.
Als sie nickte, reichte er ihr seine Hand. Sie nahm sie so, dass sich ihre beiden Pulse berührten. Zehn Herzschläge lang standen sie so nah beieinander. Summer-Rain verstand diese Geste als Zeichen ihrer ewigen Verbundenheit.
Erik Machel klärte sie nicht darüber auf, dass der Name Jeremiah Machel in einer Urkunde stand, als Miteigentümer ihrer Ranch. Sie hätte es ja doch nicht verstanden. Es bedurfte langer Diskussionen mit seinem Sohn, bis dieser begriff, was Landbesitz für einen weißen Mann bedeutete, und es schließlich hingenommen. Nach seinen eigenen Vorstellungen konnte kein Land nur einem Einzelnen gehören. Mutter Erde gehörte niemandem. Wem gehörte denn der Wind, der darüberstrich, wem die Vögel in der Luft, wem der Regen und der Sturm oder die Sonne am Morgen und der Mond in der Nacht?
Ihre Hände lösten sich voneinander, da hob er die andere, in der das Zaumzeug war. „Das gehört zu der Appaloosa-Stute, die neben deinem und meinem Pferd grast“, zeigte er, plötzlich lächelnd.
„Meine Mustangs tragen Leder mit schmalen Riemen.“ Zögernd griff sie nach dem Trensengebiss und berührte es mit den Fingerspitzen.
Ein Gefühl der Vorfreude durchflutete ihn, weil er ihr Interesse sah. „Sicher, doch dies hier ist für dein Pferd gedacht.“ Er sah, wie ihr Kopf hochruckte, sah, wie sie auf die Appaloosa-Stute starrte, dann zu ihm. Sein Herz hüpfte vor Freude.
Unglaube machte sich auf ihrem Gesicht breit. Sicher hatte sie ihn nicht richtig verstanden. „Für dieses Pferd?“ Sie deutete auf die Stute.
Erik Machel nickte. Vorhin, während sich ihr Pulsschlag berührte, war sie mehr für ihn geworden als die Schwester seines Sohnes – seines toten Sohnes, verbesserte sie sich und nahm dieses Geschenk von ihm an.
Jetzt ist diese Frau meine Tochter. Diese plötzliche Erkenntnis überrumpelte ihn. Ja, dachte er, ja – ich habe jetzt eine Tochter. Er musste erst einmal tief durchatmen.
Als nächstes pfiff er nach seinen Pferden. Sie hoben die Köpfe, kamen aber sofort zu dem Mann, der seit einiger Zeit Teil ihrer kleinen Herde war. Sichtlich stolz führte er ihr die wunderschöne Appaloosa-Stute zu.
Unschlüssig wog sie die beiden großen Eisenringe, an denen die Zügel befestigt wurden, in der einen Hand, mit der anderen griff sie nach dem Halfter der Stute.
Im selben Moment ließ Erik den Halfter los. „Dieses Pferd gehört dir.“ Mit diesen einfachen Worten trat er einen Schritt zurück, damit sie es gebührend bewundern konnte.
Jetzt war es an ihr, tief durchzuatmen. Schon im nächsten Augenblick erstrahlte ihr Gesicht. Ohne zu zögern griff sie nach dem kleinen, schwarzen Kopf des Pferdes, nahm ihn zwischen ihre Hände und drückte ihr Gesicht gegen die gefleckte Haut des Mauls. Ihr ihren Atem in die Nüstern hauchend, begrüßte sie die Palouse. Sich wieder Erik zuwendend, rief sie voller Freude aus: „Du beschämst mich, Vater meines Bruders. Du beschämst mich umso mehr, da ich kein gebührendes Geschenk für dich habe.“
Aber sie lachte und ging voller Begeisterung um das Pferd herum, betastete die Beine vom Huf bis hoch an die Schenkel, fuhr mit der flachen Hand am Bauch entlang, befühlte die Muskeln, kam vom Kopf über die Ohren wieder zurück, suchte nach der kleinen Kuhle im Widerrist, strich ihr den Rücken entlang bis zur Kruppe.
Erik sah ihr fasziniert dabei zu. Summer-Rain trat zwei Schritte zurück, nahm das Pferd noch einmal in Augenschein; dann bückte sie sich zu dem Zaumzeug, das sie vor ihrer Inspektion auf den Boden gelegt hatte. Vorsichtig, noch ein wenig unsicher, legte sie der Appaloosa das Trensengebiss um. Danach überprüfte sie genau, ob es auch richtig passte. In ihrem Gesicht spiegelten sich Zweifel. Am Ende war sich Erik sicher, dass sie es doch wieder gegen ihr altes aus geflochtenem Leder eintauschen würde, sobald er ihr den Rücken zukehrte. Schon wollte er ihr die Vorzüge aufzeigen, da schwang sie sich bereits auf den Rücken der Appaloosa und ritt einfach davon, in die Ebene hinaus.
Während er ihr fasziniert hinterherblickte, beschloss er, noch eine Zeit lang hier in der Gegend zu bleiben. Der junge Mann fiel ihm ein, dem er vor kurzem im Saloon von Tuckerville begegnet war. Ihm und seinem Partner hatte er versprochen, sie auf ihrer Ranch zu besuchen. Damals lagen die Dinge noch anders. Er wusste, dass er sich der Wirklichkeit stellen musste. Sein Leben ging weiter, machte er sich klar. Hier, in diesem Indianerlager, konnte er nicht mehr bleiben. Zu viel würde ihn an seinen geliebten Sohn erinnern. Jetzt, da er alles wusste, drängte es ihn von hier fort. Alle würden sich weiterhin äußerst rücksichtsvoll und still ihm gegenüber verhalten. Er wusste das, und gerade das hätte er nicht ertragen können. Der Umgang mit Menschen, die sein Leid nicht kannten, würde ihm leichter fallen. Die Ranch in Wyoming konnte noch eine Weile ohne ihn auskommen. Außerdem, sagte er sich, könnte ich auch eine kleine Herde Rinder von den hiesigen Ranchern erwerben; da musste er nicht erst 100 Meilen weiterreiten. Doch seine Zukunft lag nicht hier, seine Zukunft lag im Windriver- Gebiet.
Summer-Rain kam zurück, da hatte er bereits alle Sachen zusammengepackt und war gerade dabei, sein Pferd zu satteln. „Ich denke, ich habe eure Gastfreundschaft schon zur Genüge in Anspruch genommen“, sagte er bestimmt, während sie ihm mit gerunzelter Stirn dabei zusah.
„Es ist ja alles gesagt. Einer der Rancher hier hat mich zu sich eingeladen. Bevor ich wieder zurück nach Wyoming reite, komme ich noch einmal her. Ich habe ja jetzt eine Tochter, von der ich mich verabschieden muss.“ Sich durch die Haare streichend, lächelte er. Summer-Rain gab das Lächeln zurück.
Vom Rücken des Pferdes gleitend, das nun ihr gehörte, stand sie vor ihm, musste zu ihm aufsehen, denn sie reichte ihm gerade mal bis zur Schulter. „Gut“, sagte sie nur, ohne die Absicht ihn umzustimmen. Sie wusste, dass dieser Mann seine Entscheidungen nicht leichtfertig traf. „Wenn du zu dieser hier, die jetzt deine Tochter ist, zurückkommst, wird sie ein Geschenk für dich haben. Nicht so eines wie das hier – natürlich nicht. Doch es soll trotzdem dein Herz erfreuen.“ Sich zu ihm hochreckend, legte sie ihm leicht eine Hand auf die Schulter.
Comes-Through-The-Summer-Rain, ging es ihm durch den Kopf. Und dann: Ich habe eine Tochter. „Comes-Through-The-Summer-Rain“, wiederholte er seine Gedanken, ihre Hand festhaltend, jetzt laut. „Meine Tochter, ich wünsche mir, du kommst einmal zu mir ins Windriver-Gebiet von Wyoming.“ Er erwartete keine Antwort, doch sie überraschte ihn, als sie sagte: „Irgendwann werde ich das tun.“ Und mit einem geheimnisvollen Lächeln: „ Wenn der Wind den Morgentau auf dem Gras trocknet.“ Damit ließ sie ihn stehen, ging, die Appaloosa-Stute am Zügel, von ihm weg. Nach etwa 20 Schritten blieb sie noch einmal stehen, drehte sich zu Erik um, der sich nicht vom Fleck gerührt hatte, so verdutzt war er und rief: „Windracer, das ist der Name dieses prächtigen Pferdes. Die Palouse heißt Windracer. Und diese hier ist jetzt für immer deine Tochter.“
Ihre Worte klangen in ihm wider, prägten sich ihm ein. Immer, wenn er sich diesen Abschied später ins Gedächtnis zurückrief, konnte er sie hören.
Er wartete, bis sie in den Hügeln verschwunden war, saß auf und wendete sein Pferd, da kamen ihm einige der jungen Männer mit Jagdbeute beladen entgegen. Freundlich grüßend zeigten sie ihm stolz die erlegten Tiere. Es gab einen kurzen Wortwechsel – unbekümmert, belanglos. Sie stellten keine Fragen, obwohl es offensichtlich war, dass er ihr Lager verlassen wollte. Niemand rührte auch nur mit einem Wort an sein Leid. Rücksichtsvoll ließen sie ihn ziehen. Es war Comanchenart, die Gefühle des Anderen zu respektieren.
Während er zum Fluss ritt, dann vorbei an den Tipis, nahm er die Atmosphäre dieses friedlichen Lagers tief in sich auf. Kam vorbei an spielenden Kindern, an Frauen, die in ihrer Arbeit innehielten, um ihm freundlich zuzunicken, an alten Männern, die vor ihren Tipis saßen – es war beinahe so wie bei seinem Herritt. Aber nur beinahe, denn damals war seine Welt noch in Ordnung gewesen.
Doch Summer-Rain kannte nicht die ganze Wahrheit. Zwar hatte er sich auf den Weg gemacht, um die Appaloosa-Stute von den Nez Percé zu erwerben, war deshalb sogar bis nach Utah geritten, wo jemand lebte, der noch welche besaß, wie er wusste. Nach Colorado jedoch war er nicht nur wegen Jeremiah geritten. Erik Machel war drauf und dran gewesen, in den Stand der Ehe zu treten. Vor drei Jahren, bei einer Viehauktion in Denver, hatte er Claire Fairchild kennengelernt, die auf einer Ranch etwa 100 Meilen südlich von Denver lebte. Bei dem anschließenden Ball der reichsten Rinderzüchter der Gegend hatten sie die ganze Nacht miteinander getanzt, obwohl er gar kein guter Tänzer war.
Ein Jahr später waren sie verlobt. Im Gegensatz zu ihm hätte Claire kein Problem damit gehabt, ihm auf die unfertige, noch im Aufbau befindliche Ranch nach Wyoming zu folgen. Weil er wusste, in welchem Wohlstand sie mit ihren Eltern und drei Brüdern lebte, litt er das jedoch nicht. Erst wollte er ihr etwas bieten können, zumindest ein fertiges Haus. Dann war ein Brief von ihr gekommen, in dem sie ihm mitteilte, dass ihr Vater und einer ihrer Brüder bei einer Schießerei ums Leben gekommen waren. Es stellte sich auch noch heraus, dass ihr Vater sich verspekuliert hatte und sie ihr gesamtes Vermögen verloren hatten. Worum es bei der Schießerei gegangen war, erfuhr er nicht, aber er vermutete, dass es mit irgendwelchen zwielichtigen Geschäften zusammenhing. Natürlich musste er Claire da rausholen; sie durfte nicht in Gefahr geraten. Also beschloss er, eher als geplant loszureiten, stellte einen Mann ein, der sich in der Zwischenzeit um die Ranch kümmern sollte, und ritt zuerst nach Utah. Dann, mit dem Hochzeitsgeschenk für die zukünftige Frau seines Sohnes im Schlepp – außerdem diente die zähe Appaloosa-Stute ihm unterwegs als Ersatzpferd – machte er sich auf den Weg nach Tuckerville. Sollte er seinen Sohn dort nicht antreffen, würde er mit Claire nach Wyoming zurückreiten und dort auf ihn warten. Ihr hatte er telegrafiert und außerdem noch Geld geschickt; sie sollte ihn spätestens Ende des Jahres erwarten. Jetzt kam ihm das wie eine Fügung des Schicksals vor. Alles hatte sich irgendwie ergeben, wenn auch nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Auf dem Weg zurück nach Wyoming würde Claire bei ihm sein – wenigstens das.
Jeremiah – er hatte sich noch immer nicht an den Gedanken gewöhnt, dass er nie mehr neben ihm reiten sollte. Es war schwer, damit fertigzuwerden. In Gedanken bei ihm, ritt er durch ein kleines Tal, vorbei an einem Bergmassiv, nach Westen und erinnerte sich an all die Zeit, die sie gemeinsam verbringen durften, war dankbar, ihn gekannt zu haben, ihm ein Zuhause hatte geben können. Er war so reich von ihm beschenkt worden, dass ihm das Herz jetzt überquoll.
Summer-Rain ritt nachdenklich zurück. Das also war Erik Machel, der weiße Vater ihres Bruders.
Wind-That-Dries-The-Morning-Dew-On-The-Grass – wie passend. Running-Fox hätte es mit diesem Mann nicht besser treffen können. Jeh-reh-mia-ha hauchte sie in den Wind, schloss die Augen und beschwor sein Bild wieder herauf. Ja, Wind-That-Dries-The-Morning-Dew-On-The-Grass. Er hat gut auf dich aufgepasst, mein Bruder, als du es am Nötigsten brauchtest – und du auf mich, auf deine kleine Schwester. Einen Augenblick lang überkam sie wieder tiefe Trauer. Den Hals der Appaloosa-Stute – Windracer – tätschelnd beugte sie sich zu ihr hinunter. Ihre Mähne war nicht lang, genau wie ihr Schweif. Am Abend würde sie dort keine Kletten oder Blätter finden – wie sonst bei ihren anderen Pferden, die sie ritt. Sie ließ das Pferd in verschiedenen Gangarten laufen. Der weiße Mann konnte sie in der kurzen Zeit noch nicht allzu sehr verdorben haben. Aber was diese Art von Gebiss anging, war sie sich nicht sicher, ob sie das beibehalten würde. Ihrer Gescheckten legte sie immer einen geflochtenen Lederriemen über die Zunge und verschnürte ihn unter dem Kinn. Von dort ging ein einzelner Zügel nach links über den Hals des Tieres. Doppelt gedrehte, vernietete Kriegszäumung wie die Männer, verwendete sie nicht.
Sich zu Windracer herunterbeugend tätschelte sie der Stute den Hals. Er ist jetzt auch mein Vater, dieser Erik Machel, dachte sie überrascht. Nachdenklich strich sie über die wie hingekleckste gescheckte Zeichnung der Appaloosa. Wenn Comanchen Pferde züchteten, dann achteten sie weniger auf die Farbe oder die Zeichnung ihres Fells. Bei ihnen kam es hauptsächlich auf andere Dinge an: auf Schnelligkeit,
Trittsicherheit, Verlässlichkeit. Für sie musste ein Pferd willig sein, das zu lernen, wovon ihr Leben abhängen konnte – im Krieg, bei der Jagd, auf der Wanderung. Je nachdem, wofür sie sie ausbildeten. Comanchen gingen mit ihren Mustangs eine lebenslange Verbindung ein. Für sie waren sie ebenbürtige Lebewesen. Wie alles Leben mit ihnen verwandt war, so waren es auch die Pferde. Sie lebten mit ihnen, und sie starben mit ihnen; so war es schon immer gewesen. Ohne ihre Mustangs konnten sie sich ihr Dasein nicht vorstellen. Wenn sämtliche Geräusche im Lager verstummten, hörten sie immer noch die große Herde oder die Pferde, die vor ihren Tipis grasten. Für sie waren sie wie die Luft, die sie zum Atmen brauchten.
Summer-Rain ritt auf die sich nach Osten hinziehenden Hügel zu; Whirl folgte ihr, seit sie aufgebrochen war, wie ein Schatten. Der Wind zauste ihr das Haar, während sie wild die nächste Graswelle hinunterritt und auf der anderen Seite wieder heraufkam. Ich muss ein Geschenk für diesen Mann finden – diesen wunderbaren Menschen, der meinen Bruder beschützt, ihm ein Leben in Frieden ermöglicht und ihm all seine Liebe gegeben hat. Dieser Gedanke ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Es sollte bereitliegen, wenn er wiederkäme, das gehörte sich einfach so.
Die Appaloosa-Stute hatte bereits seit der Ankunft des Weißen die Aufmerksamkeit ihrer Leute erregt. Jetzt, als ihr zufällig einige der Krieger begegneten, waren sie erstaunt, sie darauf zu sehen, hüteten sich jedoch, neugierige Fragen zu stellen. Natürlich wollten sie sich spontan ein Wettrennen mit ihr liefern, was Summer-Rain jedoch nicht zuließ. Stattdessen übergab sie Whirl einem der Männer, der sie zur Herde bringen sollte.
Sie musste zurück, musste Storm-Rider finden, um ihm Windracer zu zeigen und ihr neues Zuhause.
Wie sich herausstellte, suchte Light-Cloud sie bereits seit einiger Zeit. Er tauchte auf einem seiner besten Mustangs auf, bevor sie Großmutters Tipi erreichen oder ihren Mann finden konnte. Unwillkürlich veränderte sich seine Haltung. Sein Körper straffte sich, er blickte ihr entgegen, wie sie auf der Appaloosa-Stute auf ihn zukam. In seinem Gesicht standen Staunen, Zweifel – beides gleichzeitig; das Überraschungsmoment war ganz auf ihrer Seite. Einige Herzschläge lang war er völlig sprachlos. Er und Erik Machel hatten des Öfteren zusammengesessen und sich ausgiebig über Pferde unterhalten, alles andere hatte er nicht zugelassen. Nur über Pferde, über die Jagd und manchmal auch über die Vorzüge verschiedener Methoden, das Fell einer Bergkatze zu gerben. Natürlich kannte er die Appaloosa-Stute inzwischen. Seine kleine Schwester jetzt auf ihrem Rücken zu sehen, überraschte ihn jedoch. Als sie ihm dann auch noch sagte, dass dieses Pferd ein Geschenk für sie war, konnte er nur den Kopf schütteln. Gleich danach wurde sein Gesicht wieder ernst. „Und ich dachte, ich hätte eine Überraschung für dich, kleine Schwester“, waren seine nächsten Worte, während er dabei den Hals der Appaloosa tätschelte. „Jetzt wird es meine Überraschung schwer haben, gegen diese hier zu bestehen. Was meint denn dein Ehemann dazu, dass du dich von einem anderen Mann beschenken lässt?“
Schwang da etwa ein leiser Vorwurf mit? Summer-Rain runzelte die Stirn, ließ sich aber nicht einschüchtern.
„Er weiß es also noch nicht“, stellte er unumwunden fest. „Na, dann solltest du dich beeilen, es ihm zu sagen, bevor es jemand anderes tut.“
Light-Cloud wollte sich nicht einmal Ansatzweise vorstellen, was es für Storm-Rider bedeutete, nicht aus ihrem Mund von diesem wertvollen Geschenk zu erfahren. Über sein ebenmäßiges, etwas verwittert aussehendes Gesicht legte sich ein Schatten. „Du bist jetzt eine verheiratete Frau, Summer-Rain“, mahnte er. „Benimm dich auch so!“
Seufzend hob sie die Schultern. Sie wollte keinen Streit, schon gar nicht mit Storm-Rider. Den würde sie unweigerlich bekommen, wenn sie es ihm nicht so schnell wie möglich erklärte. „Dieses Geschenk ist kein Geschenk an mich als Frau“, versuchte sie es ihm etwas kleinlaut zu erklären. „Es ist – nun ja, es ist kompliziert“, sprach sie das letzte Wort englisch aus.
Light-Cloud zog die Stirn in Falten, fragte aber nicht, sondern sagte nur: „Mach was du willst, Summer-Rain, ich will mich da nicht einmischen – doch mach es bald.“
Er hatte ja so recht. Kurz überlegte sie, mit ihm darüber zu sprechen, ihm alles zu erklären; dann aber beschloss sie, dass ihr Ehemann jetzt an erster Stelle kam. Da fiel ihr ein, dass Light-Cloud ja von einer Überraschung gesprochen hatte. „Verrat mir deine Überraschung“, drängte sie ihn. „Danach suche ich nach Storm-Rider.“
Inzwischen ritten sie den Fluss entlang. Ihr neues Zuhause war nur noch eine Biegung weit entfernt, als jemand seitlich aus dem Gebüsch kam. Light-Cloud und Summer-Rain fuhren herum.
„Ich habe dich vermisst, Summer-Rain, doch wie ich sehe, reitest du auf einem Pferd, das nicht aus meiner Herde ist.“ Storm-Rider.
Trotzig schob sie die Unterlippe vor. Light-Cloud, der diesen Gesichtsausdruck seiner Schwester bestens kannte, ließ sein Pferd zur Seite treten.
„Du kannst ruhig wissen, was ich zu sagen habe, Storm-Rider“, fauchte Summer-Rain. „Diese Palouse hier ist ein Geschenk des weißen Mannes, der in unser Lager gekommen ist, während wir in den Bergen waren. Und wenn ihr beide jetzt aufhört, mich wie ein unartiges Kind zu behandeln, dann erzähle ich euch alles.“
Stille. Beide Männer schauten einander an. „Ich behandle dich nicht wie ein unartiges Kind, Comes-Through-The-Summer Rain“, sagte Storm-Rider etwas heftiger als beabsichtigt. „Doch ich denke, dass meine Ehefrau mich zuerst fragen sollte, bevor sie von jemand anderem ein solches Geschenk annehmen darf.“
„Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich immer erst deine Zustimmung einhole“, schnappte sie, vom Rücken der Appaloosa gleitend.
Light-Cloud duckte sich ab. Das ging ja gut los, dachte er. Doch Storm-Rider reagierte anders, als erwartet. Er grinste. Dann, ebenfalls absteigend, murmelte er vor sich hin – jedoch laut genug, dass man es verstehen konnte: „Meine Mutter hatte mich ja vor dir gewarnt, Summer-Rain. Leider wollte ich nicht auf sie hören; das habe ich nun davon.“
Zu ihm tretend, den Zügel der Appaloosa um ihren Ellbogen wickelnd, kam es leise von ihr: „Und – bereust du es schon?“
Breit grinsend betrachtete er sie von oben bis unten, dann nickte er. Was auch immer das bedeuten sollte, Summer-Rain jedenfalls nahm es als ein Nein.
Light-Cloud schüttelte den Kopf.
„Setzt euch“, befahl ihnen Summer-Rain kurz und knapp. „Diese hier wird euch erzählen, was sie von dem weißen Mann, der Erik Machel heißt, weiß. Ich erzähle es nur einmal. Also unterbrecht mich nicht, und bewahrt meine Worte in euren Herzen. Noch jemand ist jetzt hier bei uns, denn es ist auch seine Geschichte.“
Nur die Geräusche der Pferde in ihrer Nähe waren zu hören, während ihnen Summer-Rain von dem Treffen mit Erik Machel berichtete. Er hatte wie ein guter Vater an ihrem Bruder gehandelt, so viel stand fest. Diese Palouse sollte ihr Hochzeitsgeschenk werden, das Geschenk eines Schwiegervaters an seine neue Tochter. Und deshalb brauchte sie auch nicht Storm-Riders Einwilligung, behauptete sie trotzig. Der war zwar anderer Meinung, sagte es aber nicht: Pferde waren Männersache.
Light-Cloud, den das Verhalten seines Schwagers überraschte, wandte sich endlich an ihn: „Ich habe eine Überraschung für Summer-Rain, doch überlasse ich dir, Storm-Rider, die Entscheidung darüber. Dafür aber müssten wir eine Strecke weit reiten.“
„Wenn du keinen Ärger mit mir bekommen willst“, rief Storm-Rider und lachte, „dann machen wir das so, Schwager.“
Light-Cloud nickte mit ernster Miene. In die Richtung zeigend, die sie nehmen mussten, saß er auf.
Summer-Rain wollte schon auf die Palouse steigen, als Light-Cloud ihre Hand festhielt. Mit gerunzelter Stirn deutete er auf das Trensengebiss. „Der weiße Mann hat ihn an das Zaumzeug mit den Ringen gewöhnt. Das gefällt mir nicht. Kriegszäumung kennt die Stute sicher auch nicht.“ Er warf einen fragenden Blick auf Storm-Rider.
Der wiegte nachdenklich den Kopf, dann sagte er bedächtig: „Du reitest die Stute auch mit zwei Zügeln, wie ich sehe – deine Gescheckte dagegen mit nur einem. Sicher ist die Palouse das gewohnt, wenn ein Weißer sie hierher gebracht hat.“
Summer-Rain betrachtete die Zügel. „Ich bin schon oft so geritten, und Windracer hier kennt es sicher auch nicht anders. Ich behalte das bei, sonst verwirre ich sie nur.“ Ihr trotziger Tonfall ließ keinen Zweifel über ihre Absicht. „Und Kriegszäumung bei einer Stute? Das meint ihr nicht ernst!“, setzte sie hinzu, den Kopf über die Männer schüttelnd.
Nein, bei dieser Palouse wollte sie sich nicht hineinreden lassen. Das Pferd gehörte jetzt ihr und sie würde es so reiten, wie sie es für richtig hielt. Die doppelt gedrehte und vernietete Kriegszäumung, wie sie die Männer bei ihren Mustangs meist benutzten, erschien ihr dem Zaumzeug von Erik Machel ebenbürtig zu sein. Mit nur einem Zügel würde die Stute sicher nicht klarkommen. Sie verstand nicht, was die Männer auszusetzen hatten. Zuerst war sie ja noch skeptisch gewesen, aber jetzt, wo sie es ausprobiert hatte, war sie zufrieden. Ohne die beiden Männer weiter zu beachten, hievte sie sich wieder auf den Rücken der Appaloosa.
Storm-Rider ließ Summer-Wind dicht neben ihr laufen. Er sagte nichts mehr zu ihr. Im Gegensatz zu ihm jedoch missfiel Light-Cloud ihre Entscheidung. Doch solange ihr Ehemann damit einverstanden war, musste er ihre Entscheidung hinnehmen. Unwillig murmelte er etwas vor sich hin, was die beiden nicht verstanden – es war auch besser so. Sich an die Spitze des kleinen Zuges setzend, schwang Light-Cloud eine kurze Peitsche, die die Comanchen nur symbolisch benutzten. Sie war mehr für einen kleinen Tatsch auf den Hintern geeignet, als ein Züchtungsmittel, wie die Weißen ihre Peitschen benutzten. Light-Cloud drehte sich nach seiner Schwester um. Hätte er mehr als acht Pferde für sie fordern sollen? Gewiss wäre dieser verrückte Mann vor lauter Verliebtheit bereit gewesen, mehr für sie zu bezahlen. Laut einen Schrei ausstoßend, stürmte er ihnen davon. Windracer zeigte, was in ihm steckte, und führte sogar kurz. Dann änderte sich das rasch. Die kleine Stute hielt dem Tempo, das Storm-Riders Summer-Wind vorlegte, nicht lange stand. Sie gab ihr Bestes, dennoch fiel sie hinter die beiden anderen Pferde zurück. Doch die Zähigkeit und Verbissenheit, mit der das Tier um das Mithalten kämpfte, war schon beeindruckend. Storm-Rider ließ Summer-Wind langsamer laufen, denn nur Light-Cloud wusste, wohin sie mussten. Die ersten Ausläufer einer Bergkette erreichend, kamen sie in ein Tal; da verlangsamte Light-Cloud das Tempo. So ritten sie an einem wild dahinschießenden Bach entlang bergauf, schlängelten sich an terrassenförmigen Felsplatten vorbei, die links und rechts von Kiefern und Erlen gesäumt wurden, bis sie schließlich ihr Ziel erreichten.