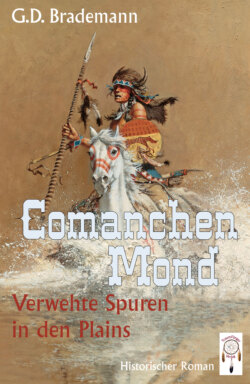Читать книгу Comanchen Mond Band 3 - G. D. Brademann - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel
ОглавлениеDer Indianersommer mit seiner überwältigenden Farbenpracht beherrschte die Welt. Es war Ende September – oder, wie die Indianer diese Zeit nannten: Blättermond. Die Morgensonne auf den Gipfeln der schneebedeckten Berge verwandelte das Land davor. Unwirklich, fast überirdisch, wie mit Blut übergossen fielen die Felsformationen beinahe senkrecht in ein breit gefächertes, riesig großes Tal ab, etwa 100 Meilen vom Lager der Antilopen entfernt. Weiter den Fluss hinunter, der in diesen blutroten Bergen entsprang, bis hinter einen Canyon und in einem flachen kleinen Tal, zwischen Hügeln und Prärie, dort hatten sie sich inzwischen gut eingerichtet. Hier, wo sie für einige Zeit ihre neue Heimat zu finden hofften, leuchteten die Blätter der Bäume, die die Flussebene säumten, in allen Gelb- und Rottönen, die man sich nur vorstellen konnte. Gräser, deren Rispen sich entfalteten, bogen sich im Morgennebel feucht auf den Boden, schwer vom Samen. Kleine Erdhügel, von Maulwürfen aufgebrochen, bedeckten die Ebene vor dem urwaldähnlichen Dickicht, das bis an eine Uferböschung heranreichte.
Die riesige Pferdeherde bewegte sich schwarmartig hinter den Hügeln im Osten, immer auf der Suche nach Gras. Ein kleiner Fluss, irgendwo aus den Bergen kommend, versorgte sie mit Wasser. Von der Prärie im Südosten ritten Männer dem Lager entgegen. Ihre Mustangs waren mit Jagdbeute beladen. Vorräte füllten allmählich die Tipis, trocknendes Fleisch hing schwer von den Gestellen herunter, Felle stapelten sich, bereit für den Winter. Was nicht unbedingt benötigt wurde, wollten sie als Ware für Dinge, die nur die Weißen herzustellen verstanden, eintauschen.
Die Tuckerviller Bürger schickten regelmäßig – nach Absprache mit Old-Antelope – ihre Händler bis zu ihnen. Manchmal kamen sogar einfach nur neugierige Weiße, die sich am dem Fluss gegenüber liegenden Wall einfanden. Zögernd wurden erste Kontakte geknüpft, ja, wechselte sogar das eine oder andere Tauschobjekt den Besitzer. So war es jedenfalls noch bis vor einer Handvoll Sonnenaufgängen gewesen. Inzwischen blieben jedoch mehr und mehr Tuckerviller diesen Treffen fern. Vereinzelte Begegnungen mit den Ranchern, die ihre Rinder auf Comanchenland bis zu den Ausläufern der Berge außerhalb ihrer eigenen Grenzen weiden ließen, liefen jetzt auf einmal auch in einer etwas angespannteren Atmosphäre ab. Meistens grüßte man sich nur aus der Ferne, um dann wieder jeder seiner Wege zu reiten. Man arrangierte sich eben. Dieser Zustand wurde allmählich zur Gewohnheit. Die Comanchen respektierten den Frieden, indem sie nicht ein einziges Stück Vieh antasteten – ja, sie ließen sogar die Pferde der Rancher ungeschoren, obwohl es so manchen von ihnen in den Fingern juckte. Bei unerwarteten Begegnungen wusste manch ein Weißer plötzlich nicht recht, wie er sich verhalten sollte. Das alles passierte aber erst, nachdem Pete Hartfield versuchte, die Rancher und Farmer gegen die Comanchen aufzuhetzen. Noch taten die meisten seine Reden als Übertreibungen ab oder nahmen ihn einfach nicht ernst. Doch schon gab es Anhänger, die seine Thesen verteidigten. Die Zukunft würde zeigen, was man von den neuen Nachbarn zu halten hatte – drohten die einen, während die anderen an einen dauerhaften Frieden glaubten.
Während also Pete Hartfield seinen Plan weiter vorantrieb, verharmlosten andere das, was er von sich gab, und legten dem keine Bedeutung bei. Manch einer meinte sogar, dieses Geschwätz würde niemanden lange beschäftigen.
Doch die Geschichten, die aus Texas bis nach hier drangen, spielten dem verbitterten Farmer in die Hände. Da gab es Zeitungen, die in Denver erschienen und die durch die Postkutsche bis hierher gelangten. Dort standen Berichte von Gräueltaten an der weißen Bevölkerung und vielen Todesopfern. So prüde man auch in dieser Zeit noch war – Andeutungen genügten und regten die Fantasie der Leser oftmals mehr an als ausführliche Beschreibungen. Von Vergewaltigung und Verschleppung weißer Frauen und Kinder war die Rede, von zerstörten Ranches und Farmen, von schrecklich zugerichteten Leichen. Wären es tote, massakrierte Indianer gewesen, niemand hätte sich darum geschert. Jedoch ein einziger toter Weißer oder gar eine tote weiße Frau – so etwas konnte niemand einfach so hinnehmen. Wie diese Zeitungen berichteten, machten in diesem Jahr die Quahari-Comanchen unter ihrem Anführer Quanah besonders von sich hören. Sie hätten Tausende Meilen Telegrafenleitungen vernichtet, hieß es unter anderem, Poststationen zerstört, die Inhaber bestialisch abgeschlachtet – und die Überfälle auf Postkutschen würden auch weiterhin kein Ende nehmen. Es stimmte nicht alles, was dort stand, aber das Letztere im Wesentlichen schon. 1872 war für beide Seiten, – Weiße und Indianer – ein schlimmes Jahr. Noch immer behaupteten sich die frei lebenden Quahari gegen das Vordringen der Zivilisation. Unterdessen wurden Eisenbahnlinien weiter nach Westen verlegt, somit die Wanderwege der Büffel abgeriegelt und ihre Ausbreitung nach Süden verhindert. Weiße Jäger schossen sie zu Tausenden ab – genau dort, wo es ihnen eigentlich durch die Verträge mit den Indianern verboten war. Es kümmerte niemanden. Die Comanchen, die sich wehrten, ihr Land nicht aufgaben, einfach nur ihr Leben führen wollten, wurden gnadenlos niedergemacht; darüber verloren die Zeitungen kein einziges Wort. Sie berichteten nur darüber, wie sehr die Texaner unter den Comanchen zu leiden hätten. Kein Mensch in Texas wollte etwas darüber lesen, wie sehr die Indianer unter den Texanern – und nicht nur unter diesen – litten.
In Tuckerville lagen diese Zeitungen überall für jeden zugänglich in Saloons oder in den Geschäften aus. Wer sie besorgte und verteilte, ließ sich nur vermuten. Allmählich schlug die Stimmung um. Plötzlich wurden diejenigen, die bisher als Fürsprecher der hiesigen Comanchen galten, schief angesehen. Die Atmosphäre war seltsam angespannt. Massenhysterie ist ein seltsames Phänomen und wie eine Seuche. Sie konnte auf eine Gruppe von Menschen übergreifen, die sich aus völlig harmlosem Grund zusammengetan hatten und in Panik enden. Dafür brauchte es nicht viel. Einige willkürlich ausgestreute Lügengeschichten, Mutmaßungen, die jeder Grundlage entbehrten, Behauptungen, die die Masse begeisterten – und sie glaubten es nur zu gern. Eine so einmal gefasste Meinung war schwer zu widerlegen, falls überhaupt. Die Fanatiker, die sie verbreiteten, waren für die Wahrheit taub. Mit einem wie ihnen konnte man nicht reden – das war nicht nur damals so.
Und diese menschenverachtenden Monster beherrschten allmählich die Stadt und ihre Umgebung. Die von ihnen angefachte Welle der Angst schwappte über Tuckerville zusammen. Der Stolz auf die Erneuerung des Friedens mit den Comanchen, das Gefühl, das Richtige getan zu haben, die Vorteile, die der beiderseitige Handel mit sich brachte – all das trat allmählich in den Hintergrund; davon redete kaum noch jemand. Denen, die es dennoch taten, wurde ein schlechtes Gewissen eingeredet, bis sie endlich kleinlaut schwiegen. Auf keinen Fall wollten sie Außenseiter sein, sich von ihren Nachbarn schief ansehen lassen oder gar erleben, wie ihre Kinder von den Spielgefährten wegen ihrer Eltern verlacht oder sogar ausgegrenzt wurden. Pete Hartfield hielt endlich seine Stunde für gekommen und schürte mit seinen Anhängern weiter Unfrieden mit dem letzten vernünftigen Rest der Bürger. Es brauchte dafür nicht mehr viel. Jeder, der noch immer meinte, dass der Frieden mit den Comanchen halten würde, fand sich nun bestenfalls einer stummen Mauer des Schweigens gegenüber – wenn nicht gar der Feindschaft. Diese letzten Vernünftigen wurden unsicher. Eine Hetzkampagne gegen diejenigen, die noch laut für die Indianer Partei ergriffen, machte sie endlich mundtot; sie wagten es nicht mehr, sich öffentlich zu äußern. Erneute grauenhafte Berichte in den Zeitungen kamen den Verfechtern einer harten Linie gerade recht. Ja, es kam sogar vor, dass sich im Saloon plötzlich jemand auf einen Stuhl stellte, um laut daraus vorzulesen – nur, um die, die dazu selbst nicht imstande waren, aufzuklären. Hinter diesen Aktionen steckte neben Pete Hartfield auch Frank Hamilton – ohne dass dies dem Farmer bewusst wurde; er hatte schon längst den Überblick über seine Unterstützer verloren. Der Vater von Antonia Harper hatte plötzlich Interesse daran gezeigt, was dieser Pete Hartfield da trieb. Dabei ging es ihm nicht einmal um die Comanchen, es ging ihm nur um dieses Land. Seinen Informationen zufolge würde in absehbarer Zeit genau dort hindurch eine neue Eisenbahnlinie führen. Wenn man dieses Land besaß, war es mehr wert, als ein Farmer oder Rancher jemals dafür bezahlen könnte. In aller Eile hatte sich der wieder einmal fast bankrotte Frank Hamilton durch die Aussicht auf ein lukratives Geschäft mit Bob Marcen zusammengetan. Ihre Beziehungen reichten weiter als die eines Mannes wie Pete Hartfield. Es war ihnen gelungen, Landkäufe zu tätigen, völlig legal und ohne diesen Vermerk in den Akten im Liegenschaftsamt von Denver beachten zu müssen, denn auf einmal war dieser wie von Zauberhand verschwunden. So gesehen hatten sie ebenfalls ein Interesse am Verschwinden der Comanchen.
Die Saat ging auf. Einzelne Menschen waren nicht leicht zu beeinflussen, aber wenn sie in Massen auftraten, dann schon. Das, wovon jetzt so viele überzeugt waren, konnte doch nicht falsch sein.
Und so änderte sich das Bild von den vor ihrer Nase siedelnden Indianern in den Köpfen der Tuckerviller.
Nichtsdestotrotz gab es immer noch genug Gegenargumente von Menschen, die nüchtern dachten und die für die Massenhysterie nicht empfänglich waren. Menschen, für die nur Tatsachen zählten. Solange man das alles kühl und sachlich mit einem gewissen Abstand betrachten konnte, siegte noch die Vernunft. Nun jedoch stand der angebliche Feind bereits in der Tür. Unsicherheit machte sich auch unter ihnen breit. Die Händler, die zu den Comanchen hinausfuhren, wurden weniger. Die, die immer noch kamen, erlebten vor Ort hautnah die Freundlichkeit, mit denen man sie behandelte. Sie konnten nur die Köpfe schütteln, wenn sie hörten, wie man über sie sprach. Vielleicht wäre das alles sogar irgendwann im Sande verlaufen und wieder so wie am Anfang geworden, denn die Wochen vergingen, und nichts von dem, was ein Pete Hartfield und seine Anhänger prophezeiten, ereignete sich. Der Tauschhandel ging ohne Zwischenfälle weiter, Rancher ritten ungeschoren bis weit ins Comanchenland hinein, auf der Suche nach ihren Rindern. Kein einziges ging durch die Comanchen verloren, kein einziges Pferd verschwand durch sie aus den Pferchen der Farmer und Rancher. Einige dieser besonnenen Männer waren es dann auch, die sich bei ihren Besuchen in der Stadt für die Comanchen einsetzten. Zu diesem Zeitpunkt jedoch hörte ihnen schon kaum jemand mehr zu.
Pete Hartfield stieß bei einem seiner Abende, die er jetzt häufiger als sonst im Saloon verbrachte, auf Slim Western und Buffalo-Man. Sie hörten sich seine Hasstiraden eine ganze Weile mit an, bis ihnen der Kragen platzte und sich beide in die Diskussionen einmischten. Während noch heftige Reden geführt wurden und Slim kein gutes Wort für Pete Hartfield erübrigen konnte, kam Erik Machel herein. Er war gerade bei einem Rancher gewesen, von dem er zwei Stiere kaufen wollte, und hatte eigentlich vorgehabt, danach Slim Western aufzusuchen. Als er ihn hier inmitten der randalierenden, grölenden Menge mit seinem schwarzen Kompagnon entdeckte, setzte er sich zu ihnen an den Tisch. Ruhig hörte er sich das, was Pete Hartfield zu sagen hatte, eine ganze Weile mit an. Er konnte nicht begreifen, dass es so viel Dummheit auf einem Haufen geben konnte. Denn Pete Hartfields primitive Argumente fanden eher Gehör als die auf Tatsachen begründeten Ansichten von Slim und einigen der anwesenden Rancher. ‚Warum rege ich mich überhaupt darüber auf?‘, fragte sich Erik unwillkürlich. Es gab immer Menschen, die zum Nachdenken nicht ihren Kopf benutzten, sondern ihren Arsch, denen die Wahrheit einen Scheiß bedeutete, die sie so weit verdrehten, bis nichts mehr davon übrig blieb.
Die Bedrohung durch die Comanchen war immer gegenwärtig gewesen, solange die Westgrenze von Texas nicht gesichert war. Diese Tatsache konnte selbst er nicht leugnen. Die Ursachen dafür waren vielfältig, darüber ließ sich nicht streiten. Jetzt und hier jedoch war eine völlig neue Situation entstanden. Endlich wäre es möglich gewesen, den Frieden aufrechtzuerhalten und ein Miteinander zu beginnen. Sie alle hier, jeder Einzelne von ihnen, hatte etwas zu geben und konnte dafür so viel bekommen; man musste es nur wollen. Als die Diskussionen ins Uferlose ausarteten, die Schrecken der Überfälle der vergangenen Jahre an der texanischen Grenze zum Hauptargument wurden, man immer wieder auf Einzelheiten der Gräueltaten zu sprechen kam, ging es nur noch darum, alle Schuld den Comanchen zuzuweisen. Von den Unverbesserlichen wollte keiner etwas davon wissen, dass man diese Situation nicht mit der hier vergleichen konnte. Erik Machel fragte die, die am hitzigsten gegen die Indianer wetterten, was sie selbst wohl tun würden, wenn man ihnen ihr Land wegnehmen würde, um sie dann in eine Einöde von Reservation zu zwingen. Er wusste, wovon er sprach. Wie es dort zuging, versuchte er ihnen begreiflich zu machen, aber er erntete nur ungläubiges Kopfschütteln oder wurde niedergeschrien. Sie glaubten ihm nicht oder waren der Meinung, dass diese Wilden dort viel zu gut wegkommen würden – und die Stimmung heizte sich noch mehr auf.
Als es Erik, Slim, Buffalo-Man und einer Handvoll derjeniger, die ebenfalls ihrer Meinung waren, endlich satt hatten, gegen den immer aufgebrachteren Haufen betrunkener, fanatischer Männer anzugehen, verließen sie gemeinsam den Saloon. Slim und Buffalo-Man banden ihre Pferde los und ritten mit Erik, eine Staubwolke hinter sich lassend, aus Tuckerville hinaus auf ihre Ranch. Es gab zwar noch immer kein fertiges Haus, sondern nur dieses große Zelt mit einem aus Planen gefertigten Küchenanbau, doch einige Scheunen und Stallungen waren bereits vorhanden. Erik besah sich die Männer, die von Slim erst vor kurzem eingestellt worden waren. Sechs von ihnen kamen aus den einfachen Hütten vor Tuckerville, wo sich Schwarze niedergelassen hatten. Männer und Frauen hausten dort mit ihren Familien – Überbleibsel aus der Sklaverei, noch immer auf der Suche nach einem geregelten Einkommen und einem sicheren Zuhause. Unter ihnen hatte sich ein guter Schmied befunden, den Slim sogleich für sich rekrutierte. Dadurch machte er unabsichtlich einem in Tuckerville ansässigen Weißen Konkurrenz. Inzwischen kochte auch Buffalo-Man nicht mehr selbst. Von den sechs neu eingestellten Schwarzen brachte einer seine Frau und seine Tochter mit. Sie übernahmen jetzt die Küchenarbeit. Besonders die Jüngere hatte es Buffalo-Man angetan. Sie war nicht nur fleißig, sondern überdies auch hübsch.
Es gab auch weiße Landarbeiter, von denen einige an diesem Morgen mit drei Ackerwagen loszogen, um Rüben zu ernten. Eigens für diese schwere Arbeit hatte Buffalo-Man Pferde einer schweren kaltblütigen Rasse aus Utah besorgt. Auf diese Idee mit der Aussaat von Feldfrüchten war Slim im Frühjahr gekommen, als er seine Finanzen durchrechnete und nicht hinnehmen wollte, dass er für den Winter zusätzliches Futter für die Rinder kaufen musste. Zwar konnte er sie lange auf den Weiden stehen lassen, doch wie hart der Winter werden würde, wusste man ja nie vorher. Von den anderen Ranchern erntete er dafür nur Unverständnis. Niemand hielt das für notwendig; sie kauften solche Dinge von den Farmern der Umgebung.
Slim hingegen sah nicht ein, warum er dafür Geld ausgeben sollte. Auch Heu brachten seine Arbeiter ein, Weizenstroh und Hafer für die eigenen Pferde. Einige Gemüsesorten wurden ebenfalls angebaut und auf dem Markt von Tuckerville für gutes Geld verkauft, das dringend benötigt wurde.
Allmählich entwickelte sich Slim Western nicht nur zu einem guten Rancher, sondern auch noch zu einem äußerst gerissenen Geschäftsmann. Alles, was auf der Ranch angebaut wurde, machte er zu Geld. Er ließ nichts verkommen, schaffte sogar bereits für den Winter Vorräte an – nicht nur für seinen Viehbestand, sondern auch für seine Leute. Im Großen und Ganzen waren er und Buffalo-Man auf dem besten Weg, erfolgreiche Rancher zu werden.
Erik Machel trug mit Ratschlägen aus seinem eigenen Erfahrungsschatz zu manch einer Verbesserung bei. Nach den arbeitsreichen Tagen, in denen auch er mit Hand anlegte, saßen sie manche Abendstunde noch lange beisammen am Lagerfeuer vor dem Zelt. Sie tauschten Geschichten aus ihrem Leben aus, und am Ende schliefen sie dicht nebeneinander, in ihre Decken gehüllt.
Erik erwähnte nie Jeremiahs Namen. Er konnte es nicht – da empfand er genau wie die Indianer. Niemand hier kannte den wahren Grund, weshalb er hergekommen war. Niemand wusste etwas von dem Schmerz, der ihn jedes Mal von neuem überfiel – wann immer er an seinen Sohn dachte.
Doch hier, in der Gesellschaft all dieser Männer, fühlte er diesen Schmerz nicht ganz so hart. Die Zeit heilt alle Wunden – dieses Sprichwort kam ihm manchmal in den Sinn. Nein, das stimmte nicht. Die Zeit heilte niemals Wunden, die Erinnerung war es. Die Erinnerung an einen geliebten Menschen machte, dass sich die Wunde langsam schloss. Zurück blieb immer eine Narbe, ja, man spürte sie noch; jetzt jedoch empfand man den Schmerz nicht mehr so sehr. Slim Western und Buffalo-Man fragten ihn nicht, drängten ihn nicht, seine Vergangenheit vor ihnen auszubreiten. Jeder hatte so seine Geheimnisse, die niemanden etwas angingen. Erik hatte ihnen lediglich mitgeteilt, noch so lange hierbleiben zu wollen, bis er zu Claire aufbrechen musste. Das von ihr wussten sie also.
So vergingen die Tage in der Gemeinschaft hart arbeitender Männer.
Eines Tages ritt Slim Western mit ihm zur Ranch von Jones Harper. Es gab geschäftliche Dinge zwischen den beiden ehemals besten Freunden zu regeln. Der Hausbau, den Mrs. Antonia Harper emsig vorantrieb, machte inzwischen riesige Fortschritte. Von irgendwoher musste sie wieder Geld aufgetrieben haben. Slim vermutete, von Bob Marcen oder ihrem Papa. Über die Vermögensverhältnisse ihrer Familie wusste er nicht viel, es interessierte ihn auch nicht – schon gar nicht die Gerüchte, die in Tuckerville in Umlauf waren. Irgendetwas von einer Erbschaft, er hatte nicht richtig hingehört. Erst als in diesem Zusammenhang von dem Mädchen die Rede war, das im Frühling bei John Black gewohnt hatte, horchte er auf. Nach ihrem Verschwinden war er oft mit dem alten Trapper auf die Jagd gegangen. Bei seinem letzten Besuch hatte er seinen Leichnam gefunden.
Als Slim Western jetzt mit Erik Machel über einen Hügel in das vor ihnen liegende Tal auf die Ranch von Jones Harper zuritt, erkannte er das Gelände kaum wieder. Seit ihrem Zerwürfnis hatte sich ziemlich viel verändert. Das neue Ranchhaus bekam allmählich ein Ausmaß, das seinen Vorstellungen von einem gemütlichen Zuhause nicht mehr entsprach. Im Halbrund davor standen zwei riesige Scheunen und etliche Stallgebäude, bereits mit Ziegeln eingedeckt. Dahinter, nahe einem Wald, dessen abgeholzte Baumstümpfe von der Arbeit, die hier geleistet worden war, zeugten, erhob sich ein kleines, niedriges Gebäude, das zum größten Teil aus Grassoden bestand – wahrscheinlich die Unterkünfte für die Landarbeiter. Irgendwo wieherten Pferde, die Koppel jedoch war nicht zu sehen. Langsam näherten sich Slim und Erik dem vorderen Teil des Hauses, der bereits fast fertig war. Eine Veranda sollte einmal das ganze Haus umrunden; davon sah man bisher nur den Rohbau. Die Arbeiter, die bis eben noch überall tätig gewesen waren, machten anscheinend gerade Mittagspause. Das Tor der einen von den beiden Scheunen, die Erik und Slim bereits von weitem gesehen hatten, stand weit offen. Während sie daran vorbeiritten, ertönten dort so laute, durchdringende Töne, dass Eriks Pferd kurz scheute. Slim lachte und deutete mit dem Daumen in die Richtung der seltsamen fremden Musik. „Das werden die neuen Arbeiter sein“, wandte er sich an Erik, „die Jones erst vor kurzem angeheuert hat.“
Schon wollten sie die Pferde anhalten, um diese Männer zu begrüßen, da sahen sie Antonia Harper vom Haus her auf sie zukommen. Während die Männer herangeritten waren, hatte sie sich in aller Eile umgezogen – so war sie nun einmal. Fein herausgeputzt begrüßte sie überaus freundlich die seltenen Gäste. Ihr Lächeln jedoch wirkte aufgesetzt, als sie die beiden ins Haus komplementierte. Sie fanden sich in einer spartanisch möblierten Eingangshalle wieder, in der die Fenster noch nicht eingesetzt waren und an einer Wand lehnten. Antonia drängte sie jedoch weiter durch eine Tür in ein anderes Zimmer, das im Gegensatz dazu bereits wohnlich aussah.
Erik, der einen Blick für guten Geschmack hatte, sagte kein Wort. Der Raum war eindeutig völlig überladen und strotzte nur so von Nippes und Flitterkram. Sogar Spitzengardinen hingen bereits an den beiden Fenstern, die nach hinten hinaus gingen. Slim schien das alles nicht wahrzunehmen, er blickte nur etwas beschämt auf seine schmutzigen Stiefel, die überall Dreckklumpen hinterließen. Erik kümmerte das wenig.
Neugierig ging er zu einem der Fenster und blickte hinaus. Aha, dachte er, anstatt Spitzengardinen vor die Fenster zu hängen, hätten sich die Bewohner lieber um das hier kümmern sollen. Nur etwa 40 Fuß entfernt wand sich ein Wald einen sandigen Berghang hinauf. Von unten nach oben war er bis zur Hälfte gerodet; man sah nur noch die Stümpfe. Mit Kennerblick erkannte er sofort, welcher Gefahr sich Jones Harper hier aussetzte. Wenn es länger regnen sollte, würde der Hang unterspült werden und ein Erdrutsch könnte das neue Haus gefährden. Er wandte sich wieder ins Zimmer zurück, denn in diesem Moment betrat Jones Harper den Raum.
Sein Aussehen glich dem eines gediegenen Mannes. Nichts war mehr von dem abenteuerlustigen, unbeschwerten Jungen übriggeblieben, wie ihn Slim ihm beschrieben hatte. Jones Harper trug einen Anzug mit einer seidenen Krawatte, dazu hohe, glänzende Lackstiefel. Den nach der neuesten Mode gefertigten Hut hatte er abgenommen. Bevor er auf die beiden Ankömmlinge zutrat, legte er ihn auf ein kleines Tischchen. Slim und er begrüßten sich freundlich, aber reserviert. Als er Erik vorgestellt wurde, nickte er nur kurz. Zu Beginn ihres Gesprächs erwähnte Jones, dass er soeben von einer Zusammenkunft der Farmer zurückgekommen war. Wollte er damit seinen Aufzug erklären? Vielleicht kam er sich doch ein wenig albern darin vor. Zumindest vor dem Freund, der ihn ganz anders kannte. Eifrig bemühte er sich darum, das Gespräch in Gang zu halten, doch immer wieder kam es ins Stocken.
Antonia, ganz Hausfrau, erschien mit einem Tablett voller Erfrischungen. Als sich jeder ein Glas mit Limonade genommen hatte, entspannte sich die Situation wenigstens ein wenig. Nachdem Jones und Slim ihre geschäftlichen Angelegenheiten in einem Nebenzimmer geregelt hatten, kamen sie wieder zu Antonia und Erik zurück. In dieser Zeit war es der Hausherrin gelungen, Erik ein Glas Whiskey aufzudrängen. Höflich beantwortete er ihre neugierigen Fragen, sofern sie nicht zu persönlich wurden.
Für Eriks Geschmack war Antonia eindeutig zu arrogant und von sich eingenommen. Ihren Charakter durchschaute er schnell. Schon nach kurzer Zeit stockte das Gespräch, und es entstand peinliche Stille; beide schwiegen sich nur noch an. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis Jones und Slim wieder auftauchten. Doch nichts war mehr so wie früher zwischen den beiden einstigen Freunden. Ihr Gespräch drehte sich jetzt nur um belanglose Dinge.
Erik hielt sich heraus und war lediglich stummer Zuhörer. Während Jones mit seinen Erfolgen prahlte, entging ihm nicht, dass er besser dastehen wollte als sein einstiger bester Freund. Man sah es ihm nicht an, und doch bedauerte es Slim, dass sich ihr Verhältnis so sehr verändert hatte. Von ihrer einstmaligen Freundschaft war nichts mehr übriggeblieben. Slim, der sich auf einem Stuhl niedergelassen hatte, fühlte sich unwohl auf dem kostbaren hellgrünen Polster. Obwohl schon auf der äußersten Kante sitzend, rutschte er unruhig hin und her.
Wieder einmal war Stille eingetreten. Um das Gespräch zu beleben, begann Antonia, von der Zukunft ihres Mannes zu schwärmen. „Jones wird einmal eine große Rolle nicht nur hier in Tuckerville spielen“, sagte sie soeben. „Mit seinen Fähigkeiten und den Beziehungen meines Vaters kann er es weit bringen. Wenn dieses Territorium erst ein Bundesstaat ist, werden fähige Männer wie er gebraucht. Ich lasse es nicht zu, dass wir hier versauern. Mein Vater hat bereits in Denver seine Fühler ausgestreckt.“ Ihre Gesichtsfarbe nahm einen dunkelroten Ton an, während sie das sagte, und ihre hellen, blauen Augen blitzten erwartungsvoll. Zwar nahm sie wahr, dass diese Mitteilung die beiden Männer nicht besonders beeindruckte, aber das brachte sie nicht davon ab, weiter ihr Garn zu spinnen. Stolz erhobenen Hauptes schwärmte sie weiter von seiner und natürlich auch ihrer eigenen zukünftigen gesellschaftlichen Stellung. Worin die eigentlich genau bestehen sollte, blieb den Zuhörern allerdings ein Rätsel.
Erik Machel wollte gerade eine dementsprechende Frage stellen, als er jedoch Jones seine verkniffene Miene sah, ließ er es lieber bleiben. Der arme Junge hat wirklich nichts zu lachen, ging ihm auf. Vielleicht wusste er ja selbst nicht, wovon seine Frau da gerade redete, oder es war ihm einfach nur peinlich.
„Was sind das denn für Pläne, von denen deine Frau hier spricht“, wandte sich statt Erik Slim jetzt an Jones. „Willst du etwa ins Parlament?“
Bevor Jones antworten konnte, warf sich Antonia in Position. „Hast du nicht zugehört?“, herrschte sie Slim an. „Colorado wird demnächst ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden. Da braucht man hier Leute wie Jones. Natürlich hat er vor, nach Denver zu gehen.“
Erik verkniff sich ein Grinsen. Solche Frauen wie Antonia kannte er zur Genüge. Hinter der Fassade aus Glimmer und leerem Geschwätz war nicht mehr viel. Sie profilierten sich mit Hilfe ihrer Männer, glaubten, sie wären etwas Besseres als der Rest der Welt. Doch im Grunde genommen bestanden sie nur aus einer leeren, langweiligen, selbstsüchtigen Fassade. Aufgeblasene Weiber – so hatte er sie immer genannt. Wenn es darauf ankam, konnte ein Mann sich nicht auf sie verlassen. Sie würden eher ihr eigenes Scherflein in Sicherheit bringen, als ihrem Mann in schlechten Zeiten zur Seite zu stehen. Mit so einer Frau wollte er nicht verheiratet sein.
Einen triumphierenden Blick in die Runde werfend, redete Antonia schon wieder weiter. „Wenn erst einmal dieses Haus hier fertig ist, werden wir Gäste aus den höchsten Kreisen einladen. Es wird Feste geben und Musikabende“, schwärmte sie weiter.
Erik hörte schon gar nicht mehr zu. Ihr Gerede plätscherte dahin, ohne dass er es so recht wahrnahm. Plötzlich jedoch wurde er aus seinen Gedanken gerissen, denn Slim hatte eine Bemerkung gemacht, die Antonia verstummen ließ. Vergeblich versuchte er, sich daran zu erinnern.
„Warum warst du dann nicht bei seiner Beerdigung?“, hörte er jetzt Slim fragen. Dessen Augen waren starr auf Antonia gerichtet. Betretenes Schweigen, dann antwortete Jones an ihrer Stelle. „Meine Frau hatte bereits alles für eine würdige Trauerfeier in Bob Marcens Hotelhalle organisiert. Zuvor sollte Pastor Longe in der Kirche eine Trauerrede halten. Sie hatte auch einen prächtigen Sarg bei einem Bestatter bestellt und ihn beauftragt, ihren Onkel darin abzuholen. Aber da hattet ihr ihn ja schon heimlich, still und leise draußen vor seinem Blockhaus verscharrt.“ Jetzt wurde seine Stimme lauter. „Sie hatte alles organisiert, die Kirche war festlich geschmückt, Einladungen an die Würdenträger der Stadt verschickt; alles war so, wie es sich für einen Mann wie John Black gehörte. Da erfuhren wir, das seine Beerdigung längst stattgefunden hatte.“
Slims höhnisches Lachen unterbrach seine Rede. Er konnte sich nicht mehr beherrschen. „Wie es sich für einen Mann wie John Black gehörte?“ Ein vernichtender Blick traf Antonia, bevor er sich wieder an Jones wandte. „Es ging euch doch gar nicht um den alten Trapper – es ging euch doch nur darum, Aufsehen zu erregen. Sein Ansehen wolltet ihr benutzen, um euch ins rechte Licht zu rücken. Plötzlich tut ihr so, als wäret ihr im besten Einvernehmen auseinandergegangen. Mir hatte der Alte was ganz anderes erzählt.“ Bevor er noch weitere Ausführungen darüber machen konnte, legte Erik ihm beschwichtigend eine Hand auf die Schulter.
Das nutzte Jones dazu, sich vor seine Frau zu stellen. „Wir wollten ihm lediglich einen würdigen Abschied bereiten – so war das“, zischte er böse. „Alles, was du gesagt hast, ist eine Beleidigung meiner Frau! Sie hat schon genug zu leiden gehabt. Was glaubst du denn, wie sich die Leute in Tuckerville das Maul darüber zerrissen haben, nur weil es ein Testament gibt?“
Slim griff nach seinem Hut und stand auf. „Dr. Kamp“, sagte er in völlig ruhigem Ton, „seine Frau, zwei Freunde aus Tuckerville und ich – wir haben John Black so, wie es sein letzter Wunsch gewesen war, neben seinem Hund zur letzten Ruhe gebettet. Einen Tag später sind wir noch einmal dort gewesen, der Doc und ich. Wir beide saßen oben auf dem Berg, von dem aus man eine schöne Aussicht auf das unten liegende Tal hat – gegen Abend war das. Da kam deine Frau mit Bob Marcen in dessen Kutsche. Sie verschwanden im Blockhaus und blieben dort eine Weile. Als sie wieder herauskamen, stritten sie heftig, doch wir konnten nur ihre Gesten sehen. Nachdem sie verschwunden waren, gingen der Doktor und ich zum Blockhaus hinunter. Jemand hatte dort alles durchwühlt. Die Heinzelmännchen konnten das ja wohl nicht gewesen sein.“
Jones schüttelte heftig den Kopf. Anscheinend wusste er von diesem Ausflug seiner Frau nichts. Antonia lächelte ihn an, während sie es ihm zu erklären versuchte. „Das war an dem Tag, als ich in der Stadt gewesen bin, um die ganzen Feierlichkeiten wieder abzusagen. Schlimm genug, dass du mich das alles hast alleine machen lassen, Jones. Bob ist mir dabei eine große Hilfe gewesen. Danach hat er den Vorschlag gemacht, zum Blockhaus zu fahren, um sich selbst ein Bild von dessen Zustand zu machen. Als seine nächste Verwandte, muss ich mich ja schließlich um den Nachlass meines geliebten Onkels kümmern. Dass das die richtige Entscheidung war, mussten wir leider feststellen, als wir dort ankamen. Alles war durcheinandergeworfen, jemand hatte seine Sachen durchwühlt. Wir jedenfalls waren das nicht. Dass du so etwas von mir denken kannst, Slim Western, ist eine bösartige Unterstellung!“
Diese offensichtliche Lüge kam ihr ganz leicht über die Lippen, doch ihr Gesicht war dabei puterrot geworden. Verräterische Flecken bedeckten ihren Hals bis zu dem tiefen Ausschnitt ihres Kleides.
Slim, der aufgestanden war, trat einen Schritt zurück, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. „Geliebter Onkel? Ich sehe hier kein einziges Andenken an diesen angeblich so geliebten Onkel!“, stieß er heftig hervor, in die Runde blickend. „Hier ist kein einziges Bild von ihm – nichts. Dabei sind einige Aufnahmen seiner Familie noch immer im Blockhaus. Wenn er dir so viel bedeuten würde, hättest du zumindest eines davon mitgenommen. Hier aber stehen nur Abbilder von dir und Jones, ein paar sogar von deinem Vater und deiner Mutter. Ach – und dort sehe ich noch eines von einem preisgekrönten Stier!“
Unwillkürlich wandten sich alle außer Antonia um. Slim, der nach der Art, wie sie ihn anstarrte, gewärtig sein musste, dass sie auf ihn losgehen würde, ließ sich davon nicht einschüchtern. „In John Blacks Blockhaus habe ich kein einziges Andenken an deine Familie, die Hamiltons, gesehen. Alle Bilder zeigen nur seine eigene Familie. Und zu der habt ihr nie gehört.“
„Pah! Dass ich nicht lache. Von wegen seine Familie“, empörte sich Antonia aufgebracht. Jetzt war sie nicht mehr zu bremsen. „Die Indianerin, die er angeblich geheiratet haben soll, die zählt nicht zu seiner Familie. Und erst recht nicht diese andere, die bei ihm gewohnt hat! Der steht überhaupt nichts zu. Wir sind seine Familie – wir, hörst du? Die anderen sind alle verreckt. An der Cholera die, mit der er einen Bastard gezeugt hat, und der Rest dieser Brut ist irgendwo von Soldaten erschossen worden, als sie sich weigerten, sich unseren Gesetzen zu beugen.“ So, jetzt war es heraus.
„Antonia, Liebling, bitte“, versuchte Jones sie zu beruhigen.
Als wäre ihr erst jetzt klargeworden, was sie soeben von sich gegeben hatte, presste Antonia die Lippen fest zusammen. Wie ein beleidigtes kleines Kind wendete sie den Anwesenden den Rücken zu.
Erik, der das Ganze als Außenstehender beobachtet hatte, entging ihre Nervosität nicht. Ihm wurde bewusst, dass sie soeben etwas preisgegeben hatte, was sie normalerweise nicht gesagt hätte. Er ließ sich das alles noch einmal durch den Kopf gehen, wurde jedoch nicht schlau daraus. Wovon redete sie? Einen Blick auf Jones Harper werfend, bemerkte er auch dessen Nervosität.
„Dieses Mädchen, das damals bei deinem Onkel war“, machte ihr Ehemann einen Versuch, alles herunterzuspielen. „Du hast sie doch kennengelernt, Liebling. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Sie war doch nur irgendein Mädchen, das für uns bedeutungslos ist.“ Antonias Mund klappte auf und sofort wieder zu; sie begriff sofort, dass er sich nur dumm stellte.
Bevor Jones weiterreden konnte, herrschte Slim ihn an: „Dieses Mädchen hat einen Namen. Und du weißt genau, wie sie heißt!“
Jones fuhr zu ihm herum, eine Ader pulsierte an seiner Schläfe. An ihn gewandt, der noch immer mit dem Hut in der Hand bereitstand, den Raum zu verlassen, wies er ihn zurecht: „Lass es gut sein, Slim, sie ist doch nur eine bedeutungslose Indianerin. Ich weiß nicht, warum Antonia sie jetzt im Zusammenhang mit ihrem Onkel erwähnt. Ich denke, sie hat sich damals zu sehr darüber geärgert, wie sie von ihr behandelt worden ist.“
Seine Miene war undurchsichtig, doch er ließ Slim nicht aus den Augen. Natürlich kannte er das Testament des alten Trappers. Doch wie viel davon war in Tuckerville bekannt? Konnte es sein, dass Slim etwas darüber wusste? Einer seiner Leute hatte ihm berichtet, dass Slim zu den ersten Besuchern im Comanchenlager gehört hatte. War er dort auf der Suche nach Summer-Rain gewesen? Wenn ja, dann konnte er sie wohl nicht gefunden haben, sonst wäre ihm das spätestens jetzt zu Ohren gekommen. Seine Suche nach ihr – aus anderen Gründen – war bisher ergebnislos geblieben.
Erik Machel blickte immer noch von Jones zu Slim. Worum in aller Welt ging es hier? Er schüttelte den Kopf, als müsste er ein lästiges Insekt verscheuchen. Diese beiden ehemaligen Freunde schienen ein gewaltiges Problem zu haben. Doch er war nicht der Mann, der sich in die Angelegenheiten anderer einmischte. Antonia schnaufte verächtlich, bestätigte aber die Worte ihres Mannes durch heftiges Nicken. Slim Western ärgerte sich über sich selbst. Er hatte sich hinreißen lassen. Um dem allen ein Ende zu machen, meinte er an Jones gewandt: „Es ist besser, wir gehen jetzt, bevor noch mehr harte Worte fallen. Was unsere gemeinsamen Geschäfte betrifft, so ist ja alles geklärt – es wird keine mehr geben.“ Damit setzte er seinen Hut auf und schlug den Weg nach draußen ein, ohne sich höflich zu verabschieden.
Erik war es nur recht. Nachlässig grüßend tippte er an seine Stirn und folgte Slim. Um den Anstand zu wahren, begleitete Jones die beiden bis auf die halbfertige Veranda. Als Slim vorhin mit ihm allein gewesen war, hatte er versucht, ihm ins Gewissen zu reden, sich nicht zu sehr von Antonia beeinflussen zu lassen. Er hatte ihn an vergangene gemeinsame Zeiten erinnert. Jetzt, wie auch schon bei anderen Gelegenheiten, verschloss sich Jones seinen Argumenten. Schmerzlich musste Slim erkennen, dass er gegen Antonia nicht ankam.
Eine der Bemerkungen, die Jones während ihres Gespräches gemacht hatte, blieb ihm noch lange im Gedächtnis haften. Sie waren bezeichnend für den Wandel, der mit dem früheren Freund vonstattengegangen war. Wider besseres Wissen hatte er gesagt: „Mein Schwiegervater hat seine Fehler, gewiss – aber er weiß, was er tut. Ich kann von ihm nur profitieren. Frank Hamilton fällt immer auf die Füße, egal, was er beginnt. Und jetzt hat er vor, noch weiter in die Eisenbahn zu investieren. Ich bin gewillt, mich ihm anzuschließen. Bald kommt ein neuer Schienenstrang bis hierher – und nicht nur bis zu dem Güterbahnhof dort draußen, einen halben Tagesritt von Tuckerville entfernt. Wir haben schon Land gekauft, mein Schwiegervater und ich. Ich will einmal zu den reichsten Ranchern hier gehören. Da kann ich nicht zimperlich sein, was meinen Umgang betrifft.“ Dass Jones so weit gehen würde, sich seinem Schwiegervater so eng anzuschließen, erschreckte Slim. Gleichzeitig aber wurde ihm klar, dass es gut war, sich von ihm getrennt zu haben. Wenn Jones mit seinem Schwiegervater gemeinsame Sache machte, war ihm nicht mehr zu helfen. Dass Frank Hamilton hinter diesem Viehraub steckte, der Jones beinahe seine Existenz gekostet hatte, darin waren sie sich einmal vor langer Zeit einig gewesen. Zählte das alles jetzt nicht mehr? Anscheinend war es so. Dann gab es zwischen ihnen nichts mehr zu sagen. Mit einem Mann, der so dachte, der das Geldverdienen vor alles andere stellte – mit solch einem Mann konnte ihn keine Freundschaft mehr verbinden. Das war aber noch nicht alles. Zum Schluss ihrer Unterredung hatte er noch etwas gesagt, das ihn völlig unvorbereitet traf, weil es einfach nicht mehr mit dem Bild des alten Jones Harper übereinstimmte. „Du und dein Nigger – ihr solltet euch vorsehen, was ihr sagt. Die Leute in Tuckerville werden bald nicht mehr gut auf Indianerfreunde zu sprechen sein.“
Außer sich vor Wut hatten sich da seine Hände zur Faust geballt. Dann erinnerte er ihn an etwas. „Wo wärst du denn heute, Jones Harper, wenn eine Indianerin dir nicht damals aus dem Schlamassel mit den Apachen geholfen hätte? Und nicht nur das! Wahrscheinlich wärest du sogar tot oder hättest zumindest ein Bein verloren.“ Jetzt, wo er über das alles noch einmal nachdachte, wurde ihm klar, was Jones meinte. Landkäufe? Natürlich! Es lag im Interesse von Frank Hamilton und seinen Geschäftspartnern, Land billig zu erwerben und es dann teuer weiter an die Eisenbahn oder neue Siedler zu verscherbeln.
Bald würde es eine Bahnstation geben. Ungeahnte Möglichkeiten und Jones Harper als Vertreter dieser Region in einem neuen Bundesstaat? Plötzlich wurde ihm die Luft zu knapp, und er war froh, endlich draußen zu stehen. Die Luft dort drinnen reichte nicht mehr für sie beide.
Erik, Jones Harper und ein tief durchatmender Slim Western standen nebeneinander auf den Holzstufen der Veranda – Jones in seinem gut sitzenden teuren Anzug, die beiden Anderen in schlichter, praktischer Cowboytracht. Trotz seiner Enttäuschung versuchte Slim zu lächeln, aber es kam nicht aus seinem Herzen. Jones wusste das sehr wohl. Bedauern über die verlorengegangene Freundschaft bemächtigte sich beider. Nichts konnte mehr wie früher werden. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Weg gewählt. Es gab kein Zurück, für niemanden von ihnen. Ihre Überzeugungen, ja, ihre Lebenseinstellungen, traten auf einmal weit auseinander.
Während Slim und Erik ihre Pferde losbanden, drängte es Jones, wenigstens noch etwas Belangloses zu sagen, um den tiefen Abgrund, der sich zwischen ihnen auftat, zu mildern. Ein bisschen wenigstens. Da ertönte laut und die Luft zerreißend von der Scheune her wieder diese seltsame Musik. Sie hörte sich nicht einmal schlecht an – irgendwie griff es ihnen ans Herz. Ja, genau so war Jones und Slim jetzt auch zumute. Wehmütig, traurig und schwer verhallte der Klang ganz langsam.
„Was ist das, Jones? Musizieren deine Arbeiter dort?“, fragte Slim, um Belanglosigkeit bemüht.
Auf Jones‘ Gesicht erschien ein Strahlen. Er kam die zwei Stufen herunter und nickte – froh, dass der einstige Freund nicht wortlos einfach so davonreiten wollte. „Ja“, sagte er. „Die sind seit sechs Wochen bei mir. Ich war zufällig gerade am Güterbahnhof, als sie dort ankamen. Sie hatten einen Dudelsack bei sich, auf dem einer von ihnen gerade spielte. Da hab ich gleich gewusst, dass das nur Schotten sein können. Wer sonst macht denn diese grässliche Musik? Sie sind aus Kansas und suchten Arbeit. Ich hab sie gleich vom Fleck weg eingestellt. Wären es Iren gewesen, so hätte ich es mir wohl dreimal überlegt. Nur leider sprechen sie ein so schlechtes Englisch, dass ich sie kaum verstehe.“
Während er weiterredete, deutete er zu der offenstehenden Scheune hinüber. „Einer spricht unsere Sprache ganz gut. Mit dem kann ich mich verständigen. Sie erledigen die Arbeit hier, als hätten sie noch nie etwas anderes gemacht.“
Erik Machel kratzte sich das stoppelige Kinn und senkte den Kopf. Nur Slim, der zufällig zu ihm hinsah, bemerkte, wie es um seine Mundwinkel verdächtig zuckte. Er und Erik bestiegen in völliger Eintracht ihre Pferde und ritten – erleichtert, diesen Besuch so glimpflich hinter sich gebracht zu haben – davon. Jones blickte ihnen nach, bis sie hinter den Stallgebäuden verschwunden waren.
Nein, er bereute kein einziges Wort. Der Weg, den er gehen würde, lag klar vor ihm.
Er hatte sich dafür entschieden, mit dem Teufel ein Bündnis einzugehen.
Erst nachdem sie außer Hörweite waren, wandte sich Erik an Slim.
„Von wegen Schotten – dass ich nicht lache!“
„Nicht? Aber Jones hat doch gesagt …“
„Ich hab´s gehört. Doch das sind garantiert keine Schotten; das sind waschechte Iren.“
„Wie kommst du denn da drauf?“
Er hatte zwar durch das offene Tor ebenfalls in die Scheune geblickt, aber außer einem großen Kerl mit diesem seltsamen Instrument neben sich und einer Gruppe Zuhörer nichts weiter gesehen.
„Na, sag schon – da bin ich jetzt aber gespannt.“
Zum Ranchhaus zurückblickend meinte Erik: „Eigentlich sollte Jones ja wissen, wen er einstellt; schließlich ist man als Arbeitgeber für sie verantwortlich – so sehe ich das jedenfalls. Und dieser aufgeblasene Kerl, der einmal dein bester Freund war, ist ein noch größerer Schwachkopf, als ich zuerst dachte.“
Slim wartete auf eine weitere Erklärung, und die kam auch prompt.
„Hast du das Instrument gesehen?“ Und, als Slim nickte: „Jones behauptet, seine Arbeiter wären Schotten, nur weil sie Dudelsackmusik spielen. Stimmt fast. Nur ist das kein schottischer Dudelsack. Die Schotten blasen ihre Musik heraus, mit dem Mund – verstehst du, was ich meine?“
Nein, Slim verstand nicht. Aber er war weiterhin gespannt.
„Nun denn – hast du gesehen, dass dieser Mann in sein Instrument hineingeblasen hat? Nein, hast du nicht, denn er hat einen Blasebalg benutzt, stimmt´s?“
Slim nickte, und Erik klärte ihn weiter auf. „Ein schottischer Dudelsack sieht anders aus. Ich weiß zwar nicht, wie man das, auf dem der Mann dort spielt, nennt, aber auf jeden Fall ist das ein typisch irisches Instrument – glaub mir. Die Iren sind stolze Männer, und man sollte sie nicht mit den Schotten vergleichen – und schon gar nicht mit ihnen verwechseln; das würden sie einem richtig übelnehmen. Ein Mann mit Jones‘ Ambitionen wird es nicht leicht mit ihnen haben. Schon gar nicht, wenn er erst seinen Irrtum erkennt. Denk an meine Worte – das gibt bald richtig Ärger.“
Also Iren, dachte Slim belustigt, die er ja auf keinen Fall einstellen wollte. „Sollte ich ihn warnen?“
„Nein, lass mal, das geht uns nichts an. Wenn er Schwierigkeiten kriegt, muss er selbst damit fertigwerden.“
Slim ließ sein Pferd im Schritt gehen. Doch er musste mit jemandem über diesen Besuch reden, so aufgewühlt wie er war. „Jones war für mich einmal ein verdammt verlässlicher Kamerad. Jemand, dem ich blind vertrauen konnte – und jetzt?“
„Willst du meine Meinung hören, Slim?“ Doch er wartete die Antwort gar nicht erst ab. „Wenn ich sagen würde, dass er in meinen Augen ein überhebliches Arschloch ist, würde ich mir das zu einfach machen. Seine Frau ist der wunde Punkt. Er ist blind vor Liebe und merkt nicht, dass sie ihn nach ihren Vorstellungen formt. Falsch – schon verformt hat. Wenn man jemanden richtig uneigennützig liebt, sollte man nicht versuchen, ihn zu ändern. Damit verändert man doch auch die Person, in die man sich einmal verliebt hat. Sie wird zu einer ganz anderen – und man selbst doch auch, oder? Gefällt sie mir dann aber noch – oder ich ihr? Er vergöttert sie, ist blind und taub für jede Kritik. Was sie sagt, wird zum Gesetz. Das kann aber gewaltig nach hinten losgehen. Allmählich wird sie sich nämlich von einem Schmetterling zu einer hässlichen Raupe verpuppen, und Jones wird sich ihr angleichen. Um sie nicht zu verlieren, wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Und dann? Ein Mann sollte das, was sich vor seiner Nasenspitze abspielt, sehen. Ich bin kein Freund davon, anderen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Diese Frau jedoch wird ihn nach ihren Vorstellungen weiter formen. Vielleicht weiß er das ja sogar in seinem tiefsten Innern bereits selbst. Doch er kommt nicht gegen seine Gefühle an. Was er einmal schlecht oder verwerflich fand, wird er bald anders sehen – wenn er weiter dem Einfluss seiner Frau und seines Schwiegervaters ausgesetzt ist. War zuvor noch blau, was blau war, so wird er demnächst behaupten, dass es grün ist. Du hast mir ja einiges über diesen Frank Hamilton erzählt. Slim, du kannst Jones Harper nie wieder Dinge anvertrauen, denn du weißt nicht, ob er sie nicht gegen dich verwenden wird, wenn es seinen eigenen Zwecken oder die seiner Frau dienlich ist. In Zukunft wird er alles zuerst mit ihr besprechen – und sie das mit ihrem Vater. Am Ende wird das, was sie zu sagen hat, zu seiner eigenen Überzeugung werden. Schade um ihn – nach allem, was du mir über ihn erzählt hast. Doch dieses Schicksal teilen viele schwache Ehemänner mit ihm, so ist das eben. Das muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein, so habe ich das gar nicht gemeint. Aber bei manchen Männern kann einem dabei schlecht werden.“
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. „Dass Menschen, die dankbar sein können, glücklicher durch die Welt kommen, daran glaube ich. Jones ist jedoch dabei, sich ganz und gar für seine Frau aufzugeben, um glücklich zu sein.“
Dass Erik ein kluger und weiser Mann war, hatte Slim schon des Öfteren erkannt. Was er jetzt über Jones Harper sagte, erstaunte ihn, denn Erik kannte ihn bisher nicht persönlich. Und doch hatte er genau erkannt, was Sache war.
Slim und er sprachen noch eine ganze Weile über dieses Thema. Erik kam nicht auf die Idee, Slim nach diesem Mädchen zu fragen, über das sich Antonia so abschätzig geäußert hatte. Auch Slim erwähnte sie mit keinem Wort. Als die Nachricht von der Anwesenheit der Comanchen die Runde gemacht hatte, war er sofort zu ihnen hinausgeritten, hatte noch zweimal mit einem Händler das Lager besucht. Er konnte kein Comanche, konnte nicht nach ihr fragen – und wagte es auch nicht. Endlich kam er zu dem Schluss, dass sie wohl zu einem anderen Lager gehörte. Erik Machel wusste weder etwas von Slims Gefühlen für dieses Mädchen, das er jetzt selbst als seine Tochter bezeichnen würde, noch von dem Nachlass John Blacks. Auch hatte er keine Ahnung, was Jones Harper mit ihr verband. Er war nicht neugierig und sah auch keine Veranlassung, bei Slim deshalb nachzuhaken.
So ritten die beiden Männer in stillem Einvernehmen weiter – ohne ihre Gedanken miteinander zu teilen.
Gegen Abend machten sie Rast und ließen ihre Pferde grasen. Sie selbst hatten Proviant mitgenommen und ruhten sich unter einer großen Eiche aus. Dann ritten sie gemächlich weiter; sie hatten keine Eile.
Über dem vor ihnen liegenden dunklen Wald sahen sie die letzten Strahlen der untergehenden Sonne, die die Ränder der Wolken in Gold aufglühend nachzeichneten. Am Horizont verschwamm alles in einem bleiernen Grau, das nur noch durch einen breiten Streifen Sonne erhellt wurde – dort leuchtete es wie geschmolzenes Eisen.
Später kamen sie an eine Flussbiegung, die die Grenze zu Slim Westerns und Buffalo-Mans Ranch bildete.
Der Abend war schon weit fortgeschritten, da erreichten sie das große Zelt, in dem Buffalo-Man auf einem prall gestopften Heusack, den Kavalleriesäbel wie immer neben sich gegen die Zeltplane gelehnt, laut schnarchte. Mit dem Hausbau hatten es Slim und er noch immer nicht eilig; es gab wichtigere Dinge. Das Leben hier draußen unter freiem Himmel waren sie gewöhnt. Keiner von ihnen vermisste etwas.