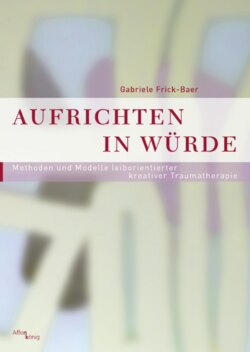Читать книгу Aufrichten in Würde - Gabriele Frick-Baer, Udo Baer - Страница 11
2.2 Traumatische Situationen und Phasen des Traumaerlebens
ОглавлениеDas Wort Trauma stammt aus dem Alt-Griechischen und bedeutet „Wunde“. Die Bezeichnung „Trauma“ wird in der Medizin für bestimmte körperliche Wunden benutzt, in Psychologie und Psychotherapie für bestimmte seelische Verletzungen. „In einer ersten Arbeitsdefinition können wir psychisches Trauma als seelische Verletzung verstehen (von dem griechischen Wort Trauma = Verletzung). Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden.“ (Fischer, Riedesser 1999, S.19)
Neben sexueller Gewalt werden Erfahrungen wie Kriegsereignisse, Tod von Angehörigen, Naturkatastrophen, Unfälle, andere Gewalttaten usw. als traumatische Ereignisse bezeichnet. Jede traumatische Erfahrung wird individuell unterschiedlich erlebt, was allgemeingültige Definitionen nicht einfach macht. Die Forscher des Instituts für Psychotraumatologie definieren ein psychisches Trauma als ein „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ (Fischer, Riedesser 1999, S.79)
Begrifflich hat es sich für uns als sinnvoll herausgestellt, verschiedene Aspekte zu unterscheiden, die in der Sammelbezeichnung „Trauma“ enthalten sein können:
das Traumaereignis oder die Traumasituation, also in diesem Kontext die Handlungen sexueller Gewalt,
das Traumaerleben, also die Art und Weise, wie ein Mensch sich und seine Welt vor, während und unmittelbar nach dem Traumaereignis erlebt,
die Traumabewältigung, also die Art und Weise, wie der Mensch langfristig sein Traumaerleben bewältigt,
die Traumafolgen, also die Folgen des Traumaerlebens und der Traumabewältigung.
Trauma ist eine subjektive Kategorie und beinhaltet das subjektive Erleben einer Situation. Wesentliche Merkmale des traumatischen Erlebens sind:
Die Situation wird als existenziell bedrohlich erlebt. Was unter „existenziell“ verstanden wird, ist individuell unterschiedlich. „Existenziell bedrohlich“ sind nicht nur Situationen, in denen das Leben bedroht ist (die es allerdings auch sehr häufig gibt), grundlegend bedroht werden kann auch die seelische und soziale Existenz.
Fischer und Riedesser betonen in ihrer Definition die Diskrepanz zwischen der Bedrohung und der eigenen Hilflosigkeit. Das Ohnmachtserleben, das Grundgefühl, einer Gewalt ausgeliefert zu sein, die Erfahrung, in allem, was man tut, unwirksam zu sein, gehört folglich ebenso zum Traumaerleben.
Die Beschädigung des Selbstwertgefühls habe ich in der Beschreibung der Phänomene betont.
Ebenso haben wir dort aufgezeigt, dass die Schutzgrenzen, die die Intimität und Persönlichkeit bewahren, gewalttätig durchbrochen wurden. Jede sexuelle Gewalt ist ein Erleben existenzieller Beschämung.
Das Erfahren sexueller Gewalt ist immer auch eine Beziehungserfahrung. Nähe wird als gewalttätig und grenzverletzend erlebt, Vertrauen wird gebrochen.
Erleben sich Opfer sexueller Gewalt in der traumatischen Situation einsam und allein, so setzt sich das Gefühl, alleingelassen zu sein bzw. zu werden, für viele in der „Zeit danach“ noch fort.
Alle diese Merkmale traumatischen Erlebens müssen nicht für alle Opfer sexueller Gewalt zutreffend sein, für die meisten sind sie es – nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen und nach wissenschaftlichen Studien. In letzteren ist der „Zeit danach“ bisher nicht die Bedeutung zugemessen worden, die dieser Phase meiner Meinung nach gebührt. Aufgerüttelt durch Erfahrungen von Klient/innen, deren Aussagen sich in dem Zitat „Das Schlimmste ist das Alleinsein danach“ stellvertretend wiederfinden, habe ich mir die Forschungsaufgabe gestellt, diese Phase genauer zu untersuchen. Über die Ergebnisse Rechenschaft abzugeben, wird einer späteren Veröffentlichung vorbehalten sein. (Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Damit verharmlose oder relativiere ich keinesfalls die Taten der Täter/innen. Ohne die Taten gäbe es keine „Zeit danach“.) Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die „Zeit danach“ für viele Opfer darüber entscheidet, ob das Traumaerleben bewältigt werden kann oder zu einem nachhaltig bestimmenden Teil der Biografie wird, und dass sie oft über die Nachhaltigkeit des Schreckens und der anderen Folgen entscheidet.
Das Traumaerleben sollte deshalb in drei Phasen unterteilt werden: das Erleben der akuten traumatischen Situation/en der Erfahrung sexueller Gewalt, die „Zeit danach“, in der die Betroffenen getröstet und parteilich aufgefangen werden – oder auch nicht, und die Phase der Traumabewältigung, in der die Betroffenen auf unterschiedliche Weise mittel- und langfristig die Folgen des Traumaerlebens in ihre Lebensmuster integrieren.