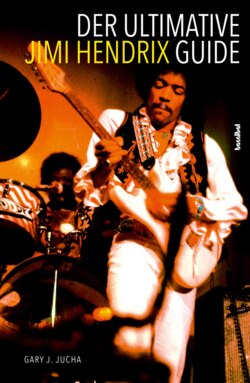Читать книгу Der ultimative Jimi Hendrix Guide - Gary J. Jucha - Страница 6
ОглавлениеVorwort
Er war wie kein anderer Gitarrist und wird diesen Status immer behalten. Seine musikalische Vielfalt und Ambition, das publikumswirksame Auftreten, die Fähigkeiten als Komponist, die überwältigende Technik sowie sein Temperament und Charisma – Jimi Hendrix wird als einer der strahlendsten Gitarristen des 20. Jahrhunderts verehrt, dem Jahrhundert der Rockgitarre. In seinen klanglichen Fingerabdrücken vereinten sich all die erdigen Strömungen der Populärmusik – Rock’n’Roll, Rhythm’n’Blues und ähnliche Genres –, die er in die Zukunft katapultierte, wo sie immer noch auf uns warten, ein aufheulendes Feedback, ähnlich dem Loop eines zurückkehrenden Kometen.
Dass er dieses immense Werk schon im Alter von 27 Jahren geschaffen hatte und während einer nur fünfjährigen intensiven Karriere, macht seine Geschichte auf diesem Planeten noch fantastischer, als sie ohnehin schon ist. War man ihm einmal begegnet, vergaß man ihn nie wieder. Ich traf Hendrix zum ersten Mal schon früh in seinem Leben, im August 1966, genau in dem Moment, als er sein Schicksal in die eigenen Hände nahm: Er trat regelmäßig im Café Wha? in der MacDougal Street auf, mit einer Gruppe namens Blue Flames. Hendrix nannte sich damals noch Jimmy James und hatte sein Pflichtprogramm als Begleitmusiker der Isley Brothers und von Little Richard absolviert, wo er dann aber zwangsläufig gefeuert wurde, da er dem Rock’n’Roller die Show stahl. An jenem Abend im Greenwich Village im Café Au Go Go in der Nähe der Bleecker Street, also gerade nur um die Ecke, wo man einen „Blues Bash“ veranstaltete, zog er dann wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Richie Havens und John Hammond Jr. mit seinen Nighthawks nahmen auch an der Veranstaltung teil. Während eines späteren Sets bat Hammond Jr. Jimi/Jimmy auf die Bühne. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er spielte, sondern nur noch, wie er spielte: Er flitzte mit Hammer-ons und Pull-offs über den Gitarrenhals, riss die Saiten mit den Zähnen an, nahm sich einen 12-taktigen Blues vor und modulierte ihn auf die gleiche Art und Weise, wie ein Robert Johnson, John Lee Hooker, Buddy Guy und noch ein paar andere es möglicherweise gemacht hätten.
In dieser merkwürdigen Phase – in der Zeit und Raum zu verschmelzen schienen – entdeckte ihn der Ex-Animals-Bassist Chas Chandler, der Hendrix nach Großbritannien mitnahm, damit sich sein Schicksal erfüllte. Klugerweise bestärkte Chandler Jimi Hendrix nicht nur hinsichtlich seiner auf der Bühne beeindruckenden „Pyrotechniken“, sondern begriff auch, dass dieser, um sein Potenzial wirklich auszureizen, mehr sein musste als ein reiner Instrumentalist. Er baute für ihn eine Band auf, die ihm genügend Freiraum für seine Exkursionen ermöglichte: Mitch Mitchell und sein vom Jazz beeinflusstes Schlagzeug und Noel Redding, der den Bass manchmal wie eine Gitarre spielte, waren ein perfektes Team. Mit dieser Besetzung kreierte Jimi die Traumlandschaften der Sixties-Psychedelia, verstärkt durch Eddie Kramers klangliche Abenteuerlust im Studio. Dies traf auf die Bereitschaft des sich neu bildenden „progressiv angehauchten“ Rockpublikums, die interstellaren Sphären seines virtuosen Talents zu erforschen.
Was folgte, waren geradezu ikonenhafte Augenblicke und Images, eingebrannt in die kollektive Erinnerung: einen in Monterey auf der Bühne knienden Gitarristen, der die aus seiner Stratocaster kommenden Flammen wie ein Zauberer beschwört; seine Version des „Star Spangled Banner“ in Woodstock, durch die er die Nationalhymne radikal verändert, damit sie ein neues Publikum anspricht; die Maschinengewehrsalven seiner Gitarre, die im Fillmore erklingen, während die Sixties um Mitternacht an der Kreuzung verschwinden und einem neuen Jahrzehnt weichen. Was die Siebziger anbelangte, hatte Hendrix eine hohe Erwartungshaltung. In dem gemütlichen Underground-Labyrinth der Electric Lady Studios, nur wenige Blocks entfernt von dem Café, in dem ich ihn zum ersten Mal sah, sinnierte er über die universelle Sprache der Musik und wie er all diese Strömungen in seine Klangwelten integrieren könnte. Auch wenn das Schicksal ihn letztlich nicht dazu auserwählte, zeigt sich dieser noble Versuch doch in seinem Gesamtwerk, das sich auf kosmischen Klangbahnen bewegt. Als Jimi die Triebwerksstufe seiner interstellaren Rakete in den Sechzigern zündete, symbolisierte das die große Herausforderung der Menschheit, die Erde zu verlassen und die gegebenen Grenzen zu transzendieren.
Hendrix lebte den Mythos des Rockstars in einer Zeit, in der Rockstars übergroß am Firmament erschienen, jammte von Mitternacht bis in den Morgen, obwohl ihn alle nur erdenklichen Versuchungen umgaben, und erschuf eine von Adrenalin aufgeheizte Situation, die einen Schaffensprozess auf höchstem Level bedingt. Er war gekleidet wie ein Inka-Häuptling, und seine Shows – mit Darstellungen von Opfergaben bzw. „Menschenopfern“ – kombinierten Rituale und Magie. Manchmal verfing er sich in den eigenen Fallstricken. Eines Abends, ich trug meine „Liebeskette“, Sandalen und ein Nehru-Shirt, besuchte ich das alte Symphony Theater in Newark. Martin Luther King war gerade ermordet worden. Jimi schaute auf die Zuschauer, die die brandaktuelle Nachricht zu ignorieren schienen und auf den Augenblick warteten, in dem er sein Instrument zum Singen bringen würde. Er spürte die Belastung durch das ihm geschenkte Talent und stellte sich die Frage, ob sich das alles lohne.
Für seinen tragischen Tod hätte es keinen ungünstigeren Moment geben können, denn er begann gerade, seine Musik auf eine neue und allumfassendere Ebene zu heben, die ein noch reiferes musikalisches Verständnis ankündigte. Es gibt viele „Was wäre, wenn“-Fragen, die der Imagination überlassen bleiben, obwohl er schon bei „1983 … (A Merman I Should Turn To Be)“ die Zukunft vorwegnahm. Man kann sich verschiedene Kooperationen vorstellen, Produktionen und Auftritte, wobei Letztere zunehmend simpler wurden, während sie doch zugleich seinem Selbst näher kamen, den Kern seines Ichs erreichten, ähnlich einem Planeten, der in eine Sonne stürzt.
Seine Musik zu spielen und dabei seinen spinnenähnlichen Fingern nachzueifern, die neue Akkorde und Akkorderweiterungen auf dem Gitarrenhals kreierten, macht Spaß. Es macht Spaß, seine Effekte nachzuahmen – bedenkt man die immense Lautstärke, mit der er spielte, und die tonale Palette – und dabei den Verstärker bis über die Höchstgrenze zu jagen. Und es macht Spaß, ihn zu imitieren, denn er hatte einen einzigartigen Sinn für Humor, verknüpft mit dem Bedürfnis, die tiefsten Emotionen auszudrücken. Auch wenn ich ihn als Gitarristen über alle Maße schätze, ist es doch seine Rolle als Songwriter, die mich zutiefst anspricht: „Purple Haze“, „Up From The Skies“ und das göttliche „Little Wing“, eins der schönsten Liebeslieder, das jemals komponiert wurde, begeistern mich immer wieder aufs Neue.
Seine extravagante Ausstrahlung, die den Himmel erleuchtete, und ein Leben, das permanent Grenzen überschritt, sind zur Legende geworden. Es gibt so viele Fragen wie Antworten, und die Reaktionen hinterlassen – wie die Aufnahme der Frequenzen der Musik – ein klangliches Manifest, mit dem er die Musikgeschichte bereicherte.
Hinter der Musik steht immer der Musiker, die Essenz unserer Beziehung zwischen den Klängen und dem Schöpfer dieser Klänge.
Lenny Kaye
Lenny Kaye ist der Gitarrist von Patti Smith seit Gründung ihrer Band. Als Plattenproduzent und Autor hat er mit Künstlern wie Suzanne Vega, Soul Asylum, Allen Ginsberg und Waylon Jennings gearbeitet. Seine 1972 erschienene Compilation Nuggets, gewidmet dem Garage-Rock, wurde lange als das wichtigste Reissue überhaupt angesehen und vom Rolling Stone als eines der besten Rockalben aller Zeiten geadelt.