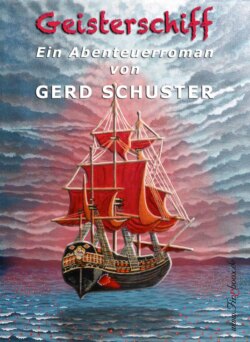Читать книгу Geisterschiff - Gerd Schuster - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеFischfrikadellen mit Fadenwürmerwürze
oder
Eine einsame Nixenfluke geht ins Netz
Meine Genugtuung, endlich eine Spur gefunden zu haben, hielt nur bis zum Jachthafen von Port Elizabeth vor und zerplatzte dort wie eine Seifenblase. Denn das erste, was ich nach meiner Ankunft sah, war Hamish Hogg. Er stand in all seiner Körperfülle auf der Brückennock eines schicken weißen 20– Meter–Kajütkreuzers, der vor etwa fünf Minuten seinen Liegeplatz an der Pier verlassen haben musste und in langsamer Fahrt in die glockenblumenblaue Algoa Bay hinausdampfte. Hogg schaute zum Kai zurück, als halte er nach mir Ausschau, und sein rosiges Vollmondgesicht leuchtete im frühen Abendlicht wie ein chinesischer Rundlampion.
Die feiste Gestalt auf der Jacht war schon eine halbe Meile entfernt, aber es war unverkennbar mein Gegenspieler von Waters, Windermere und Winchester. Solche Pausbacken und ein derart multiples Kinn gab es in dieser Färbung – exakt im Ton der Schnittfläche eines Laibs gekochten Schinkens, wie er in britischen Pubs an der Sandwich-Bar bereitlag – in Verbindung mit der Geckenbrille und der blonden Oscar–Wilde–Frisur nur einmal auf dem Globus.
Ich hatte Seine Monstrosität kaum erblickt, als der Kajütkreuzer wie zum Hohn mit lautem Dieselröhren Fahrt aufnahm. Der Bug hob sich, das Kielwasser schäumte weiß, und das Boot zog rasch davon.
Wie vom Donner gerührt, blieb ich im Taxi sitzen, das mich gerade vom Flughafen zum Kai gebracht hatte. Der schwarze Fahrer deutete mein Zögern falsch und erklärte mir überflüssigerweise, wir seien am Fahrtziel angekommen. Also kramte ich umständlich in meinen Taschen nach Geld, um Zeit zu schinden.
Ich versteckte mich im Wagen, bis Hogg sich umdrehte, ins Steuerhaus trat und die Tür hinter sich zuzog. Ich war sicher, dass er mich nicht gesehen hatte. Diesen Triumph gönnte ich dem Adipösus nicht. Er sollte nicht wissen, dass er mir zuvorgekommen war.
Ich hätte mir das Versteckspiel sparen können; denn bald wurde offenbar, dass die Kanaille bereits mit meiner Ankunft gerechnet hatte, als ich im Helikopter saß und selber noch gar nicht wusste, dass ich mich in PE, wie die Einwohner von Port Elizabeth ihre Stadt nannten, einschiffen würde. Und dann hatte er es irgendwie geschafft, sämtliche für mich infrage kommenden Boote zu blockieren.
Wie ihm das gelungen war, wusste ich nicht, aber alle Ausflugsboote waren ausgebucht, zum nächsten Tag gechartert oder in der Wartung, nur Wochen im Voraus zu mieten, ausgelaufen oder defekt. So viele Boote mit Maschinen–und Elektronikschäden hatte es noch nie in einem Hafen gegeben.
Ich versuchte es bei den Touristendampfern, den Tauchern, den Big–Game–Fischern und sogar bei einigen Freizeitkapitänen. Aber die winkten ab, als sie hörten, wie weit ich raus wollte. Ich bot fünftausend Dollar – vergebens.
Ziemlich angefressen ging ich zum Büro des Hafenkapitäns, stellte mich mit Jachteignern, die ihre Liegegebühren zahlen wollten, in eine Schlange und schilderte ihm, als ich an der Reihe war, mein Problem. Zuerst wollte mich der kleine Mann mit dem weißen Schnurrbart abwimmeln. Aber er wurde freundlich, als ich erwähnte, dass ich für Lloyds unterwegs war, und riet mir, es im Fischereihafen zu versuchen. Wie überall auf der Welt litten auch in Südafrika die Trawler unter ständig schrumpfenden Fangmengen, sagte er, und ihre Kapitäne bräuchten Geld.
Ich nahm den Rat an und fuhr zum wenige Kilometer entfernten Fischereihafen. Er war schmuddelig, feucht, chaotisch und übelriechend wie alle Fischereihäfen der Welt, und es ging rau zu. Ich musste mich mit einem Sprung vor einem wahnsinnigen Gabelstaplerfahrer in Sicherheit bringen, der mit Vollgas um ein Gebirgsmassiv aus leeren blauen Fischkisten herumgerast kam.
Die ersten sechs Kutter waren menschenleer. Auf drei der nächsten acht oder zehn traf ich brummige Schwarze an, die Netze flickten, das Deck abspritzten, Rost klopften oder Löcher in die Luft starrten. Sie wollten nicht mit mir reden – vielleicht störte sie mein Oberhaus–Englisch – oder erklärten, der Kapitän sei von Bord, und sie hätten nichts zu sagen.
Endlich hatte ich Glück. Auf einem besonders verlotterten Kutter, dessen einstmals moosgrüne Bordwände mit zimmertürgroßen Roststellen und ebenso ausgedehnten Menningeflecken übersät waren und der im Schanzkleid des Steuerbordbugs eine metergroße Beule hatte, war der Skipper anwesend. Er war ein Weißer mit ölverschmierter Glatze, der vor lauter Muskeln und wohl auch Speck beinahe aus seinem Blauen Anton platzte. Er schraubte und hämmerte unter dem A–Mast auf dem Fangdeck mit einem mageren schwarzen Matrosen an einer verrosteten Kurrleinen–Winsch herum. Das ist eine der Winden, die das Netz über die Heckrampe an Bord ziehen. Ein Trawler hat mindestens zwei davon.
Als der Seemann hörte, um was es ging, ließ er den Schraubenschlüssel fallen, kam in großen Schritten auf den Kai marschiert, packte den Ärmel meines Sakkos, zog mich ziemlich rüde über die Gangway auf die Brücke und knallte die Tür hinter mir zu. Das Steuerhaus war ebenso verlottert wie der ganze Kutter, aber das GPS schien mir auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Dafür waren die sieben Halbliter–Bierdosen, die zwischen GPS und Echolot lagen, sämtlich leer.
Ich nannte dem Skipper – er hieß Jos Botterfass und musste um die Fünfzig sein – die Position, die das Hubschrauber–GPS festgehalten hatte: 36:2:24S und 30:4:12E, zu deutsch: 36 Grad, zwei Minuten und vierundzwanzig Sekunden südlicher Breite sowie 30 Grad, vier Minuten und zwölf Sekunden östlicher Länge. Man konnte das auch als Dezimalzahl mit vielen Ziffern hinter dem Komma ausdrücken, aber ich zog die gute alte Art vor.
Botterfass drehte sich zu dem winzigen Kartentisch um, hinter dem ein Zwitter aus Sitzbank und Behelfskoje an die Rückwand der Brücke geflanscht war. Er stieß mit seinem öligen Zeigefinger, der etwa dreimal so breit war wie meiner, auf eine Seekarte nieder, als wolle er sie mitsamt der Tischplatte perforieren. Dann brummte er in breitem Burenenglisch, das seien etwa 160 Seemeilen, für die er rund zwanzig Stunden bräuchte. Ob und wie lange ich vor Ort bleiben wolle?
Zwar konnte ich nicht einmal raten, wieviel Zeit vergehen würde, bis wir etwas fanden, und ob wir überhaupt auf etwas stoßen würden, aber ich sagte, ein Tag – zwölf Stunden Tageslicht – müsste genügen. Da kämen drei Tage zusammen, knurrte der Kapitän. Das koste zwölftausend Dollar.
Es war nicht weiter schwierig, ihn von seinem Wucherpreis auf 50 000 Rand herunterzuhandeln, rund 8000 Dollar – aber nur gegen die Zusage, dass er während des Kreuzens auf der angegebenen Position fischen durfte. 25 000 Rand wollte er vor Fahrtbeginn, der Rest war nach der Rückkehr zahlbar.
Ich holte meinen Koffer aus dem Taxi und ging an Bord. Zwei Stunden später legten wir ab. Wir bunkerten fünfzehnhundert Liter Diesel und eine Tonne Eis. An der Eisfabrik warteten wir auf einen jungen schwarzen Matrosen, den Botterfass telefonisch an Bord beordert hatte, und stachen dann endlich in See. Es war stockdunkel, als wir losdampften.
Die »Starina« war ein Hecktrawler von etwas über zwanzig Metern Länge, rund 120 Tonnen und unbestimmbarem Alter. Ich schätzte, dass sie dreißig bis vierzig Jahre auf dem Buckel hatte. Die Maschine war wohl ebenfalls nicht mehr ganz jugendfrisch, denn wenn Botterfass für 160 Meilen zwanzig Stunden einkalkulierte, lief der Kahn nur acht Knoten. Die »Palermo Express« hätte für die Strecke sechseinhalb Stunden gebraucht.
Auf der Brücke zahlte ich die erste Rate. Botterfass, der seine suppentellergroße rechte Pranke aufhielt, grapschte die Scheine und ließ sie in einer Tasche seines Overalls verschwinden. Dann knurrte er, ich solle ihm folgen. Er wolle mir meine Koje auf der Back zeigen.
Meine Bettstatt war die oberste von drei Bunks im klaustrophobisch engen Logis der Crew. Es stank nach Fisch, Schmieröl, Zigarettenqualm und Athletenfüßen – wie wir Briten Schweißquanten schonend umschreiben – und war offenbar nur durch ein mageres Schott von dem tobenden Diesel getrennt. Alle Kojen waren, bis auf ein auffällig kleines rundes Einstiegsloch, mit dickem Sperrholz verkleidet, damit die Schläfer bei dem hier üblichen Seegang nicht herauspurzelten.
Wären die ziemlich wahllos mit Reißbrettstiften an den Blenden befestigten Pin–up–Fotos schwarzer Schönheiten nicht gewesen, hätte man das Ganze für drei überdimensionale Nistkästen halten können. Ich stellte meinen Koffer auf den Boden. Unter das Tischchen passte er nicht.
Die Toilette lag auf der anderen Seite des Gangs. Sie war winzig, ziemlich vorsintflutlich und hatte statt einer Tür einen blauen Plastikvorhang mit zwei Dutzend Zigaretten–Brandlöchern. Ein rundes Stahlbecken von Amselnestgröße neben dem Klo, dessen Inneres größtenteils schokoladenbraun war, schien die einzige Waschgelegenheit an Bord zu sein. Wer den Schmutz nicht kennt, lernt die Sauberkeit nicht schätzen, dachte ich und ging auf die Brücke. Rudergänger war der ältere Schwarze. Ich fragte ihn nach dem Skipper. Der sei in der Kombüse, bedeutete er mir knapp.
Ich folgte dem Fischgeruch und fand Butterfass in der Messe. Sie war so eng, dass die Kabine der Sikorsky im Vergleich zu ihr wie ein Tanzsaal gewirkt hätte. Die Decke war so niedrig, dass ich mich bücken musste. Der Kapitän hockte am einzigen Tisch und zerlegte fluchend ein paar große silberne Fische. War eine Anzahl Filets fertig, packte er sie mit seinen öligen Schaufelhänden und hielt sie gegen das Licht der Deckenlampe. Dann warf er sie ungehalten auf den Tisch zurück, dass es klatschte, und säbelte oder kratzte mit dem Messer mit ärgerlichen Bewegungen irgendetwas aus ihnen heraus. Immer wieder half er mit dem schwarz geränderten Nagel seines rechten Zeigefingers nach. »Alles voller verdammter Nematoden!« polterte er, als er mich sah. »Jedes Jahr gibt es weniger Fisch, aber mehr von dem verfluchten Wurmzeug!«
Ich bat um einen Overall, denn auf dem Kutter würde es keine zehn Minuten dauern, bis meine Hose und mein Armanisakko durch Öl oder Schmierfett ruiniert wären. Botterfass warf das Messer hin und holte mir, ohne sich die Pranken abzuwischen, einen Blauen Anton, in den ich zweimal hineinpasste. Es war wohl seine eigene Reservegarnitur.
Ich zog den Blaumann über und wechselte gleich meine lederbesohlten italienischen Halbschuhe gegen die knöchelhohen Wanderstiefel, die ich meist im Koffer mitführte, obwohl sie enorm viel Platz beanspruchten. Nicht nur auf Schiffen konnte hochwertiges Schuhwerk mit gutem Schutz vor Bänderrissen und griffigen Sohlen lebenswichtig sein.
Meine Boots hatten ein kleines Extra. Unter der Polsterung des Zungenrückens des rechten Stiefels war ein Geheimfach versteckt. Wenn man den per Klettverschluss befestigten Mittelteil des Synthetikfellbelags in exakt dem korrekten Winkel von links aufzog, kam eine kleine Tasche zum Vorschein. Fünf Rasierklingen, ein Schließfachschlüssel, Pillen, Knopfbatterien, gefaltete Geldscheine und Notizzettel passten hinein – kleine wichtige Dinge eben, die niemand dort suchen würde. Jetzt war das Versteck natürlich leer.
Das Abendessen bestand aus etwa drei Dutzend öltriefender Fischfrikadellen, die selbst den auf Fisch versessenen Admiral Nelson in die Flucht getrieben hätten, und einem Pappkarton voll runder Schaumgummibrötchen. Sie waren einzeln in Plastik eingeschweißt und sahen aus, als seien sie von einem McDonalds–Lkw gefallen. Ich zwang mich, ein paar Bissen zu essen, obwohl ich immer an die Fadenwürmer und die öligen Fingernägel denken musste, und spülte zwei der Styroporwecken mit Bier herunter, das Botterfass, mit dem ich alleine am Tisch saß, kredenzte.
Weil es nichts zu tun gab und der Skipper keinerlei Interesse an einer Unterhaltung hatte, ging ich nach dem Mahl an Deck. Dort wollte ich mir von einer gesunden Salzwindbrise den Fischgestank aus Kleidern und Haaren wehen lassen. Am Heck setzte ich mich unter dem Gienmast auf das Netz, das dort als Berg aus grüner Nylonschnur lag. Aber es war nichts mit Auslüften. Der Wind drückte beißenden Dieselqualm aus dem Schornstein nach unten und mir direkt ins Gesicht. Außerdem kam Gischt über. Ich beschloss, in die Koje zu gehen.
In meinem Quartier zog ich Sakko und Hose aus, faltete sie zusammen, stieg auf den Rand der untersten Koje und legte die Kleidung durch das Loch auf das klamme Bettzeug. Dann schlüpfte ich wieder in den Overall und versuchte, durch das Loch in die Bunk zu kriechen. Das war unerwartet schwierig, weil es keine Leiter und nichts zum Festhalten oder Abstoßen gab und ich schaffte es erst beim fünften Versuch in meinen Nistkasten. Wahrscheinlich würde ich noch länger brauchen, um ihn wieder zu verlassen. Sollte die »Starina« sinken, würde ich höchstwahrscheinlich wie eine Ratte ersaufen.
Hose und Sakko bugsierte ich ans Kopfende meiner Schlafstätte. Dabei stieß ich mit der Stirn an die Decke. Sie bestand aus Presspappeplatten, die nur lose auf Halteleisten lagen. Jedes Mal, wenn ich sie berührte – was mir am Anfang mehrfach passierte, weil die Koje kaum 45 Zentimeter hoch war – hoben sie sich ein wenig, und Dreck rieselte mir über Schädel, Gesicht und Genick. Vergeblich versuchte ich, das körnige Zeug vom Bett zu wischen und es zwischen Matratze und Sperrholzverhau zu bugsieren.
In einem besonders dunklen Winkel am Kopfende fand ich eine nackte Kerzenbirne. Ich zog an dem Stummel einer Schnur aus öligen Stahlperlen, der unter der ebenfalls nackten Fassung pendelte. Es klickte, aber es wurde kein Licht. Durchgebrannt. Es war nun einmal nicht die »Queen Mary II«.
Der Luxusliner ließ mich an Hogg denken. Das Monstrum saß vermutlich im Salon seiner Jacht beim dritten Gin Tonic, schaute einen DVD–Film und konnte sich dann in eine schicke Kabine mit bequemem Bett, Dusche und moderner Unterdrucktoilette zurückziehen! Ich verbot mir, den Gedanken weiterzuspinnen, kroch unter die schmierige, nach Fisch und Öl duftende Steppdecke und schloss die Augen.
Der Schiffsdiesel war keine drei Meter entfernt und brüllte durch das miserabel schallisolierte Schott des Maschinenraums. Der Seegang hatte merklich zugenommen, und der Kutter schlingerte und stampfte heftig.
Normalerweise konnte ich auf Schiffen recht gut schlafen, denn ich war seefest – eine Eigenschaft, die in den Genen der Cunninghams steckte. Im Allgemeinen weckte die Schaukelei tief in mir angenehme frühkindliche Reminiszenzen, etwa an das Wiegen in den Armen von Mutter oder Amme. Ich entspannte mich, ging die Bewegungen des Schiffes locker mit und fühlte mich meist so wohl wie ein frisch gestillter Säugling.
Auch an Krach gewöhnte ich mich rasch, wenn er gleichmäßig war wie der dumpfe Herzschlag großer Schiffsmaschinen oder das Dröhnen altmodischer Klimaanlagen–Klapperkästen. Mit brüllenden Dieseln wurde ich einigermaßen fertig.
Tatsächlich nickte ich bald ein, aber eine grässliche Kakofonie riss mich nach einer knappen Stunde aus dem Schlummer. In meinem Schlafgemach herrschte ein Getöse wie in einer mittelalterlichen Kesselschmiede. Der Lärm glich in frappierender Weise dem, was bestimmte Kulturkritiker der Londoner »Times« und diverse Konzertveranstalter unter »Neuer Musik« verstanden.
Direkt neben mir schien eine schwere Eisenkette durch einen engen Kanal in der stählernen Bordwand gezogen zu werden. Es rasselte und schepperte zum Gotterbarmen, und die ganze Koje vibrierte. Das gleiche Getöse schallte ein wenig gedämpft von der anderen Schiffseite herüber.
Natürlich war der Krach nicht regelmäßig. Nein, er hielt etwa fünf Sekunden an und hörte dann auf. Nach einer Pause von zehn bis zwanzig Sekunden setzten sich die Ketten erneut in Bewegung – wie es schien, immer in Gegenrichtung. Manchmal verstummte das Scharren und Poltern eine halbe Minute, aber es kam immer wieder.
Außerdem schienen auf dem Fangdeck, wo das Netz lag, zwei Männer direkt über mir die Bordwand mit Schmiedehämmern zu traktieren – einer an Steuerbord, der andere an Backbord. Auch hier war die Frequenz der Schläge so unregelmäßig wie der Seegang.
Es dauerte ein paar Minuten, bis ich, verschlafen wie ich war, die Geräusche identifiziert hatte. Die Ketten führten offenbar zum Ruder, das jetzt von einer Art Autopilot bedient zu werden schien. Wenn das Schiff gierte, also von den Wellen nach Backbord oder Steuerbord aus dem Kurs gedrückt wurde, lenkte der Automat gegen – und die Ketten rasselten durch ihre Führungen. Wurde das Ruder nach Backbord bewegt, schepperte »meine« Kette in Richtung Heck; schwenkte es nach Steuerbord, krochen die Stahlglieder bugwärts. Ich hoffte, der schwarze Steuermann hatte sich nicht schlafen gelegt, nachdem er den Autopiloten eingeschaltet hatte.
Die Schmiedehammerschläge konnten von den türgroßen Scherbrettern des Netzes stammen, überlegte ich. Sie hingen am Schanzkleid und krachten bei jedem Überholen des Schiffes dagegen.
Der Wind frischte weiter auf, und die »Starina« arbeitete immer heftiger. Überall polterte, rumpelte und ächzte es, der Diesel röhrte, und die Schraube steuerte ein nervenaufreibendes »Schwusch–schwusch–schwusch–schwusch« zu meinem Gutnachtkonzert bei. Wenn das Schiff in ein Wellental kippte und seinen Propeller aus dem Wasser streckte wie eine Ente ihren Bürzel, wurde daraus ein hektisches »Schwisch–schwisch–schwisch–schwisch«.
Ich konnte nicht mehr einschlafen, obwohl ich sehr müde war, denn schon auf dem langen Flug von London nach Port Elizabeth hatte ich kaum ein Auge zugetan. Ich nickte häufig ein, der Lärm weckte mich aber sofort wieder auf. Die Zeit schien stillzustehen. Ich schaute nach jedem Sekundenschlaf auf die Uhr, immer in der Hoffnung, es sei nicht erst 00.14 Uhr, sondern bereits sechs oder sieben Uhr. Meine Gedanken drehten sich im Kreis, und ich verwünschte Hogg aus ganzem Herzen. Diesen Horrortrip musste er mir büßen!
Um sechs Uhr kroch ich aus der Koje. Ich schaffte den Ausstieg aus dem Rattenloch beim vierten Versuch – bäuchlings und rückwärts – mit den Beinen zuerst. Ich pinkelte – zum Spülen musste man ein Ventil aufdrehen, eine rostige Handpumpe betätigen und das Ventil wieder schließen – und ging in die Messe.
Zum Frühstück gab es Tee und kalte Fischfrikadellen mit eingeschweißten Plastikbrötchen aus dem Pappkarton. Glücklicherweise fand ich in einem Winkel der Pantry ein Glas Marmite und verzehrte zwei Wecken mit der braunen Hefepaste. Ich hatte Bedenken, wie ich überleben würde, wenn es drei Tage lang nur die Nematoden–Buletten zu essen gab, und ich dachte wieder Willen erneut an Hogg. Nicht ich brauchte eine Hungerkur, sondern er! Aber das Dickerchen von WW&W spülte sicher gerade ein Tomatenomelett mit frischen Kräutern, geräucherte Forellenfilets, Hash Browns, Baked Beans und Toast mit Cappuccino und Champagner herunter!
Und doch saß ich am längeren Hebel: Während mein wohlgenährter Widersacher nur auf Verdacht im Ozean herumkreuzte, hatte ich ein konkretes Ziel: 36 Grad, zwei Minuten und vierundzwanzig Sekunden südlicher Breite, 30 Grad, vier Minuten und zwölf Sekunden östlicher Länge. Ich hoffte inständig, dass Ganesha mich nicht aufs Glatteis geführt hatte.
Irgendwie schaffte ich es, die Zeit totzuschlagen. Es gab den ganzen Tag nichts zu tun und keinen Aufenthaltsraum außer der kleinen Messe, die schon mit zwei Mann überfüllt war. Immerhin konnte ich einige Stunden auf dem Netz sitzen, denn der Wind hatte gedreht und blies den Dieselqualm in eine andere Richtung. Aber meinen Hunger konnte die Seebrise nicht verscheuchen.
Botterfass überfiel mich mit der Nachricht, dass wir wegen des schlechten Wetters und ungünstiger Strömung die von mir gewünschte Position erst gegen 23.00 Uhr erreichen würden. Er beabsichtige, zu diesem Zeitpunkt das Netz auszuwerfen, denn zwischen Kapschwelle und dem Agulhas–Becken gäbe es einige unterseeische Gebirgsrücken, über denen Fischschwärme stehen könnten. Er werde große Kreise dampfen und das Netz nach sechs oder sieben Stunden einholen. Auf jeden Fall würde das Schiff sich bei Tagesanbruch wieder exakt auf der Zielposition befinden.
Ich überlegte, ob ich ihn bitten sollte, mich zu wecken, verwarf den Gedanken aber. Ich konnte ja ohnehin nicht schlafen.
Zum Abendessen gab es wieder Fischfrikadellen mit Hamburger–Brötchen. Aus Selbsterhaltungstrieb würgte ich drei Viertel eines Klopses herunter und bat Botterfass um eine Verdopplung meiner Bier–Ration. Nicht umsonst nennen manche Leute den Gerstensaft »flüssiges Brot«. Er ist nahrhaft. Mit Erleichterung sah ich, dass nur noch vier Wurm–Buletten übrig waren, nachdem die beiden Matrosen gegessen hatten. Ich hoffte, dass der Skipper in der Nacht etwas Appetitlicheres aus dem Wasser zog.
In der Koje versuchte ich, nicht an Hogg, sondern an Laxmi zu denken, an ihren schönen Mädchenbauch mit dem mandelförmigen Nabel, ihre großen und vollendet runden Brüste mit den kleinen, schwarzbraunen Brustwarzen, ihr sorgfältig getrimmtes blauschwarzes Dreieck und die langen schlanken Beine.
Ich wachte auf, weil das Brüllen des Schiffsdiesels plötzlich fehlte. Ich schaute auf die Uhr: Viertel nach sechs! Obwohl ich eine enorme Morgenlatte hatte, wand ich mich sofort aus dem Rattenloch, zog den Blaumann aus, mit Hose und Jackett wieder an, schlüpfte in die Stiefel und stürmte an Deck, obwohl ich dringend pinkeln musste. Aber das war wegen der Erektion momentan sowieso unmöglich.
Ich war unerklärlich aufgeregt, und mir kam zu Bewusstsein, dass ich nicht von Laxmi, sondern vom Fischfang geträumt hatte. Ich hatte zugeschaut, wie das Netz als endloser schlaffer grüner Strumpf an Bord gezogen wurde. Stunde um Stunde hatte Botterfass Meilen leerer Falten eingeholt, und dann war das Netz bis auf einen kleinen toten Hund völlig leer gewesen. Das Wesen war veilchenblau, hatte pinke Schlappohren und einen gleichfarbigen Stummelschwanz. Es trug Schwimmhäute an den weißen Pfoten und hatte eine gelbe Taucherbrille mit dem Logo einer weltbekannten Hundefuttermarke auf der Schnauze. »Seehunde – verdammtes Ungeziefer!«, hatte der Skipper geknurrt und den bunten Kadaver mit einem Fußtritt die Slip herunter und über Bord befördert.
Ich rannte auf die Brücke. Botterfass holte tatsächlich das Netz ein! Er bediente von einer Konsole an der Backbord–Brückennock die Kurrleinenwinden und die Winches für die anderen Kabel, an denen das Netz hing. Die beiden Matrosen warteten unter dem A–Mast. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Scherbretter aus dem Wasser kamen und das Netz mit seinen gelben Auftriebskugeln sichtbar wurde. Schließlich rutschte es die Heckrampe hinauf und Bauch, Tunnel und Steert stiegen aus dem Wasser.
Botterfass brummte verdrießlich, denn der Fang war schlecht: Am Steert, wo sich das Netz stark verjüngte und in einer wurstförmigen Tasche auslief, war nur ein Beutel von zwei Meter Länge und etwa einem Meter Durchmesser mit Fisch gefüllt. Grollend hievte der Skipper das Netz unter dem A–Mast in die Höhe. Einer der Schwarzen zerrte mit einem Bootshaken an der Codleine, und der Inhalt ergoss sich klatschend auf Deck.
Ich stürzte den Niedergang herunter zum Heck. Einer der Matrosen spülte mit einem Hochdruckschlauch Tang, Quallen und Plastikmüll über Bord, der andere schob zappelnde Fische mit einer Art Besen durch eine Luke ins Schiffsinnere und warf große vielbeinige Krabben in Plastikkisten.
Gerade, als ich ihn erreichte, packte er einen Bootshaken und hackte mit ihm nach einen schwarzen Gegenstand, der wie ein großer Teerklumpen inmitten der hüpfenden und zuckenden Fischleiber lag und von ihnen teilweise verdeckt wurde. Der Bootshaken bohrte sich nicht in das Ding, sondern prallte ab, flog dem überraschten Afrikaner aus der Hand und fiel in das Fischgewimmel.
Da sah ich, was es war: Eine große, offenbar hölzerne Fluke an einem schlanken, etwa einen halben Meter langen, scharf gewundenen und sich progressiv verdickenden Körperstumpf, der mit geschnitzten Schuppen bedeckt war und an einigen Stellen golden glänzte! Ein Nixenschwanz! Eilig watete ich in die Fischleiber, rutschte aus und fiel der Länge nach hin. Einen Moment lag ich wie auf einem sich windenden Wasserbett, und mehr als ein Fischschwanz klatschte mir ins Gesicht: Aber ich schaffte es, meinen Fund zu packen.
So rasch ich konnte, rappelte ich mich auf und hievte die Flosse in die Höhe. Das Ding hatte eine Spannweite von rund 1,20 Metern. Es war etwa zwanzig Zentimeter breit und acht bis zehn Zentimeter dick – und es triefte wie in meiner Vision. Der Körperstumpf hatte an der Schwanzwurzel schätzungsweise 28 Zentimeter Durchmesser und an seiner Bruchstelle etwa 35.
Flossen sind meist strömungsgünstig scharf geschnitten. Nicht so bei dem Geschenk des Meeres: Beide Teile der Fluke waren seltsam konturlos und hatten keine spitzen, sondern stark abgerundete Enden. Das ganze Ding wirkte abgeschliffen, verschlissen, abgenutzt. Und es fühlte sich merkwürdig glatt an.
Es war eine Fluke. Das war offensichtlich, obwohl der Leib der Seejungfrau fehlte: Der Nixenschwanz stand waagerecht zum Körper und war dafür ausgelegt, nicht wie beim Hering von rechts nach links bewegt zu werden, sondern wie bei Delfinen und Walen von oben nach unten.
Ich schleppte meinen Fund an den beiden Matrosen vorbei, die mich verblüfft beobachteten, auf die Brücke. Ich legte ihn vorsichtig auf der Nock ab, zog die Tür auf und sagte zu Botterfass, der mich finster anstarrte: »Drehen Sie um, Skipper, es geht nach Hause! Ich habe gefunden, was ich gesucht habe!«
Der Kapitän beruhigte sich erst, als ich ihm versicherte, er werde das versprochene Honorar trotz der um einen Tag kürzeren Fahrtzeit in voller Höhe erhalten, und ihm vorlog, ich sei Klimaforscher und arbeite an einer Methode, mithilfe der Jahresringe in altem Treibholz den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre früherer Jahrhunderte zu bestimmen.
Ob der Skipper mir glaubte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall briet er zum Mittagessen einen großen Barrakuda, der im Netz gewesen war. Das zarte, duftige weiße Fleisch war der delikateste Fisch, den ich je gegessen hatte, und ich verschlang fünf große Stücke – ohne Brötchen.
Ich war mir mit Botterfass einig, dass ich die Schwanzflosse der Galionsfigur eines alten Windjammers gefunden hatte, höchst wahrscheinlich einer Meerjungfrau. Wir waren übereinstimmend der Überzeugung, dass mit dem Fund etwas nicht stimmte; denn die Fluke war mit einer dünnen, aber extrem harten Lack– oder Kunststoffschicht überzogen. Ich konnte die transparente Hülle mit meinem Schweizer Offiziersmesser kaum anritzen. Allein das Zentrum der Bruchstelle ließ sich bearbeiten.
Während der Rückfahrt legte ich mich in meine Koje und dachte nach. Gut, mit einer Riesenportion Dusel hatte ich gefunden, was ich vor meinem inneren Auge gesehen hatte. Aber was hatte ich damit gewonnen? Was die maritime Antiquität mit dem Untergang der »Palermo Express« zu tun hatte – oder haben konnte – war mir ein Rätsel.
Wenn ich es recht überlegte, war es ausgeschlossen, dass es irgendeine Verbindung zwischen dem Schwanzende einer alten Segelschiff–Galionsfigur und dem verschwundenen Containerriesen gab. Jedenfalls fiel mir beim besten Willen keine ein.