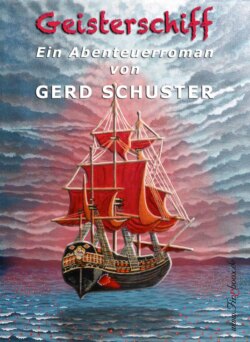Читать книгу Geisterschiff - Gerd Schuster - Страница 9
Kapitel 6
ОглавлениеEine garstige Geisterschiff–Gastritis
oder
»Lustige« Recherchen im Lesesaal
des British Museum
In den nächsten Tagen hatte ich reichlich Gelegenheit, mich satt zu essen; aber nichts wollte mir schmecken. Selbst ein Marsala Dosa, das Laxmi zum Frühstück zubereitete, um mir eine Freude zu machen und mich aufzumuntern, schaffte ich nur zur Hälfte.
Dabei war ich sonst ganz wild auf die indische Leckerei – ein hauchdünner knuspriger Fladen von Pizza–Größe, der auf einer heißen Rundplatte aus flüssigem Teig gebacken und über einer delikaten Füllung aus currygewürztem Kartoffelgemüse in der Mitte gefaltet wurde.
Von Hamish Hogg hatte ich seit unserem Treffen im Flugzeug nach Guernsey nichts gehört. Nur indirekt war er in Erscheinung getreten: Laxmis Freundin Saida war es ohne Probleme gelungen, die kompletten Dossiers zu fotokopieren, die der Stab von WW&W für den XXXL–Ermittler zusammengetragen hatte. Sie hatte sogar den Farbkopierer benutzen können.
Die Datensammlungen enthielten zwar eine Vielzahl von Adressen und Telefonnummern, auch von Familienmitgliedern und Freunden mit seemännischem Hintergrund; leider bestanden sie aber zum großen Teil aus einer schier endlosen Litanei von Schiffen, auf denen die beiden Briten, der Norweger und der indische Chefingenieur in ihrem Seemannsleben gefahren waren. Den Heuerdaten zufolge schienen manche der Seeleute über Jahre hinweg alle drei Monate abgemustert und wenige Tage später auf einem neuen Pott angeheuert zu haben.
Die Hinweise zum Familienstand der Toten waren nur wenige Zeilen lang; denn es gab nur wenig zu berichten.
Die Shearers hätten am 6. Oktober Silberne Hochzeit feiern können. Ihr einziges Kind, eine Tochter namens Dorothy, war 1993 im Alter von zehn Jahren beim Baden im Meer vor Margate ertrunken. Warum, war nie geklärt worden. Der erste Offizier, Malcolm Morrisson aus einem Weiler in der Nähe von Oban in Schottland, war geschieden und kinderlos. Andrew Harraps, der zweite Offizier aus Newcastle, war homosexuell und dem Dossier zufolge ohne festen Partner gewesen, und Jan–Aage Olsen, der dritte Offizier aus Stavanger, hatte erst vor einem halben Jahr geheiratet. Chefingenieur Vijay Mukherjee stammte aus Sultanpur–Majra im Unionsterritorium Delhi und wohnte in Thiruvananthapuram im südindischen Bundesstaat Kerala. Dort hatte er laut Akte eine Frau, fünf Kinder und ein Haus mit sechs Telefonnummern. Wie auf dem Subkontinent üblich, würde, wenn man Glück hatte, eine davon funktionieren.
Die Fotos der Offiziere schaute ich mit wesentlich mehr Interesse an. Es war für mich merkwürdig faszinierend, Bilder von Menschen zu betrachten, die gerade gestorben waren. Es war eine Marotte von mir, in den Gesichtern nach Zeichen für einen gewaltsamen oder frühen Tod zu suchen.
Unter Shearers goldglitzernder Kapitänsmütze schaute ein wettergegerbtes Gesicht hervor, das kantig und fleischig zugleich war. Das viereckige Kinn, der herrschsüchtige Mund und die gnadenlosen Augen verrieten, dass mit diesem Mann nicht gut Kirschen essen gewesen war.
Morrisson war das Gegenstück zum Master. Er war blass, dicklich und hatte seine teigigen Züge zu einem schiefen, unsicheren Lächeln verzogen. Er trug einen fadenscheinigen blonden Schnurrbart, der ihm nicht stand. Seine Augen schienen trübe, und seine Ohren waren ungewöhnlich klein und knubbelig.
Harraps war Anfang 30, sah aus wie der junge Omar Sharif und lächelte charmant. Auch Olsen sah gut aus. Er war ein Mischling – die Mutter kam wohl aus Afrika. Weil er dunkelblonde Haare und tiefblaue Augen hatte, sah er aus wie nach einem Karibikurlaub. Seine äthiopischen Wangenknochen und die afrikanische Nase verrieten jedoch, dass er kein Wikinger war.
Das Foto von Mukherjee war schwarz-weiß, alt und unscharf. Auf dem Bild war der Schiffsingenieur um 40 – ein magerer, sehr dunkelhäutiger und schwarzhaariger Mann mit schmalem Gesicht, grau melierten Schläfen und intelligenten, ein wenig vorstehenden Augen. Auffällig war, dass er seit acht Jahren auf den gleichen Schiffen gefahren war wie Shearer.
Hatte der ihn auf die »Palermo Express« mitgenommen – beziehungsweise dafür gesorgt, dass er den prestigeträchtigen Job bekam? Und wenn ja, warum? Hatte der alte Bärbeiß in dem Inder einen Freund an Bord gehabt?
Ich heftete die Dossiers unter »Palermo Express« ab. Die Ablage war genau der richtige Ort für sie, denn ich brauchte sie nicht mehr. Weil außer Mrs. Shearer niemand wissen konnte, wie der Containerriese gesunken war.
Das zu klären, war unerwartet einfach gewesen: Das Schiff hatte über zwei Satellitentelefonleitungen verfügt, von denen am Unglückstag nur eine benutzt worden war, und zwar ein einziges Mal, von 09.01 Uhr bis 09.03 Uhr Schiffszeit. Mrs. Shearer – dem Dossier zufolge hieß sie mit Vornamen Moya Alexandra – hatte trotz der albtraumhaften Umstände gut geschätzt: Das letzte Gespräch mit ihrem Mann hatte laut den Daten der Telefongesellschaft eine Minute und dreiundvierzig Sekunden gedauert.
Um keine schlafenden Hunde zu wecken, hatte ich sämtliche Verbindungen während der Rückreise ab Shanghai angefordert und nach längerem Hin und Her mit diversen Ermächtigungen von Eigner und Chartergesellschaft auch erhalten. Datenschutz war nötig, erschwerte mir aber oft die Arbeit. Howard Shearer hatte seine Frau tatsächlich jeden Morgen zum Frühstück angerufen und dabei einiges Geld vertelefoniert. Skypen war offensichtlich nur dann kostengünstig, wenn keine Satellitenverbindung zu einem Schiff auf hoher See involviert war.
Für mich hieß das zweierlei: Keine weiteren Besuche bei Hinterbliebenen und keine Gefahr, dass jemand die Story von der Begegnung mit dem Geisterschiff erfuhr – falls Mrs. Shearer nicht auch Hamish Hogg ihr Herz ausschüttete.
Wenn mich jemand gefragt hätte, warum ich Wert darauf legte, dass das gruselige Geheimnis der Kapitänsfrau nicht die Runde machte – ich hätte keine wirklich relevante Antwort gewusst. Ich war mir nicht einmal darüber klar, ob ich Hogg die Nachricht von dem Geisterschiff missgönnte, oder ob ich nicht insgeheim hoffte, Mrs. Shearer werde ihn – wie mich – zunächst auf die Folter spannen und dann mit ihrer Moritat vom »Fliegenden Holländer« konfrontieren. Konnte es nicht sein, dass dem Kalorienkoloss dabei ein Äderchen platzte, das von seinem hohen Blutdruck überstrapaziert war?
Ich erteilte mir selber einen Verweis. Wo waren meine honorigen Prinzipien geblieben – Ritterlichkeit, Fairness, Korrektheit? Ich wünschte niemandem etwas Böses, selbst Hamish Hogg nicht. Nicht der Hirnschlag sollte ihn zur Strecke bringen; ich wollte ihn weiter in fairem Wettstreit besiegen. Damn, was war mit mir los?
Der Fliegende Holländer war schuld. Ich hatte mich redlich bemüht, die Geschichte zu glauben, war aber gescheitert. Zwar wusste niemand, wer oder was die »Palermo Express« versenkt hatte – ein Geisterschiff aber kam trotzdem nicht für mich infrage. Dafür dachte ich zu logisch. Gespenster mochten in alten Schlössern mit Ketten klirren oder ächzen, meinetwegen konnte der Klabautermann Matrosen ins Bockshorn jagen und der Erlkönig kleine Knaben zu Tode erschrecken; aber einem Hunderttausendtonner konnten sie alle nichts anhaben. Die Gesetze der Physik erlaubten das nicht.
Die Physik ließ es auch nicht zu, dass ein Geisterschiff den Untergang der »Palermo Express« bewirkt haben konnte. Ein morscher, von Würmern zernagter Uralt–Holzkahn von einhundertfünfzig oder zweihundert Tonnen Wasserverdrängung hätte kaum die vielen Farbschichten des Giganten zu ritzen vermocht. Er wäre schon vom riesigen Wulstbug des Containerschiffes – der kaum kleiner gewesen sein konnte als der gesamte Rumpf des Fliegenden Holländers – in zündholzgroße Splitter zerlegt worden.
Ich war heilfroh, dass ich keine weiteren Angehörigen ertrunkener Crewmitglieder aufsuchen und befragen musste. Ich wühlte nun einmal nicht gerne in den Wunden anderer Menschen; und ich hatte mich immer noch nicht vollkommen von dem Gespräch mit Mrs. Shearer erholt. Solange ich nicht wusste, ob es Wahrheit oder Wahn gewesen war, würde es mich verfolgen.
Ein weiterer kleiner Lichtblick war die Expertise der süddeutschen Universität, die im Besitz der »mitteleuropäischen Eichenchronologie« war und Laxmis Nixenschwanzscheibe analysiert hatte. Demnach stammte das Holz, aus dem die Galionsfigur geschnitzt worden war, von einer Eiche aus dem Spriegelbachtal bei der Stadt Titisee im Schwarzwald. Der Baum war im Jahre 1613 gefällt worden.
Dankenswerterweise war der Analyse ein Kommentar des Leiters der Forschungsgruppe beigefügt, in dem dieser erklärte, wie ein niederländischer Nixenschnitzer um 1600 an eine Eiche aus Süddeutschland kommen konnte.
Ich staunte. Da hatte jemand seine kleinen grauen Hirnzellen benutzt. Laxmi hatte den Testern nichts vom maritimen Ursprung der Holzprobe mitgeteilt. Aber Professor Arno Möller, der Autor der Anmerkungen, hatte aus dem Salzgehalt der Probe und Farbresten an ihrem Rand korrekterweise auf eine nautische Vergangenheit geschlossen.
Im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit, schrieb der Forstforscher in seinem zweiseitigen Begleitbrief, hätten viele Teile Europas unter schwerem Holzmangel gelitten – der Folge jahrhundertelangen Raubbaus in den Wäldern. Besonders in den seefahrenden Nationen sei Holz zur Rarität geworden, weil man wegen der vielen verlustreichen Seeschlachten ständig gezwungen war, neue – hölzerne – Kriegsschiffe zu bauen.
Der Not gehorchend, hätten viele Seemächte ihr Baumaterial von weither bezogen, meist aus den dünn besiedelten, aber dicht bewaldeten europäischen Mittelgebirgen. So seien auch die Pfähle, auf denen man die Lagunenstadt Venedig – viele Jahrhunderte lang eine wichtige Seemacht – errichtet habe, aus Dalmatien und den Alpen herbeigeschafft worden.
Das kleine und bis auf seine Pappelalleen relativ kahle Holland sei ebenfalls von allen nutzbaren Bäumen entblößt gewesen. Also hätten die Niederländer im ganzen Schwarzwald und schließlich auch im Ostseeraum Holz gekauft.
Nachschub war dringend nötig, denn man habe in den Werften wie besessen gearbeitet: Mitte des 17. Jahrhunderts seien mehr Schiffe unter niederländischen Segeln über die Weltmeere gekreuzt, als alle übrigen europäischen Staaten zusammen besaßen, und die Holländer hätten lange als die besten Schiffsbauer der Welt gegolten.
Holz sei aber nicht nur als Universalbaustoff gefragt gewesen, aus dem neben Kriegsschiffen und Handelskoggen auch Burgen, Häuser und Brücken errichtet, Fuhrwerke gebaut und Werkzeuge, ja selbst Trinkbecher, Löffel und Gabeln gefertigt worden seien; auch als Brennstoff sei es heiß begehrt gewesen. Salzsiedereien, Kalkbrennereien, Glashütten, Töpfereien und natürlich Köhler seien ohne Holz nicht ausgekommen. Der Nachschub für Öfen und Werften sei meist per Floß auf dem Rhein herangeschippert worden.
Die Holzknappheit sei so schlimm geworden, dass sie den Bauernkrieg von 1525 ausgelöst und im Dreißigjährigen Krieg die Schweden zum Einmarsch ins holzreiche Pommern bewogen habe.
Der holländische Holzhunger habe sogar Spuren in der Sprache der Lieferländer hinterlassen, hieß es am Ende von Möllers Schreibens. Im Schwarzwald, aus dem die Niederlande kerzengerade Tannen für Masten und krumme Eichen für die gebogenen Spanten bezogen, kenne man heute noch den Begriff »Holländertanne« für besonders geradewüchsige Bäume der Gattung Abies. Abies, nahm ich an, war der »Familienname« der Tanne.
Ich war wirklich beeindruckt: Zwar hatten sich die Deutschen im Krieg auch auf Alderney gehörig danebenbenommen – unter anderem hatten sie während der fünfjährigen Besetzung der Insel ein KZ errichtet, das sie »Lager Sylt« genannt hatten – aber ihre Wissenschaftler waren Spitze. Ohne Möllers Anmerkungen hätte ich wahrscheinlich wieder mit dem Schicksal gehadert, weil ich, statt Lösungen zu finden, immerzu auf neue Rätsel stieß.
Ich rief den Professor an, bedankte mich herzlich für seine Erklärungen und beglückwünschte ihn zu seiner Spürnase. Der Gelehrte war hocherfreut, als ich ihm mitteilte, sein Testobjekt entstamme einer alten Galionsfigur. So etwas habe er vermutet, sagte er. Das Holz alter Segler sei seine Leidenschaft, und wenn ich keine Einwände hätte, so würde er die aufgenommene Spur gern weiter verfolgen – ganz privat und kostenfrei natürlich, aus professioneller Neugier sozusagen. Es gebe ein globales Netzwerk von Dendrologen, dessen geballtes Wissen schon die erstaunlichsten Problemlösungen ermöglicht habe. Oft besitze einer der Kollegen ein Stück Planke eines gescheiterten alten Handelseglers, ein anderer eine Hälfte des Bugspriets, und der dritte den Schreibtisch des Skippers mitsamt dem Logbuch.
Selbstverständlich könne er nach Herzenslust weiter forschen, sagte ich, und versprach, ihm meine Kontaktdaten zu mailen.
Den Reading Room des British Museum suchte ich dieses Mal ohne Aufforderung Laxmis auf. Zwar hatte meine Galionsfiguren–Recherche wenig Nutzbares erbracht; aber einmal wusste ich über den Fliegenden Holländer kaum mehr, als ich vor meinem Besuch in dem Kuppelsaal über die Schnitzwerke am Bugspriet gewusst hatte, und zweitens fiel mir nicht ein, was ich – außer Lesen – im Fall der »Palermo Express« unternehmen konnte. Es gab keine einzige Spur!
Es kostete mich ein wenig Überwindung, am Service Desk nach Literatur zum Thema »Fliegender Holländer« zu bitten. Die Reaktion war jedoch keineswegs spöttisch oder mitleidig, wie ich befürchtet hatte. Stattdessen brachte die Erwähnung des Geisterschiffes schlagartig Leben in das gelangweilte Gesicht der blassen und demonstrativ ungeschminkten jungen Frau am Tresen.
»Der Fliegende Holländer?«, sagte sie eifrig. »Da ist unser Dr. Lustig der Experte. Er befasst sich schon seit fünfzig Jahren mit diesem Thema und kennt jede Quelle. Er ist schon lange im Ruhestand, für uns aufgrund seines reichen Spezialwissens aber als ehrenamtlicher Mitarbeiter unentbehrlich. Ich denke, er wird sich über Ihr Interesse freuen. Einen Augenblick bitte, ich hole ihn.«
Sie kam mit einem sehr kleinen Mann im Schlepptau zurück, der mindestens siebzig Jahre alt sein musste. Ich vermutete, dass er älter war, denn er wirkte teilmumifiziert. Unter der weißen Mähne, die wie der Strandhafer von Alderney auf seiner Schädeldecke wucherte, spannte sich die Gesichtshaut ohne nennenswerte Gewebeunterfütterung über Stirn, Wangenknochen und Kinn. Die Nase sah gefriergetrocknet aus und erinnerte an die einer tausendjährigen Gletscherleiche. Ihre Nüstern waren dünn und transparent wie Pergament und erschienen extrem brüchig. Ein kräftiges Schnäuzen würden sie niemals überstehen, dachte ich.
Richtig lebendig wirkten nur Lustigs rosige, fleischige Ohren und die viel zu prallen und zu roten Lippen seines ein paar Nummern zu groß geratenen Mundes. Lauscher und Lippen sahen wie transplantiert aus und schienen von einem separaten jugendlichen Blutkreislauf versorgt zu werden. Die großen rehbraunen Augen des Bibliothekars lagen tief in ihren Höhlen, brannten aber wie Scheinwerfer und sprühten wie Wunderkerzen. Die buschigen Augenbrauen, die sich in regem Wechsel hoben und senkten, waren knallbraun und ganz sicher gefärbt.
Dr. Lustig wuselte an seiner Kollegin vorbei zum Tresen, lächelte mich freundlich an, wippte leutselig mit den Augenbrauen und sagte mit einem Hexenstimmchen: »Soso, der Fliegende Holländer hat Ihr Interesse gefunden! Sieh mal einer an! Es gibt noch Zeichen und Wunder! Welchem Zweck dient Ihre Recherche, wenn ich fragen darf?« Er hatte einen leichten, aber ziemlich kratzigen deutschen Akzent, der sich vor allem bei seinen Rs und Vs bemerkbar machte. »Ich möchte einen Dokumentarfilm über das Phänomen machen!«, antwortete ich.
Das Lächeln verschwand aus dem dürren Gesicht. »Was, schon wieder einen?« schnappte der kleine Mann ungehalten. Seine Augen sandten Blitze aus. »Wieso machen Sie es nicht wie Ihre lieben Kollegen? Die schneiden aus vier Filmen über das Phä–no–men«, er zog das Wort verächtlich in die Länge, »einen fünften Streifen zusammen, peppen alles mit Spekulation, Esoterik, Unsinnsinterviews mit angeblichen Experten und ein paar digitalen Spukszenen aus dem Computer auf – und fertig ist die nächste Geisterschiff–Doku!«
Er kläffte wie ein Schoßhündchen, dem man die Schokoplätzchen weggenommen hatte. Die Augenbrauen waren in der Stellung »tief« erstarrt.
»Okay«, sagte ich und schluckte mit einiger Mühe einen großen Schwall Ärger über die Frechheit des Bücherwurms herunter, »das sind die Privatsender. Ich«, dem Personalpronomen gab ich eine selbstbewusste öffentlich–rechtliche Betonung, »arbeite für die BBC.« Ich nannte den Namen einer Dokumentarfilmserie, die auf BBC 2 lief und seit Jahrzehnten für ihre Seriosität, gründliche Recherche und journalistische Qualität bekannt war. »Wäre ich hier, wenn ich billige Plattitüden verbreiten wollte wie die Kommerzkanäle?«, fragte ich und spielte den in seinem Berufsstolz Verletzten. »Und hätte ich mich nicht auf das BBC–Archiv beschränken können, wenn ich nicht ganz besondere Präzision im Sinne hätte?«
Das Gesicht hellte sich auf, und die Augenbrauen fuhren erstaunt in die Höhe. »Na, das ist aber eine Überraschung«, sagte der kleine Bibliothekar, »dass die alte Tante Beeb sich für so ein Thema erwärmt! Ihr im Bush House legt doch so viel Wert darauf, politisch korrekt zu sein und den Mehrheitsgeschmack zu treffen – ist euch das Thema nicht zu halbseiden und unseriös?« Das letzte Wort bellte er böse heraus.
»Hängt ganz von Ihnen ab«, sagte ich. Ich tat so cool wie Humphrey Bogart in »Casablanca«, obwohl ich Lust hatte, den kratzbürstigen Gnom an der schrumpeligen Gurgel zu packen und ein wenig durchzuschütteln. Zwar war ich in die Identität eines BBC–Journalisten nur hineingeschlüpft, aber ich fühlte mich trotzdem beleidigt. Der Sender war eine Bastion erstklassiger Berichterstattung, die weltweit ihresgleichen suchte. »Wenn ich harte Fakten und gute Belege finde, kann ich die Abteilungsleiter überzeugen, die, wie Sie ganz richtig vermuten« – ich schenkte ihm ein verbindliches Lächeln – »ein wenig an der Seriosität des Themas zweifeln.«
Lustig nickte wissend und trippelte vor mir her ins Zentrum der Service–Abteilung. Dort, am innersten der drei konzentrischen Tresen–Kreise, könne man besser reden, ohne die Besucher der Bibliothek bei ihrer Lektüre zu stören. Er setzte sich an die konkave innere Seite eines Tresenteilstücks, und ich nahm an der nach außen gewölbten Kundenseite Platz.
»Wenn ich darf, möchte ich zunächst einige allgemeine Bemerkungen zu ihrem Thema vorausschicken«, sagte Lustig und kratzte sich an der transparenten Nase. Er hatte lange, seltsam gewölbte und gebräunte Fingernägel, und ich befürchtete einen Augenblick lang, Gott sei Dank unnötigerweise, die Nüstern würden zerbröseln wie Blätterteig unter der Kuchengabel.
»Wie lange es die Legende, oder sagen wir mal lieber: Die Geschichten von dem Geisterschiff schon gibt, weiß keiner mit Bestimmtheit«, begann der alte Mann. Mit dem aggressiven Unterton hatte seine Stimme auch die Ähnlichkeit mit einem Hündchen verloren, und er klang nun wie ein zwölfjähriger Junge mit Halsentzündung.
»Sie jagt den Seeleuten möglicherweise schon Jahrtausende lang Gänsehaut über den Rücken und kann durchaus so alt wie die Schifffahrt sein. Aber es dauerte bis zum neunzehnten Jahrhundert, bis aus der Fabel von dem Holländer, der dazu verdammt ist, bis zum Jüngsten Tag das Kap zu umrunden, was ihm aber nicht gelingen kann, ein beliebter Stoff für Literaten und Poeten wurde.
Die Viktorianer gaben viel auf Moral, wenn auch meist nur nach außen hin, und so hielten sie es für erbaulich und lehrreich, dass der Kapitän wegen seiner sündigen Angewohnheit, ständig lästerlich zu fluchen, von Gott bestraft wird. Einigen Quellen zufolge soll er wegen der immerfort widrigen Winde und Strömungen Gott selber verflucht haben – für Frömmler ein furchtbarer Frevel.« Er lachte kurz und meckernd. »Ich darf einwenden, dass ich nicht glaube, dass das Geifern eines wildgewordenen Kapitäns Gott in irgendeiner Weise stört.«
»Das ist alles bigotter moralinsaurer pfäffischer Mist!«, schimpfte er weiter. »Lenkt alles von den Tatsachen ab! Diese sind vorhanden, liegen aber nicht auf der Straße, und in der ‚Sun’ stehen sie auch nicht! Doch meinen Sie, auch nur einer der Autoren, die das Thema ausschlachten zu müssen glaubten, hätte sich um die wenigen guten Fakten gekümmert?«
Er beantwortete seine Frage sofort. »Nein, für sie war und ist es eine Legende, ein Märchen, Seemannsgarn, wohlfeiler Stoff, Rohmaterial zum beliebigen Ausschlachten und Verunstalten! So kommt es, dass es Unmengen schauderhafter Romane und Gedichte gibt, gruselig schlechte Dramen, obendrein Gemälde, Zeitschriften– und Zeitungsbeiträge, Hörspiele, Filme und was weiß ich, die in der Regel kaum besser sind.« Lustig bellte wieder wie ein Zwerghund.
»Auch viele sogenannte Große haben über den Fliegenden Holländer geschrieben«, fuhr er fort, »aber leider ebenfalls mehr schlecht als recht. Sie haben die Sache einfach nicht ernst genommen und ganz wie die heutige Presse«, er sah mich giftig an, »den Aberglauben dummer Leser geschürt. Sir Walter Scott konnte die Finger nicht von dem Thema lassen, ebenso Samuel Taylor Coleridge, Thomas Moore, Frederick Marryat, James Fenimore Cooper, William Austin, Herman Melville, William Clark Russell, David Belasco, ähhh ... Heinrich Heine, Wilhelm Hauff, Richard Wagner, Washington Irving und viele mehr.
Manche konnten das Wasser nicht halten. Das Prinzip dürfte Ihnen bekannt sein: Masse statt Klasse.« Lustig grinste mich so frech an, dass ich wieder Lust bekam, ihn zu würgen. »William Johnson Neale hat eine ausgewachsene Romantrilogie über das Phantomschiff verbrochen, Albert Emil Brachvogel sogar ein vierteiliges Epos abgesondert! Selbst Marryats Bestseller hat knapp 150 000 Wörter. Eine Menge Holz! Zeige ich Ihnen gleich!«
Der kleine Mann ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken und trank aus einem Plastikbecher ein Schlückchen Wasser, das gerade eine Krähe erfrischt hätte. »Immer wieder beschrieben sie Schiffe voller Gerippe oder frisch abgeschlachteter Leichen und Laderäume voller Gold und Silber oder Seide und Gewürzen. Einmal steht der Kapitän, von einem Degen an den Mast gespießt, tot mit aufgerissenen Augen da, ein anderes Mal ist er am Leben, aber allein auf dem Pott und nach jahrhundertelanger Wache am Steuerrad zusammengesunken.
Dann wieder umgibt er sich mit einer Gespenstercrew, die tagsüber nach Vampirart mausetot ist, nachts aber säuft und grölt, oder er hat einen weißen Pudel als einzigen Begleiter. Sein Name lautet Hendrick van der Decken, William Vanderdecken, Ramhout van Dam, Bernard Fokke, Kapitän Falkenburg und so weiter. Ein heilloses Durcheinander! Und, wenn Sie mich fragen, ein Haufen Blödsinn.«
Nach einer kurzen Erholungspause wetterte Lustig weiter. »In manchen Büchern setzt er ein Boot aus, um anderen Schiffen Briefe nach Hause mitzugeben, denn er ist ja angeblich dazu verflucht, bis zum jüngsten Tag vor dem Kap zu kreuzen. Wer diese Post berührt, soll des Todes sein. Deshalb nehmen alle Skipper Reißaus, wenn sein Boot angerudert kommt.«
Er schaute mich an. Sein Gesicht war kummervoll. Wäre es möglich gewesen, hätte es Dackelfalten geworfen. »Fragt sich nur, wen er zu Hause mit seinen Briefen erreichen will – nach all der Zeit auf See! Er soll ja seit 1641 vor dem Kap mit den Elementen ringen.«
Wieder ein Amselschluck. »Heine – ich hoffe, Sie haben von dem schon mal gehört, ein deutscher Dichter! – hat zwar den Zeitfaktor berücksichtigt, als er 1834 in seinen ‚Memoiren des Herrn von Schnabelowopski’ schrieb, dass«, Lustig schloss seine Feueraugen, als könne er so besser zitieren, »’zuweilen der späte Enkel einen Liebesbrief in Empfang nimmt, der an seine Urgroßmutter gerichtet ist, die schon seit hundert Jahren im Grabe liegt’. Hä!«
Er hustete rasselnd, und seine Augen flammten böse. »Aber da hat Heine vergessen, dass nie jemand die Post weiterbefördert hat und sie demnach auch nicht angekommen sein kann! Außerdem hat die Uroma, als sie noch jung und frisch war, ja wohl nicht allzu lange auf ihren am Kap herumirrenden Liebsten gewartet, hähä, sonst hätte sie ja keine Urenkel!? Ich nehme an, Urenkel sind das, was Heine mit ‚späte Enkel’ meint, oder? Hähähä! Verlorene Liebe – das Schicksal der Matrosen!«
Lustigs gedämpftes Hohngelächter ging in Husten über, und der Bibliothekar netzte seine Kehle mit ein paar Kubikzentimetern Wasser. »Ob Heine das im Sinne hatte, als er schrieb, dass der Fliegende Holländer nur ‚durch die Treue eines Weibes’ erlöst werden könne? Da gibt es nur ein Problemchen: Welche Frau kann dem Kapitän treu sein, wenn alle seine Bekannten, auch die weiblichen, längst zu Humus geworden sind und ihn niemand mehr kennt?« Er sah mich hilfesuchend an. »Immerhin hat Wagner, der das Motiv der Seelenrettung durch die Liebe einer Frau von Marryat übernahm, das Problem erkannt und gelöst: Sein Vanderdecken hatte alle sieben Jahre Landgang, um Damenbekanntschaften zu machen.
Die Rolle der liebenden Frau spielt Senta, die Tochter des Kapitäns Daland. Der hat sich mit seinem kleinem Kahn vor einem Sturm in einen norwegischen Hafen geflüchtet. Direkt daneben wirft das Geisterschiff Vanderdeckens mit seinen blutroten Segeln und schwarzen Masten Anker. Aber weder Daland noch seine Crew nimmt am gespenstischen Aussehen des Geisterschiffes Anstoß! Nein, es fällt ihnen nicht mal auf! Hähäha!« Lustig keckerte wie ein geiles Eichhörnchen.
»Und bei Marryat versucht Vanderdeckens Sohn Philip, den Vater mittels einer Reliquie, eines Splitters vom heiligen Kreuz, den die im ersten Kapitel melodramatisch sterbende Mutter in einem Goldamulett um den Hals getragen hatte, vor der ewigen Verdammnis zu erretten.« Lustig seufzte tief. »Grauenhaft! Moralquark und Religionskitsch!«
Er senkte den Blick und schüttelte ein paar Sekunden lang resigniert den Kopf. »Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist?«, fragte er dann müde. »Keiner der Autoren hat auch nur eine Minute lang recherchiert! Recherchiert!« Er betonte jede einzelne Silbe des Wortes. »Jeder schreibt von jedem ab, wie Wagner von Marryat. Für mich heißt das, dass keiner der Herren wirklich glaubte, was er zu Papier brachte! Märchen muss man nicht nachprüfen!«
Lustig machte eine Pause. Offenbar wollte er seine Erbitterung abklingen lassen, die mir stark übertrieben schien. Er war doch nur ein Bibliothekar, der sich mit dem Thema »Fliegender Holländer« befasste; er tat aber so, als sei er im alleinigen Besitz der Wahrheit über das Geisterschiff oder habe es gar schon selber zu Gesicht bekommen. Aber das konnte natürlich nicht sein.
»Ich habe versucht, die kolportierten Sichtungen zu dokumentieren; aber da stößt man schnell an seine Grenzen. Wie kann ich Kapitän Marryat fragen, ob er das Geisterschiff tatsächlich gesehen hat, wie überall berichtet wird? Der ist lange tot – ziemlich genau 160 Jahre!
Auch der Schriftsteller Nicholas Monserrat soll den Phantomsegler vor dem Kap gesichtet haben – 1942 als dritter Offizier eines britischen Kriegsschiffes namens HMS Jubilee. Ich habe ihn 1965 und 1966 fünfmal angeschrieben – vergeblich. Keine Antwort! Er starb 1979, ohne Stellung genommen zu haben. Man findet die HMS Jubilee nicht mal in den Archiven, die ansonsten auch den allerkleinsten Hilfsminensucher der Royal Navy auflisten.
Aber die Sache ist überall zu lesen, in jeder Sprache! Jetzt weiß ich nicht, ob Monserrat nur zu faul war, um mir zu antworten, oder ob er ein schlechtes Gewissen hatte, weil die ganze Sache nur ein PR–Geck war, der seine Bücher verkaufen sollte.« Er knurrte erbittert. »Früher hatten Lügen kurze Beine. Heute gibt’s das Internet; da tragen sie Siebenmeilenstiefel!
Nicht anders ist es mit den Berichten, dass deutsche U–Boote während des Zweiten Weltkrieges ihrem Großadmiral Dönitz mehrfach Begegnungen mit dem Fliegenden Holländer gemeldet haben sollen. Dönitz«, Lustig schaute mich an, um zu sehen, ob ich folgen konnte, »war der nette Herr, der die U–Boote zu Hunderten in den Tod schickte – auch, als der Krieg längst verloren war und sie gegen unser Radar und Sonar nicht mehr den Hauch einer Chance hatten. Er selber hielt große Reden und saß am sicheren Schreibtisch in irgendeinem Bunker.
Ich habe in einem U–Boot–Archiv in Norddeutschland angerufen, um mich zu erkundigen, was an den angeblichen Sichtungsmeldungen wahr sei. Weil die Leute dort, die sehr kenntnisreich sind, aus den Kriegen aber offenbar nichts gelernt haben und das sinnlose Gemetzel zu einem Heldenepos zu verklären suchen, habe ich zwar deutsch gesprochen, es aber vorgezogen, mich nicht mit meinem wirklichen Namen zu melden, der ein bisschen zu jüdisch klingt. Ich habe mir einen Scherz erlaubt und mich Himmler genannt – Herbert Himmler!« Er lachte böse.
»Aber das hat nichts genutzt – außer, dass man mit mir geredet hat. Doch man mochte die Frage nicht. Es habe sich um ein Kodewort gehandelt, beschied man mir lapidar. Heldenhafte deutsche U–Bootkapitäne, die für Dönitz mit offenen Augen in den Tod gingen, das klang durch, sahen keine Gespensterschiffe!« Lustigs lebenstrotzende Ohren wurden vor Verachtung rot.
»Heute haben wir ein ähnlich gelagertes Problem«, fuhr er fort. »Niemand, der bei Verstand ist, wird dem Logbuch, seinen Vorgesetzten oder irgendjemand sonst anvertrauen, dass er das – oder ein – Geisterschiff beobachtet hat.« Er kläffte erbost. »Meinen Sie, auch nur einer der Kapitäne oder Offiziere der dicken Tanker und Containerfrachter, die nicht durch den Suezkanal passen und deshalb das Kap der Guten Hoffnung umrunden müssen, würde ein Sterbenswörtchen sagen, selbst wenn er drei Tage mit dem Fliegenden Holländer im Konvoi gefahren wäre?«
Er nippte erneut an dem Plastikbecher. »Ich habe schon 1960 an die Reederei des niederländischen Frachters ‚Straat Magelhaen’ geschrieben, dessen Master, ein gewisser P. Algra, im Jahre 1959 beinahe mit dem Fliegenden Holländer kollidiert sein soll. Aber auch hier kam keine Antwort, und Mijnheer Algra war nicht aufzutreiben. Möglicherweise hatte man ihm einen Maulkorb verpasst – oder ihn so verlacht, dass er nichts mehr mit Geisterschiffen zu tun haben wollte.
Aber nicht verzweifeln,« fuhr er fort. »Es gibt, wie erwähnt, gute Quellen, deren Authentizität niemand anzweifeln kann. Ich bringe Ihnen die beste. Die Sichtung des Geisterschiffes wird hier von höchstem Munde geschildert, von einer Zeugenschar bestätigt, von der Royal Navy beglaubigt, von der Kirche abgesegnet und quasi offiziell der Königin mitgeteilt. Was wollen Sie mehr?« Er kläffte begeistert, und in seinen Augen entzündeten sich Feuerräder. »Einen Augenblick!« Er stand auf und huschte davon.