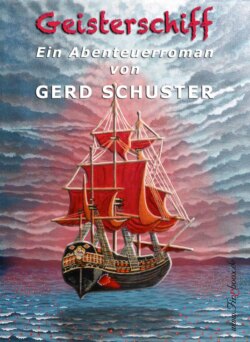Читать книгу Geisterschiff - Gerd Schuster - Страница 6
Kapitel 3
ОглавлениеDie Geheimnisse der Galionsfiguren
oder
Ein mehr als mysteriöses Polymer
Ich verwünschte die Fluke aus dem Grenzgebiet zwischen Indischem Ozean und Atlantik in den nächsten Wochen beinahe täglich. Statt bei der Beantwortung von Fragen zu helfen, die mich der Klärung des Schicksals der »Palermo Express« näher brachten, lud sie mir eine ganze Anzahl neuer, unlösbar scheinender Rätsel auf.
Um halb sechs Uhr morgens waren wir im Fischereihafen von PE eingelaufen. Sieben Stunden später war ich mit meinem Fund schon auf dem Rückflug. Ich hatte mich rasiert, die vom Sturz in die Fische feuchte Hose gewechselt, den Meerjungfrauenschwanz mit Hilfe von Botterfass in drei oder vier Lagen Luftpolsterfolie gewickelt, in Packpapier eingeschlagen, mit vielen Metern dicken braunen Klebebands verschnürt und wie einen Koffer eingecheckt.
Der Flug war kein Zuckerschlecken: Zuerst düste ich in knapp zwei Stunden nach Johannesburg, wo ich über sechs Stunden totschlagen musste, denn der Jumbo nach Heathrow hob erst um 20.40 Uhr ab. Mir juckte es am ganzen Körper, weil ich so lange nicht geduscht hatte, und ich hoffte, dass ich nicht allzu sehr stank. Aber ich hatte eine unüberwindliche Aversion gegen die Airport–Duschen und gegen alle Waschräume, die von vielen anderen Menschen genutzt wurden. Wahrscheinlich war das ein Mitbringsel aus Eton. In der berühmten Public School war ich bei der Körperpflege niemals alleine gewesen. Ich hatte es gehasst, bei der Morgentoilette keine Privatsphäre zu haben, begafft, nassgespritzt oder angerempelt zu werden.
Aber meine Mitreisenden hatten Glück. In der Business Class blieb der Sessel neben mir leer.
Ich machte mir wenig Sorgen, dass das Geschenk der See beschädigt werden könnte. Auf der langen Rückfahrt mit der lahmen »Starina« hatte sich gezeigt, wie widerstandsfähig das antike Teil war, das wegen seiner Kunststoffimprägnierung eigentlich nicht antik sein konnte. Da es Schläge mit einem kleinen Hammer aushielt, ohne zu zersplittern, würde es sicher auch einen Sturz von einem Gepäckwagen der South African Airways verkraften.
Für den Fall, dass SAA meinen Fund verlor, hatte ich in mühsamer Arbeit ein Häufchen von Holzspänen und einige Krümel des Lacks von der Bruchstelle abgeraspelt oder abgestemmt. Ich verwahrte die Proben in einem kleinen Plastikbeutel in der rechten Sakkoinnentasche. Damit sollten wenigstens ein paar chemische Analysen möglich sein. Aber SAA verlor die Fluke nicht, und ich vertraute sie Laxmi, die mich morgens um halb acht in Heathrow abholte, zur Untersuchung an.
Das erste Ergebnis lag sehr bald vor: Der Nixenschwanz war aus Eichenholz geschnitzt. Eine Altersbestimmung mittels der C14–Methode, wofür meine Späne genügten, ergab eine Woche später, dass das Holz aus den Jahren 1591 bis 1620 stammte.
Laxmi erklärte mir, dass man mittels eines anderen Datierungsverfahrens mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur das exakte Jahr, in dem die Eiche gefällt worden war, sondern auch ihren Herkunftsort feststellen konnte. Die sogenannte Dendrochronologie beruhte auf der Tatsache, dass man an den Jahresringen der Bäume ablesen konnte, welche Witterung während ihrer Lebenszeit geherrscht hatte. In feuchten und warmen Jahren entstanden üppig breite, in dürren oder zu kühlen Jahren verhungert schmale Jahresringe. Da sämtliche Buchen, Eichen oder Pappeln eines bestimmten Gebietes annähernd identischen Lebensbedingungen ausgesetzt waren, ließ sich bei allen diesen Bäumen das gleiche charakteristische Muster von breiten und schmalen Ringen finden. Es war eine Art natürlichen Strichcodes, ein unverwechselbarer Fingerabdruck der Region.
Wissenschaftler hatten für einige Baumarten fast lückenlose Jahresringmuster in ihren Datenbanken, die – wie beispielsweise die »mitteleuropäische Eichenchronologie« – unglaubliche zehntausend Jahre zurückreichten. Diese Datensammlungen konnten aus den erwähnten Gründen Auskunft darüber geben, ob eine Eiche in den englischen Cotswolds, im Bayerischen Wald oder in den Ardennen gestanden hatte. Sehr wahrscheinlich fiel die Datierung mithilfe der Dendrochronologie viel genauer aus als mit der C14–Methode.
Das Problem war, dass man für die Herkunfts– und Altersanalyse eine dünne Baumscheibe oder einen Bohrkern benötigte. Bevor Laxmi aber ein Stück von dem Meerjungfrauentorso absägen konnte, musste sie die Beschichtung enträtseln, und das war weitaus schwieriger als erwartet. Sechs Kunststofflabors hatten zwei völlig gegensätzliche Beurteilungen geschickt – und vier Absagen. Die Institute hatten mitgeteilt, dass ihnen diese Art Plastik unbekannt war.
In ihrer Ratlosigkeit hatte Laxmi eine letzte Probe an einen weltberühmten organischen Chemiker und Polymerisationsexperten der University Oxford geschickt, den sie von Tagungen her persönlich kannte.
Bei der forensischen Untersuchung der Bruchstelle im Fischschwanz der Meerjungfrau hatte sich herausgestellt, dass der Rücken der Figur sehr wahrscheinlich auf ganzer Länge durch Nut und Feder mit dem Schiffsbug verbunden gewesen war und nur der gewundene letzte Teil des Nixenrumpfes und die Fluke frei abgestanden hatten. Der einstmals mit Blattgold verzierte und in verschiedenen Grün– und Blautönen bemalte Leib war exakt am Ende der Verkeilung mit dem Kiel gebrochen. Ein paar Millimeter der Feder waren erhalten.
Neben der mechanischen Belastung durch Wellen und Wind hatten starke Fraßschäden durch Holzschädlinge zu der Fraktur beigetragen. Die Kerbtiere – oder vielmehr ihre Larven – hatten die exponierte Stelle löchrig wie Schweizer Käse und mürbe wie Knäckebrot gemacht. Anhand des »Schadbildes« sowie Form und Größe der Ausschlupflöcher hatte Laxmi drei »schuldige« Insektenarten zweifelsfrei identifizieren können: Den großen Eichenbock, den bunten Nagekäfer und den gewöhnlichen Werftkäfer.
Sie war wirklich gut! Sie liebte die Perfektion, ganz wie Maharaja Sawai Jai Singh II!
Es gab Spuren, die darauf hindeuteten, dass man wohl schon vor längerer Zeit – möglicherweise waren es Jahrhunderte – den Schwachpunkt erkannt und versucht hatte, die freistehende Partie der Galionsfigur zu stabilisieren. Dazu hatte man ihr oberhalb und unterhalb der späteren Bruchstelle je einen Ring aus Schmiedeeisen angelegt und beide mit Eisenstäben verbunden. Röntgenbilder hatten gezeigt, dass eine Handbreit von der Bruchstelle die Schäfte von vier geschmiedeten Dreikantnägeln aus Eisen im Holz steckten. Vermutlich war das Korsett sehr bald vom Salzrost zerfressen worden und abgefallen.
Die Kunststoffhülle hatte trotz ihrer Widerstandskraft den Verlust der Nixenfluke nicht verhindern können, weil sie ausgerechnet in der Problemzone zu dünn und teilweise unvollständig war. Ein Großteil der flüssig aufgetragenen Schutzschicht war nämlich in den Bohrkäfergängen versickert und hatte so keinen Panzer auf der Außenhaut bilden können.
Laxmi wollte nach Möglichkeit abklären, wie lange die Fluke schon im Wasser getrieben hatte, als sie ins Netz der »Starina« geriet. Aber auch das sei erst möglich, sagte sie, wenn die Art des Überzugs enträtselt sei.
Das Warten auf das Urteil des Professors zerrte an meinen Nerven. Was konnten wir tun, wenn auch er überfragt war? Nachrichten von Hogg beunruhigten mich zusätzlich. Dem kugelrunden Kollegen war offenbar ein Coup geglückt. Eine von Laxmis Freundinnen aus Rajasthan, die – natürlich rein zufällig – bei WW&W arbeitete, hatte berichtet, Hoggs Jacht habe im fraglichen Seegebiet um ein Haar einen Container gerammt, der dicht unter der Wasseroberfläche getrieben sei. Hogg habe ihn bergen lassen, und es habe sich erwiesen, dass er nicht zur Ladung der »Palermo Express« gehört habe, sondern von einem anderen Frachter stammte. Hatte sich doch eine Kollision ereignet?
Ich wusste nicht, welche Fortschritte Hogg bei der Identifizierung des anderen Containerschiffs gemacht hatte. Eigentlich war das ein Kinderspiel, denn jede der Stahlkisten trug an der Tür, oft auch an der Seitenwand, eine sechsstellige Registriernummer, der eine »Prüfziffer« folgte, die mittels eines überraschend komplizierten Verfahrens errechnet worden war.
Dazu kam ein »Eigentümerschlüssel« und ein »Produktgruppenschlüssel«, die aus Buchstaben bestanden. Alles zusammen ergab ein weltweit einmaliges, unverwechselbares Kennzeichen. Mithilfe dieses »Personalausweises« wusste man stets, welcher Container wann wo war – natürlich auch, auf welchem Schiff. Sollte der zweite Frachter ebenfalls verschwunden sein, hatte der Dicke den Fall fast schon gelöst.
Eigentlich war es so gut wie unmöglich, dass ein Containerriese von den Dimensionen der »Palermo Express« oder irgendein anderer großer Pott, der ihr bei einer Kollision hätte gefährlich werden können, abhanden kam, ohne dass ich davon erfuhr. Denn ich las jeden Morgen »Lloyds List«. Das Blatt, das vor 270 Jahren im Londoner Kaffeehaus des Edward Lloyd aus der Taufe gehoben worden war, war mein Brevier. Es brachte nicht nur Schiffsmeldungen aus rund 1500 Häfen; es listete im Rahmen des »Lloyds Casuality Reporting Service« auch jede Havarie und jeden Untergang ernstzunehmender Schiffe weltweit auf. Wenn ich unterwegs war, bekam ich die wichtigsten Daten aus der Zeitung per Mail zugeschickt. Zuerst immer den Unfallbericht.
Aber ich war dennoch nervös. Es gab nichts, das es nicht gab, und man hatte schon Pferde kotzen sehen. Ich wäre ruhiger gewesen, wenn ich mehr zu bieten gehabt hätte. Aber womit konnte ich aufwarten? Mit nichts! Ich hatte nichts in der Hand als das Schwanzstück einer Schnitzerei, die um 1600 entstanden war, aber in einer modernen Plastikhülle steckte, die niemand analysieren konnte. Mit dem Containerriesen, den ich suchte, hatte die Fluke der Meerlady wahrscheinlich nicht das Geringste zu tun. Oder besser: Sehr wahrscheinlich. Es war ein Trauerspiel.
Wie immer schaffte es Laxmi, mir den Kopf zurechtzurücken. Nach der Liebe lagen wir uns in ihrem Bett in den Armen, genau observiert von dem zufrieden schnurrenden Admiral Nelson. Meine Prinzessin fühlte, dass meine Gedanken nur allzu bald wieder zur »Palermo Express« abzudriften begannen. Obwohl kastriert, war Nelson mehr bei der Sache als ich. »Glaube an deine Fähigkeiten, an deinen siebten Sinn und an Ganesha, Jim«, flüsterte Laxmi zärtlich. »Er hilft eigentlich immer. Aber er stellt Menschen gern ein wenig auf die Probe. Er will sehen, ob du seiner Unterstützung würdig bist.«
Sie gab mir einen kleinen Kuss auf die Wange und fuhr mir mit ihren langen schlanken Fingern zärtlich durchs Haar. Das beruhigte ungemein. Aber sobald sie damit aufhörte, begann ich wieder zu grübeln. Was war, wenn der elefantenköpfige Gott nicht zu mir, sondern zu Hamish Hogg hielt – aus Solidarität unter Übergewichtigen? Oder wenn der Dicke den Fall schon gelöst hatte? Wenn gleich das Handy klingelte und mich Michael Morris von Lloyds auslachte?
Laxmi erriet meine Gedanken. Sie gab mir einen Klaps und sagte: »Ganesha hält dich nicht zum Narren. Er ist nicht falsch. Er hat dir ein mentales Bild geschickt, und du hast die Fluke, die er dir gezeigt hat, aus dem Meer gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sie finden würdest, war geringer als die eines Volltreffers im Lotto. Er hat dir ihre Position gezeigt und dafür gesorgt, dass du mit einem Fischer rausfährst, der sein Netz auswirft. Das war ein Riesenhaufen Glück, und der Fund muss einen Sinn haben – welchen, kriegen wir noch raus. Er hat dir geholfen, und er wird dir weiter helfen.«
Wir kuschelten zwanzig Minuten, ohne etwas zu sagen. Admiral Nelson war ins Bett gekrochen und schmiegte sich an Laxmis Oberschenkel. Er war durch und durch Ästhet. Ich dachte über die Worte meiner Prinzessin nach. Meistens hatte sie ja recht, auch wenn es mir manchmal schwer fiel, mir – und ihr – das einzugestehen.
»Jim?«, flüsterte sie schließlich. »Darf ich noch etwas sagen?« »Aber natürlich!«, antwortete ich. Was wohl jetzt kam? «Mit Ganeshas Beistand«, sagte sie, »hast du ein Teil einer Galionsfigur gefunden. Aber was weißt du über Galionsfiguren? Meinst du nicht, er will, dass du dich informierst?«
Ich war verblüfft. Es lag so nahe, aber ich hatte nicht daran gedacht. Laxmi hatte recht: Ich wusste über Galionsfiguren nur, dass sie früher am Bug von Segelschiffen befestigt worden waren. Ich hatte so wenig Ahnung, dass ich nicht mal wusste, was es über sie zu wissen gab. Damn, es war gut möglich, dass ich Ganeshas Fingerzeig nicht verstand, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.
Ich packte Laxmi, zog sie auf mich und drückte sie. Verärgert über die Ruhestörung hechtete Admiral Nelson aus dem Bett. »Prinzessin aus dem Morgenland, du bist ein Schatz!«, sagte ich. »Was würde der bekannte Ermittler Jim Cunningham von MIA ohne dich anfangen? Er müsste bei Burger King Pommes frites eintüten oder im Oberhaus Maulaffen feilhalten – was beides ähnlich unerfreulich ist! Morgen gehe ich ins British Museum!«
Natürlich hätte ich auch im Internet surfen können, aber mir war nach »richtigem« Lesen in echten Büchern aus angegilbtem Papier zumute, die würzig nach altmodischer Gelehrsamkeit, viktorianischer Schicklichkeit und längst vergangener Gründlichkeit rochen. Ihnen entwich eine besondere Art von Staub, der auf ganz eigentümliche Art und Weise in der Nase kitzelte – so, als wolle er das Hirn anregen. Es gab kaum einen Ort in der Welt, wo man sich in edlerer und feinsinnigerer Atmosphäre bilden konnte.
Auf jeden Fall war diese Art der Bildung erfreulicher, als sich im Internet, permanent von Pop–up–Werbung belästigt und von einem aufmerksamkeitsheischenden Sieben–Kilo–Kater bedrängt, durch unzählige besserwisserische, halbwahre oder komplett schwachsinnige Beiträge zu arbeiten. Die aber waren mir sicher, wenn ich als Suchwort »Seejungfrau« eingab.
So stand ich am nächsten Tag um fünf vor zehn mitten in einem schnatternden Schwarm japanischer Touristen vor dem Haupteingang des British Museum in der Great Russell Street und harrte auf Einlass. Ich ging schnurstracks in den Lesesaal – und blieb geblendet stehen.
Die riesige Kuppelhalle war seit meinem letzten Besuch renoviert worden und erstrahlte in beinahe indischer Pracht. Über den drei Stockwerke hohen Bücherregalen thronten die neugotischen Kathedralenfenster. Von ihnen strebten viele schmale Dekorsegmente wie die Blütenblätter einer monumentalen geschlossenen Kugelblume himmelwärts zu dem großen runden Oberlicht im Kuppelzentrum. Alles war in den Farben Vergissmeinnichtblau, Kondensmilchbeige und Gold gehalten.
Diesen Tempel des Wissens »Reading Room« (Lesezimmer) zu nennen, war ein Superlativ britischer Untertreibungssucht.
Am zentralen Service Desk, einem Arrangement von halbrunden Schaltersegmenten, die zusammen drei konzentrische Kreise bildeten, bestellte ich Literatur zum Thema Galionsfiguren. Mit drei Wälzern setzte ich mich an einen der Lesetische, an denen – als hier noch die British Library untergebracht war – Gandhi, Lenin, Kipling, Marx, Wells und viele andere Größen der Weltgeschichte studiert hatten. Vielleicht auf dem gleichen Platz.
Die Bücher waren dermaßen interessant, dass ich kurz vor halb sechs Uhr abends von einem höflichen Mitarbeiter des Lesesaals daran erinnert werden musste, dass der Reading Room schloss. Ich hatte fünf Bücher über die Geschichte der Seefahrt und zwei Bildbände voller Galionsfiguren durchgearbeitet und mir fünfzehn Seiten Notizen gemacht. Ich fuhr sofort nach Hause und tippte, obwohl halb verhungert und verdurstet, eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte in den Computer.
Das Wort Galionsfigur kam vom spanischen Galion (Balkon) und bezog sich auf einen balkonähnlichen Vorbau am Bug, den verschiedene Arten von Segelschiffen zeitweilig besessen hatten. An ihm war oft die Galionsfigur befestigt gewesen.
Es gab Galionsfiguren, seit Menschen zur See fuhren. Ihre Vorläufer waren Augen, die chinesische Schiffer viele Tausend Jahre vor Christus an den Bug gemalt hatten, weil sie ihre Segler als lebende Wesen betrachteten und glaubten, sie benötigten Augen, um ihren Weg durch die Wasserwüste der weitgehend unbekannten Meere zu finden. In vielen Teilen Asiens gab es bis heute keinen Fischerbootsbug – und keine LKW–Motorhaube – ohne Augen.
Die alten Ägypter waren weiter gegangen: Sie hatten ihre Barken in die Obhut scharfäugiger heiliger Vögel gegeben, die am Schiffsschnabel Ausschau gehalten hatten. Die Phönizier hatten den Bug ihrer Galeeren mit Pferdeköpfen, hölzernen Götterstatuen, geschnitzten Ebern, Löwen und Schlangen verziert. Man hatte gehofft, die Kraft und Schnelligkeit, Orientierungsgabe, Wehrhaftigkeit und List dieser Tiere auf das Schiff übertragen zu können und den Segen der Götter auf es zu ziehen.
Nicht anders waren die Griechen, Römer und Karthager verfahren. Sie alle waren überzeugt gewesen, die Galionsfiguren könnten die Wind– und Wassergeister besänftigen, das Schiff vor Sturm, Untiefen und Feinden schützen und es wohlbehalten in den Heimathafen zurückleiten.
Die Boote der Wikinger und Normannen hatten Köpfe von Drachen, Stieren und Seeschlangen vor sich hergetragen. Sie sollten Feinde erschrecken und deren Schutzgeister in die Flucht schlagen.
Damals und auch in späteren Jahrhunderten hatten die Seeleute fest an die Zauberkräfte der Galionsfiguren geglaubt. Es gingen so viele Segler auf den Meeren verloren, dass den Matrosen nur ihr Aberglaube den Mut gegeben hatte, immer wieder anzuheuern und ihr Leben zu riskieren.
Die Galionsfigur war »Seele«, Schutzengel und Identitätssymbol jedes Schiffes gewesen – und sein guter Geist. Die Crews hatten die Schnitzwerke manchmal beim Stapellauf mit Wein »getauft«, auf See mit ihnen gesprochen, sie um mehr oder weniger Wind gebeten, und sich um ihr Wohl gesorgt. Es war vorgekommen, dass Matrosen nach dem Stranden ihres Schiffes oder vor einer Selbstversenkung mitten in einer Seeschlacht unter Einsatz ihres Lebens die Galionsfigur geborgen hatten. Denn eine Beschädigung oder der Verlust des Schutzpatrons war ein böses Omen und bedeutete Untergang, Leid und Tod.
Als 1794 in einem Seegefecht mit französischen Einheiten der Galionsfigur der britischen Fregatte »Brunswick«, die den Herzog von Braunschweig im Schottenrock darstellte, der Hut vom Kopf geschossen wurde, geriet die Mannschaft in Panik. Eilig setzte man der barhäuptigen Holzfigur den Galahut des Kapitäns auf – und gewann das Gefecht.
Im 16. und 17. Jahrhundert war die Galionsfigur an den Bugspriet gewandert, weil durch das sogenannte Vorderkastell am Bug der Schiffe kein Platz mehr war. Vom 17. bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war der Löwe als Bugschmuck sehr in Mode gewesen. Später wurde er aber durch zeitbezogene Schnitzereien – die während der französischen Revolution gebaute Fregatte »Carmagnole« trug eine Guillotine vor sich her – oder Figuren ersetzt, die den Namen des Schiffes repräsentieren sollten. So zierten Reeder, Ritter und Kaufleute in Bratenrock und Zylinder die Schnauzen der Koggen, Briggs und Barks.
Während Frauen an Bord nach Überzeugung der Seeleute Unglück brachten, schworen die blauen Jungs Stein und Bein, dass nackte oder zumindest barbusige Damen als Galionsfiguren die Kraft besaßen, Wind und Wellen zu besänftigen. Meerjungfrauen mit Fischschwanz und nackten Brüsten waren sehr beliebt. In den Bildbänden fand ich Dutzende von Nixen, deren Fischschwanz in fast allen Einzelheiten meinem Fund glich.
Obwohl die Crews nach wie vor sehr abergläubisch waren, dienten die Galionsfiguren in späteren Jahren immer mehr dem Renommee. Weil Handelssegler den Reichtum des Eigners, Kriegsschiffe die Macht des jeweiligen Staates repräsentieren sollten, geriet der Bugschmuck oft so prächtig, groß und schwer, dass sein Gewicht die Seetüchtigkeit der Schiffe und ihre Segeleigenschaften beeinträchtigte. Besonders im Barock wogen die Schnitzereien manchmal mehrere Tonnen.
1747 ordnete das britische Marineamt an, dass Galionsfiguren statt aus Eiche aus leichtem Weichholz wie Kiefer zu fertigen seien. Man verwendete aber auch Teak, das widerstandsfähiger gegen Holzschädlinge war.
Weil Dampfschiffe ohne Bugspriet die Segler zunehmend verdrängten, kam das Ende der Galionsfiguren. Ab 1894 fehlten sie auf großen englischen Kriegsschiffen. Kleinere Einheiten behielten sie bis zum Ersten Weltkrieg. Das letzte Schiff der Royal Navy mit einer Galionsfigur war HMS »Espeigle«, die 1923 abgewrackt wurde.
Ich las meine Zusammenfassung noch einmal durch und mailte sie Laxmi. Die Lektüre im Reading Room war zwar spannend gewesen, vor allem wegen der marine– und kulturhistorischen Details und der oft recht zünftigen Anekdoten; aber weitergebracht hatte mich der Tag im British Museum nicht.
Ich rief Laxmi an. Bevor ich meinen Frust loswerden konnte, sagte sie, Professor Edward Hoare aus Oxford habe sich gemeldet. Der Chemiker habe recht aufgeregt geklungen und uns für morgen um 13.00 Uhr in sein College bestellt, das weltberühmte CCC. Er habe das Rätsel gelöst, wolle uns das Resultat persönlich mitteilen – und unbedingt wissen, woher der Kunststoff stammte.
Am nächsten Morgen frühstückte ich um Viertel vor neun in trauter Zweisamkeit mit Admiral Nelson, der mir wie gewohnt mit blitzschnellen Pfotenwischern noch nicht aufgeweichte Corn Flakes aus der Schüssel stibitzte und glückselig die restliche Milch schlabberte. Schon um halb zehn holte ich Laxmi in Kensington ab, denn wir wollten uns unter keinen Umständen verspäten und den Termin verpassen. Dazu war er zu bedeutsam. Und man wusste ja nie, wie lange man wo auf der Autobahn steckenblieb.
Wir kamen zwar überraschend gut aus der Londoner Innenstadt heraus – nicht mal in Earls Court oder auf der Cromwell Road gab es Staus. Es erwischte uns erst am Chiswick Flyover, wo die A4 in die Autobahn M4 mündet, am Übergang der M4 in die M25 und an deren Vereinigung mit der M40. Das Übliche eben, kein Lkw–Unfall mit Vollsperrung oder ähnliches. Deshalb waren wir viel zu früh in Oxford – von meiner Wohnung in Chelsea war es ja auch nur ein Katzensprung von sechzig Meilen.
So bummelten wir eine Stunde durch das Städtchen, das teilweise einem mittelalterlichen Freilichtmuseum gleicht, schlürften einen italienischen Espresso und bewunderten dann die Säulenhallen und die tempelartigen Gebäude des Christ Church College, wo Professor Hoare residierte und als Tutor wirkte. Pünktlich holte er uns an der malerischen Pforte ab und führte uns durch einen prachtvollen Innenhof, eine Reihe altehrwürdiger Klostergänge und über mehrere Schnörkeltreppen in sein bis auf Rechner, Drucker und Scanner gleichfalls museumsreifes Studierzimmer.
Ich hatte mit einem streng vergeistigten, weißhaarigen Hutzelmännchen gerechnet und war überrascht, wie jung Hoare war. Er sah eher wie ein ewiger Student aus denn wie ein renommierter Lehrstuhlinhaber, war mit knapp 40 höchstens drei Jahre älter als ich, etwa 1,85 m groß und sportlich. Er trug verwaschene Jeans, ein weißes Hemd ohne Schlips und einen marineblauen Blazer mit Goldknöpfen, hatte einen schwarzen Lockenkopf, muntere dunkle Augen und lachte viel. Die Studentinnen schmolzen sicher vor ihm dahin wie Vanilleeis im Backofen.
Hoare machte Tee und schenkte uns ein. Dann wurde er ernst. »Was sie mir da zur Untersuchung geschickt haben«, sagte er gewichtig und schaute Laxmi an, »war gar nicht einfach zu analysieren. Wir haben erstklassige Leute am Institut für organische Chemie und die besten Geräte, aber solch ein Polymer hat noch keiner von uns zu Gesicht bekommen. Wir waren drauf und dran, die Flinte ins Korn zu werfen, aber dann haben wir es doch geschafft. Das Material ist nämlich extrem – äh«, er suchte nach einem Wort, «äh, ungewöhnlich, und zwar eher physikalisch als chemisch!« Er machte eine Pause und schaute uns beide an. »Ich würde zu gern wissen, wie sie an die Substanz gekommen sind.«
Bevor ich etwas sagen konnte, fuhr Hoare fort. »Aber lassen Sie mich zuerst berichten, was wir entdeckt haben. Für Sie, Mr. Cunningham«, – er warf mir einen raschen Blick zu – »werde ich versuchen, die chemischen Fakten so leicht fasslich wie möglich darzustellen. Aber die Vereinfachung hat natürlich Grenzen.«
»Also,« der Professor nahm einen Schluck aus seiner Teetasse, »viele Kunststoffe entstehen durch einen Prozess, den wir Polymerisation nennen. Dabei fügen sich, meist mit ein wenig technischer Nachhilfe, niedermolekulare chemische Bausteine, sogenannte Monomere, zu langen Ketten zusammen. Beim PVC, dem allgegenwärtigen Polyvinylchlorid, sind das beispielsweise viele Moleküle von Vinylchlorid. Die Vorsilbe ‚Poly’ kommt aus dem Griechischen und heißt viel. Aus vielen VC–Molekülen wird also durch Polymerisation ein PVC–Makromolekül, oder, wie wir sagen, ein Polymer.
Je nachdem, wie ihre Moleküle Händchen halten, können Polymere verschiedene Molekülstrukturen haben – vor allem lineare, verzweigte oder vernetzte. Ist an der Polymerisation nicht nur eine Art von Molekülen beteiligt, sondern sind es zwei oder mehr, nennen wir das ein Copolymer. Auch hier gibt es wiederum eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie sich die Grundbausteine der beiden Komponenten – nennen wir sie einmal A und B – im Makromolekül räumlich anordnen. Da haben wir beispielsweise die sogenannten alternierenden Copolymere, bei denen, wie der Name schon sagt, die beiden Bausteine abwechselnd aufgereiht sind, nach dem Schema ABABAB.
Von besonderem Interesse ist heute für uns ein anderes Molekülmuster, das der sogenannten Pfropfencopolymere. Das sind verzweigte Polymere, bei denen die Hauptkette ausschließlich aus dem einen Grundbaustein, die Nebenkette aber aus dem anderen besteht.« Hoare nippte an seiner Tasse.
»Bei ihrer Probe handelt es sich um ein Pfropfencopolymer aus zwei sogenannten Polymethacrylaten, und zwar um Polymetacrylsäuremethylester, Kürzel PMMA, und Polymetacrylsäurepropylester, abgekürzt PMAP.« Hoare sah mich entschuldigend an. »Beide Polymere bilden ein absolut gleichmäßiges Netz, und sie haben einen identischen Polymerisationsgrad von 645 000. Das bedeutet, dass alle Ketten sehr lang sind – und dazu absolut gleich lang.« Der Professor schüttelte den Kopf, als könne er es nicht glauben.
»Die regelmäßig vernetzte Molekülstruktur des Copolymers aus PMMA und PMAP und sein extrem hoher Polymerisationsgrad bringen für den Werkstoff zahlreiche Vorteile mit sich: Kristallinität, Dichte und mechanische Festigkeit sind höher und die Thermostabilität besser. Die Substanz ist transparent, sehr hart, unzerbrechlich, gegen ultraviolette Strahlen unempfindlich, bis 95 Grad temperaturbeständig, und sie wird weder von Wasser, noch von Säuren, Laugen, Benzin oder Alkohol angegriffen.«
Hoare hob die Teetasse zum Mund, stellte sie aber wieder ab, weil sie leer war. »Wir kennen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Molekülstruktur von Polymeren zu verbessern. Aber unsere Netze sind sehr unregelmäßig, und wir haben weder einen derart hohen und einen dermaßen einheitlichen Polymerisationsgrad noch ein so reines Pfropfencopolymer je gesehen. Ihre Substanz ist eine wissenschaftliche Sensation allerersten Ranges! Wenn man die Patente hätte ...« Der Professor beendete den Satz nicht, holte tief Luft und fragte: »Woher stammt das Copolymer?«
Laxmi warf mir einen Blick zu, und ich nickte leicht. »Tut mir leid, Herr Professor – die Antwort wird Sie sicher nicht befriedigen, obwohl es die Wahrheit ist«, sagte Laxmi mitfühlend. »Wir haben die Substanz als Überzug auf dem Fragment einer Galionsfigur gefunden, die vermutlich um 1600 hergestellt wurde – dem Schwanzende einer Meerjungfrau. Es trieb vor dem Kap der Guten Hoffnung im Ozean.«
»Waaas?« Hoare starrte uns entgeistert an. »Das gibt es doch nicht! Das ist ja nicht zu fassen!« Er musste tief durchschnaufen, weil er offenbar zu atmen vergessen hatte. »Wissen Sie was? Im Labor haben wir zunächst überlegt, ob Sie sich die Probe durch Industriespionage beschafft haben, und wir haben uns den Kopf zerbrochen, ob die Amerikaner, die Deutschen oder die Chinesen mit der Steuerung der Polymerisation schon so weit sind.«
Er stand auf, ging zu dem gotischen Butzenscheiben–Burgfenster und starrte hinaus. Nach ein paar Minuten sagte er wie im Selbstgespräch: »Da waren wir schön auf dem Holzweg.«
Immer noch aus dem Fenster blickend, setzte er hinzu: »Um ehrlich zu sein, haben wir das mit den Chinesen, den Deutschen oder den Amerikanern schon bald nicht mehr glauben können; denn in dem Material stecken technologische Fortschritte von Jahrzehnten. Fortschritte, die wir noch nicht gemacht haben!« Beim letzten Satz wurde er ziemlich laut.
Nach einer weiteren Pause drehte Hoare sich um. »Wissen Sie was? Als wir Ihre Probe analytisch geknackt hatten, die erste Aufregung abgeklungen war und sich der Streit über die Herkunft des Materials gelegt hatte, weil keiner seine Ansichten mit Belegen untermauern konnte«, sagte er leise, »haben wir kurz entschlossen über seinen Ursprung abgestimmt. Zur Wahl standen irdische Herkunft und außerirdische.« Er fixierte mich ein paar Sekunden wortlos, als wolle er mich auf die Tragweite dessen vorbereiten, was jetzt kam. »Mit fünf zu eins haben wir entschieden: Das Zeug ist nicht von dieser Welt.«