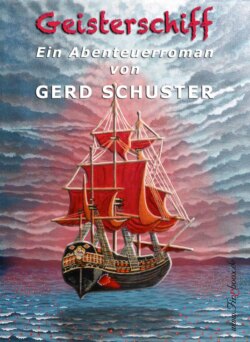Читать книгу Geisterschiff - Gerd Schuster - Страница 8
Kapitel 5
ОглавлениеEin Strandbummel auf Alderney
oder
Die ungeheuerliche Geschichte der Kapitänsfrau
Ich muss Sie, lieber Leser, um Nachsicht bitten für die Vulgarität meiner Formulierung, aber bei diesen Worten blieb mir im wahrsten Sinne des Wortes die Spucke weg. Mit trockenem Mund überlegte ich einen Augenblick lang, ob der Tod ihres Mannes sich ungünstig auf den Verstand von Mrs. Shearer ausgewirkt haben könnte. Aber ich sagte keinen Ton. Mir war klar, dass sie mir, wenn ich jetzt keinen Fehler machte, alles erzählen würde, wie kurios es auch sein mochte. Es drängte sie, sich einem Menschen anzuvertrauen. Sie musste los werden, was sie seit Wochen bedrückte und ihr Rätsel aufgab. Ich hatte mich als erster für diese Rolle qualifiziert und würde ein aufmerksamer Beichtvater sein.
Mrs. Shearer leerte ihr Glas, stand auf, nahm einen hellen Burberry–Übergangsmantel von einem Garderobenhaken, und wir gingen durch den Garten und die Dünen zum Strand. Wir folgten einem sandigen Trampelpfad, der sich zunächst durch schütteres Buschwerk und Heidelbeersträucher, dann durch langhaarigen Strandhafer schlängelte.
Der Strand hatte aus der Luft klein ausgesehen, ein dünner heller Saum aus Sand groß wie eine Herzmuschel. Aber tatsächlich war er riesig, halbmondförmig gebogen und blitzsauber, ein Paradies für Jogger und Spaziergänger. Ich fühlte mich an die Seychellen erinnert – so breit, weiß und verlassen war der sandige Meeresrand. Es fehlten nur die Palmen.
Außerdem war das Meer stahlblau statt türkis, und die beiden Pärchen, die zusammengekuschelt hinter windschützenden Sandwällen lagen, trugen keine Badekleidung, sondern Pullover und lange Hosen.
Der überlange Wellenbrecher störte ebenfalls den Tropentraum. Er war einst mit enormem technischem Aufwand errichtet worden, weil er einen Kriegshafen schützen sollte. Hier, vor der Nase des Erzfeindes Frankreich, sollten britische Panzerschiffe der Flotte der »Frogs« auflauern.
Aber der geplante Hafen war nie gebaut worden, und der Wellenbrecher streckte sich auf der anderen Seite der Bucht als nutzlose Sehenswürdigkeit eintausendvierhundert Meter weit ins Meer. Es war der deplatzierte Blattstiel, den ich beim Anflug gesehen hatte. Hinter ihm konnte ich als grauen Klecks im Dunst eine kleine Insel erkennen.
»Das ist Braye Beach«, sagte Mrs. Shearer, als wir aus dem Strandhafer getreten waren. »Etwas ähnlich Schönes sucht man im UK vergeblich!« Vorsichtig ging sie durch den lockeren Sand. »Mein Mann hat diese Inseln geliebt«, fuhr sie nach einer Weile fort. »Er mochte auch die ungezähmte Wildheit des Meeres, das sie umschließt. Wissen Sie, dass es hier einen Tidenhub von mehr als sechs Metern gibt? Im Süden der Insel erreicht die Strömung bei ablaufender Ebbe und aufkommender Flut elf Knoten! Die Einheimischen nennen diese gefährliche Stelle ‚The Race’.«
Sie wies auf den grauen Flecken im Dunst. »Zwischen Burhou, dem kleinen unbewohnten Eiland dort drüben, und Alderney lauert noch eine solche Schiffsfalle. Sie heißt ‚The Swinge’ und hat neun Knoten zu bieten. Viele Schiffe sind dort gesunken, aber wir waren mit unserem kleinen Segelboot nie in Gefahr. Howard hatte die Seekarte und die Gezeitentabellen natürlich im Kopf.«
Wir gingen näher ans Wasser, wo der Sand feucht und fest war. Auf dem Meer, das wieder einmal den harmlosen glatten Badesee spielte, rangen zwei Windsurfer mit der Flaute. »Howard war sich natürlich der Ehre bewusst, die das Kommando auf dem neuen Superschiff bedeutete. Aber er fuhr nicht so wahnsinnig gern auf diesen riesigen Kästen, so komfortabel das auch war. Er hatte eine Suite wie in einem Fünf–Sterne–Hotel und einen eigenen Steward. Doch er sagte, die Hunderttausend–Tonner seien keine Schiffe mehr, sondern schwimmende Güterbahnhöfe. Vergessen Sie nicht, dass er vor vierzig Jahren auf den ersten Containerschiffen gefahren ist, die gerade mal hundert der Blechboxen beförderten!« Sie schaute mich Verständnis heischend an.
»Wenn er auf der Brücke war, wollte er das Meer sehen. Er akzeptierte höchstens das Vorschiff seines Frachters zwischen sich und der unendlichen Weite des Ozeans. Er wollte Zeuge sein, wie der Bug die Wellen durchpflügte und mochte es nicht, wenn er von der See kaum etwas sah oder sie gar auf einem Monitor betrachten musste, weil ihm die Sicht nach vorn durch Containerberge verstellt war!«
Die Kapitänswitwe dachte eine Minute lang nach. »Er hat das Meer wirklich geliebt – mehr als mich, glaube ich. Er war ja auch in seinem Leben viel länger mit ihm zusammen als mit mir. Er verehrte und achtete die See. Für ihn war sie weder ein Transportmedium noch ein gewaltiger Wassertümpel; er betrachtete sie als ein Wesen, ein lebendes Ding mit Stimmungen wie Zorn und Frohmut, ein Hort zahlloser Geheimnisse. Nie hätte er Treibstoffbunker oder Schwerölfilter auf hoher See durchgespült oder Abfall über Bord werfen lassen. Nicht mal eine Zigarette durfte man bei ihm ins Meer schnippen!«
Sie lachte kurz, aber ihre Augen lachten nicht mit. »Wenn er jemanden dabei ertappte, fragte er ihn, ob er, wenn er bei Bekannten zu Besuch sei, in deren Wohnzimmer Zigarettenkippen auf den Teppich fallen lasse. Wenn der Angesprochene dann verneinte, sagte er, dann sei ja alles klar – drehte sich um und ging davon. Ich glaube, die Mannschaft hat ihn für ein wenig verschroben gehalten. Aber sie hatte Respekt vor ihm und fürchtete seinen Zorn.« Wieder ein kurzes, wissendes Lachen, und wieder blieben die Augen ernst.
»Als das britische Verteidigungsministerium Zehntausende Fässer voll Atommüll in den Ärmelkanal kippte, einen Teil davon in die Hurd–Tiefe nördlich von Alderney, geriet er außer sich vor Wut. An gleicher Stelle hatte die Regierung ja bereits ungeheure Mengen von Munition – Bomben, Granaten, Phosphorbrandsätze und Kampfgasgeschosse – versenkt. Und dann warf sie radioaktive Abfälle hinterher, die Millionen Jahre lang strahlen würden!
Er war im Grunde ein ruhiger Typ, aber wenn ich ihn in dieser Sache besänftigen wollte, schrie er mich an. ‚Das Meer ist unsere Lebensgrundlage’, tobte er, ‚und keine x–beliebige Müllkippe! Es ist die Straße unserer Schiffe, und es schenkt uns Fisch, Krustentiere und Muscheln, die wir essen. Man scheißt’« – sie sah mich entschuldigend an – »’nicht auf die Straße, und man schmeißt kein Gift in seinen Fischteich!’
1981 konnte ich ihn nur mit Mühe daran hindern, eine große Dummheit zu begehen. Er hatte vor, mit seinem Tanker die Versenkung der über 3000 Fässer, die damals vor Alderney verklappt wurden, wie mit einem Greenpeace–Schlauchboot zu behindern. Er wollte immer mit dem Kopf durch die Wand. Natürlich wäre er entlassen worden, wenn er das getan hätte!«
Sie schwieg einen Moment. Ich war überzeugt, dass sie mit ihrem Mann Zwiesprache hielt. »Aber natürlich hatte Howard recht«, fuhr sie fort. »Die radioaktive Belastung der Nordsee durch die strahlenden Abwasserfluten der Wiederaufarbeitungsfabriken in Sellafield oder La Haque ist schon schlimm genug. Und La Haque ist nur einen Katzensprung von Alderney entfernt!«
Wir gingen eine ganze Weile am Meer entlang, ohne dass Mrs. Shearer etwas sagte. Mir war kühl, und ich merkte, wie unterzuckert ich war. Außer den Cornflakes, zwei Tassen Kaffee und einem Käsesandwich im Flughafen von Guernsey hatte ich nichts zu mir genommen. Aber ich würde bald erfahren, was die Kapitänsgattin vom Untergang der »Palermo Express« wusste. Das war ein bisschen Hunger allemal wert.
»Howard war ein Kapitän der alten Schule«, fuhr sie fort. »Er nahm seine Pflichten sehr ernst, war akkurat, auf die Minute pünktlich und ein wenig pedantisch. Sie hätten mal seine Logbücher sehen sollen! Er vergaß keine Sekunde lang, welche Verantwortung er für Schiff, Ladung und Mannschaft hatte. Er war ein Arbeitstier, und sein Beruf ging immer vor. Darunter litt unsere Ehe. Sie zerbrach fast daran.«
Sie blieb plötzlich stehen und sah aufs Meer. Aus dem Braye Harbour tuckerte ein kleiner flacher Kahn ohne Ladebäume hervor, wohl ein Küstentankschiff. Vielleicht war es auch ein Schüttgutfrachter, der Müll zum Verbrennen nach Guernsey brachte. Das Schiffchen war unglaublich langsam und schien an dem Wellenbrecher aus dem 19. Jahrhundert, den es auf dem Weg ins offene Meer entlanglaufen musste, festzukleben. Dagegen war sogar die lahme »Starina« flott gewesen.
»Howard und ich wurden uns fremd«, sagte Mrs Shearer, »weil er so viele Jahre lang fast nie zu Hause war. Wenn er Landurlaub hatte, blieb er oft bei seinem Schiff, wenn es im Dock war und überholt, umgerüstet oder repariert wurde, oder er machte eine Fortbildung in Satellitennavigation, Containermanagement, Radar oder irgend etwas anderes. Er fand immer was. Es kamen ja ständig neue Geräte auf, die Verladung der Container wurde immer moderner und schneller, und alle paar Jahre änderten sich die Patente, die er besitzen musste, und er musste Prüfungen ablegen.
Und wenn er wirklich einmal in unser Haus nach Kent kam, war er ein Fremder. Er konnte oder wollte seinen Befehlston nicht ablegen und war kalt wie Eis. Wir hatten uns nichts zu sagen, und ich war jedes Mal heilfroh, wenn er wieder verschwand. Ich dachte nicht einmal mehr an ihn, wenn er auf See war – auch, weil er nie anrief. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht verließ.«
Sie lächelte traurig. »Vielleicht ahnte ich ja, dass sich eines Tages alles zum Guten wenden würde. Und wirklich: Als Howard mit 58 krank wurde und die Ärzte eine Zeit lang vermuteten, es sei Krebs, und er dann noch erfuhr, dass er mit 60 in Pension gehen musste und nicht bis 63 bleiben durfte, was er angestrebt hatte, änderte er sich von Grund auf. Er nahm sich Zeit für mich, brachte wie früher Geschenke mit, lud mich wieder zu Segeltörns ein, rief auch von See aus an. Er entschuldigte sich sogar bei mir für sein früheres Verhalten. Er war beinahe wieder wie nach unserer Hochzeit, nur ein wenig zerknitterter und grauer eben.« Noch ein halbes Lächeln.
»Natürlich misstraute ich dem plötzlichen Sinneswandel zunächst, aber Howard schaffte es, mich zu überzeugen. Seit mehr als einem halben Jahr telefonierten wir sogar jeden Tag miteinander, abends oder morgens, je nachdem, in welcher Zeitzone er gerade war. Auch wenn er in Asien fünf oder sechs Stunden voraus war, schaffte er es immer, mich beim Frühstück zu erwischen. Es war wunderschön, und ich war glücklich. Ich freute mich auf die Zeit nach seiner Pensionierung.
Und ich freute mich für ihn, als ihm die Reederei für zwei Reisen das Kommando der »Palermo Express« übertrug – als Anerkennung für geleistete Dienste, quasi als Abschiedsgeschenk. Ich hätte mitfahren können, aber ich lehnte ab. Ich wollte nicht stören, während er von der See und von seinem Arbeitsleben Abschied nahm.«
Sie setzte sich wieder in Bewegung, sagte aber eine ganze Weile nichts. Dann blieb sie plötzlich stehen und schaute mich an. »Kennen sie Skypen?«, fragte sie. Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte – einen Ort in Skandinavien? »Nein, tut mir leid«, sagte ich. Sie erklärte mir, dass Skypen eine preiswerte Möglichkeit war, per Internettelefonie Kontakt zu Personen auf der anderen Seite der Welt zu halten.
Beide Partner luden ein kleines Programm namens Skype aus dem Internet herunter, und schon konnten sie miteinander reden – praktisch kostenlos. Man musste auf dem Rechner nur die Software starten, die Telefonnummer in das Adressfeld auf dem Monitor tippen und die Eingabetaste drücken. Schon klingelte es auf der anderen Seite des Erdballs an einem PC.
Das Programm, von dem es auch einige kostenpflichtige Varianten gab, war bei Seeleuten und Piloten sehr beliebt. Dass ein Mikrofon an den Rechner angeschlossen werden musste, verstand sich von selbst.
»Zu Weihnachten hatte er mir einen neuen Computer geschenkt und dazu eine Webcam. Seitdem telefonierten wir einmal die Woche mit Bild – in der Regel am Sonntagmorgen. Das war großartig, und er nahm das System auch auf die ‚Palermo Express’ mit.« Sie blieb wieder stehen und schaute mich an. »Sie wissen, dass das Schiff an einem Sonntag verschwand?« Ich nickte. Mein Herz klopfte laut.
Die Frau des toten Kapitäns hatte nur kurz gestoppt. Sie ging jetzt schneller als vorher und hielt ihr Gesicht zum Meer gewandt. Weil sie leise sprach, musste ich ganz in ihrer Nähe bleiben, um sie zu verstehen.
»Alles war wie immer. Ich saß am PC, und er rief an, auf die Minute pünktlich um acht. Er sagte ‚Guten Morgen’, wünschte mir einen schönen Sonntag und fragte nach dem Wetter und dem Garten. Er umrunde gerade das Kap der Guten Hoffnung, erzählte er und hielt eine Postkarte in die Kamera. Ich erinnere mich genau, was drauf war: Der steil aufragende Tafelberg und sein merkwürdiges ‚Tischtuch’ aus weißem Nebel, mit dem er sich immer wieder bedeckt.
Er sei nur eine Stunde voraus, sagte Howard. Das Wetter sei erstaunlich gut, nachdem sich das Schiff einige Zeit durch den ortstypischen Nebel gekämpft habe. Es waren sechs bis sieben Windstärken, glaube ich. Wir redeten ein wenig über das Fest, das wir zu seiner Verabschiedung geben wollten.
Ich konnte hinter ihm einen Teil der Brücke sehen. Auf der ‚Palermo Express’ war sie geräumig wie ein Saal. Quer durch die Brücke schimmerte durch ein bullaugenförmiges Fenster in der Tür auf der anderen Seite ein Stück Horizont.« Sie ging immer schneller und redete immer leiser.
»Auf einmal hörte ich eine helle Männerstimme rufen. Es klang ängstlich und kläglich – so, als bettele ein furchtbar aufgeregter Schuljunge um Hilfe. Es muss der Rudergänger gewesen sein, ein Philippino, denn sonst war zu dem Zeitpunkt niemand auf der Brücke, soviel ich weiß. Die Seeleute von den Philippinen haben manchmal helle Stimmen.
Mein Mann schaute in die Richtung, aus der der Ruf gekommen war, und runzelte die Stirn. Er zog sein typisches ‚Dieser–verdammte–Spinner!’– Gesicht. Ganz offensichtlich ärgerte er sich über irgend etwas – wahrscheinlich über das, was der Rudergänger gerufen hatte. Er versuchte aber, mich das nicht merken zu lasen.
Er sagte: ‚Schatz, bleib einen Augenblick dran – die Pflicht ruft. Bin gleich wieder da’, zog die Kopfhörer ab und verschwand aus dem Bild. Ich nehme an, er ging zum Rudergänger. Es vergingen nur ein paar Sekunden, dann brüllte Howard los. Ich konnte ihn gut verstehen: ‚Tatsächlich! Der Fliegende Holländer! Ich will auf der Stelle verrecken, wenn das nicht der Fliegende Holländer ist.’«
»Wenn er sich aufregte, wurde er immer etwas derb!« setzte sie entschuldigend hinzu.
Es entstand eine lange Pause. Mrs. Shearer lief an dem Saum des Meeres entlang, und sie merkte nicht, dass sie ein paar Mal Wasserzungen durchquerte, mit denen Wellen am Strand leckten, und nasse Füße bekam. Wir näherten uns dem Wellenbrecher immer mehr. Dann blieb die Kapitänsfrau so plötzlich stehen, dass ich einen Schritt weiterhastete. Sie kam zu mir, fasste meine Hände, senkte ihren Kopf und drückte ihn an meine Brust. Schluchzend sprach sie weiter.
»Howard war so aufgeregt, dass er mich vollkommen vergaß. Ich konnte alles mithören. Zunächst verpasste er dem Rudergänger eine fürchterliche Standpauke. Soweit ich es verstand, warf er ihm vor, die Warnsignale der Radaranlage verschlafen zu haben, die ertönen, wenn ein anderes Schiff in einer bestimmten Entfernung auftaucht, die man einstellen kann.
Der Rudergänger antwortete, und ich verstand ihn, weil er zurückschrie, es habe keine akustische Warnung gegeben, und auch keine optische. Offenbar war das Schiff, das die beiden Männer für den Fliegenden Holländer hielten, schon sehr nahe.« Sie weinte jetzt richtig. Ich traute mich nicht, sie anzufassen.
Die Szene war so irreal, dass ich einen Moment zu träumen meinte. Der Fliegende Holländer? Ein Geisterschiff aus der Legende? War sie nicht recht bei Verstand? Mein Gefühl sagte mir jedoch unmissverständlich, dass es die Wahrheit war. Was sie erzählte, war unglaublich; aber ich spürte, dass sie nicht log.
»Dann ging alles schrecklich schnell!«, fuhr Mrs. Shearer fort. ‚Wollen Sie den überfahren, Mann?', brüllte Howard. ‚Der kommt ja direkt auf uns zu! Kollisionskurs! Haben Sie die Hosen voll? Abergläubisch und gelähmt vor Angst, was?’ Er war außer sich. ‚Ruder hart steuerbord, Sie Hornochse!', schrie er, so laut er konnte, und das war sehr sehr laut. ‚Geben Sie Signal, verflucht!’ Ich konnte das Horn der »Palermo Express« hören, ein sonores, urweltliches Tuten, das Tote aufwecken konnte.« Ihr wurde bewusst, was sie gesagt hatte, und sie weinte heftiger.
»Plötzlich brach das Chaos los. Zwei oder drei Alarme fingen zu schrillen an. Howard fluchte wie ein Berserker, und der Philippino weinte. In dem Lärm konnte ich nicht verstehen, was ihn jetzt so aufregte. Und dann begannen beide Männer auf der Brücke gleichzeitig zu schreien. Es waren Entsetzenslaute. Etwas Schreckliches musste geschehen, denn, bitte glauben Sie mir,« sie zerrte wild an meinen Händen, als wolle sie mich wie ein Kind durchschütteln, »Howard war ein harter Brocken und nicht leicht ins Bockshorn zu jagen. Er war ein grober Klotz, aber er konnte eine Menge verkraften, ohne die Fassung zu verlieren.«
Sie schwieg ein paar Sekunden, nahm dann alle Kraft zusammen, um weitersprechen zu können. »Ich glaube, sie sahen das Ende kommen. Der Philippino betete mit seiner Mädchenstimme laut auf Spanisch. Howard brüllte wie ein Stier: »Maschine stopp – schnell! Volle Kraft zurück!«
Aber Sie wissen ja, was solch ein Pott für einen Bremsweg hat – Kilometer! Der Befehl musste zu spät kommen – und so war es. Zu meinem Horror sah ich, dass sich der Horizont, den ich durch die Tür erkennen konnte, stark neigte. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was das bedeutet; es wurde mir aber später klar: Das Schiff kippte über den Bug weg. Mehrere Telefone begannen zu klingeln, ein Offizier stürzte herein – ich konnte ihn einen Moment lang sehen; er schaffte es wegen der Neigung des Schiffes kaum, sich auf den Beinen zu halten.
Plötzlich kam für mich sekundenlang alles ins Rutschen, und als das Bild wieder stand, hatte sich mein Blickwinkel vollkommen geändert. Ich konnte auf einmal Howard und die beiden anderen Männer sehen. Ich nehme an, Howards Notebook war trotz der Gummimatte, auf der es stand, an die Schlingerleiste des Tisches gerutscht, und zwar schief, weil es nur mit seiner linken Seite den Halt verloren hatte.
Howard und der andere Offizier, ich glaube, es war der Norweger, stützten sich mit ausgestreckten Armen und den Knien an den Konsolen oder den Fenstern ab. Der Rudergänger hatte seinen Platz verlassen und saß zusammengesunken auf dem Boden, sich mit den Beinen abstützend. Für mich sah das ganz merkwürdig aus, denn weil die Kamera die Neigung des Schiffes mitmachte, hatte ich nur am Horizont erkennen können, wie die ‚Palermo Express’ wegkippte. Den Horizont konnte ich jetzt aber nicht mehr sehen. Für mich schien das Steuerhaus waagerecht, und es kam mir vor, als würden die Männer von einer unsichtbaren Kraft an die Wand gedrückt.
Ich war gelähmt vor Entsetzen. Und dann kam das Wasser. Ich sah, wie es von außen an den Fenstern aufgischte, sie dann überspülte und überall eindrang. Es rauschte und gurgelte grauenhaft. Ein riesiger schwarzer Schatten, wohl ein Container, der sich losgerissen hatte, knallte gegen die Fenster des Steuerhauses und zertrümmerte sie. Sofort waren die Männer verschwunden. Ich sah noch eine menschliche Gestalt vorbeischießen, die verzweifelt gegen die Strömung ankämpfte, aber weggerissen wurde wie ein Herbstblatt am Gully. Dann wurde der Monitor dunkel. Erst da bemerkte ich, dass ich Howards Namen schrie!«
Sie umkrampfte meine Hände und schaute mir tränenüberströmt ins Gesicht. »Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber ich glaube, dass die ‚Palermo Express’ mit Volldampf unter Wasser gelaufen ist. Wie das möglich war, weiß ich nicht; aber ich verstehe eine Menge von Schiffen.«
»Ist Ihnen jetzt klar, warum ich niemand erzählen konnte, was geschehen war, und dass ich Sie angefleht habe, Stillschweigen zu bewahren?«, fragte sie nach zwei oder drei Minuten leisen Schluchzens, wieder zu mir aufschauend. »Was hätte ich sagen sollen? ‚Mein Mann ist vom Fliegenden Holländer versenkt worden?’«
Sie lachte böse durch die Tränen. »Ich hätte ihn dem Hohn und Spott der ganzen Zunft preisgegeben, nein: Der ganzen Welt! Man hätte geglaubt, dass er zum Zeitpunkt der Katastrophe betrunken oder auf Drogen war, nicht zurechnungsfähig oder krank. Man hätte seinen Ruf in den Schmutz gezogen und ihm die Schuld am Verlust des Schiffes gegeben. Können Sie sich die Schlagzeilen der Boulevardpresse vorstellen?«
Ich konnte. »Drei Tage vor der Pensionierung: Kapitän-Opa sieht Gespenster und versenkt nagelneues Superschiff« war wohl noch das Netteste, das man hätte erwarten dürfen.
Ich machte meine Hände los und fasste Mrs. Shearer am Arm. »Ich danke Ihnen sehr, dass Sie es auf sich genommen haben, mir vom Tod Ihres Mannes zu erzählen«, sagte ich. »Ich werde alles tun, um herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Lassen Sie uns zurückgehen.«
Schweigend wanderten wir in Richtung Hotel. Das Meer plätscherte mit der schauspielerischen Routine, die es in Jahrmillionen erworben hatte, und gab sich unschuldig und friedlich. Die Windsurfer warteten immer noch auf eine nutzbare Brise, aber sie gaben nicht auf. Auch die vermummten Pärchen lagen noch da – so unverändert, als seien sie aus Fiberglas und von der Tourismusbehörde Alderneys in den Sand gelegt worden, damit der Strand nicht so leer wirkte.
Ich drehte mich nach dem Küstenmotorschiff um. Es schien weiterhin an dem uralten Wellenbrecher zu kleben, gab aber ebenfalls nicht auf. Stand in Alderney die Zeit still? Wie konnte hier alles so unerträglich normal sein, während anderswo Grauenhaftes und Gespenstisches geschah?
Szenen aus Mrs. Shearers Schilderung drängten sich mir als Bilder und veritable Video–Sequenzen auf, aber ich ließ sie nicht zu. Ich wollte nicht an das denken, was die Kapitänsfrau erzählt hatte; denn ich war ratlos wie selten in meinem Leben. Einerseits war ich sicher, dass sie mir keinen Bären aufgebunden hatte, andererseits konnte das, was sie mir anvertraut hatte, nur ein Hirngespinst sein, ein Albtraum, eine Wahnvorstellung.
Es gab ebenso wenig einen Fliegenden Holländer wie den pferdefüßigen und gehörnten Teufel, den weißbärtigen Weihnachtsmann oder Harry Potters altehrwürdiges Zauberer–Internat, und eines der größten Containerschiffe der Welt ging nicht einfach so unter, vor allem nicht so schnell.
Aber – holy cow! – genau da lag der Hund begraben! Es war abgesoffen, in all seiner mächtigen Größe, ohne Spuren zu hinterlassen, und die einzige Augen– und Ohrenzeugin gab in glaubwürdiger Art und Weise einem sagenhaften Geisterschiff die Schuld. Damn, damn, damn!
Ich hätte etwas darum gegeben, wenn ich meinen Frust hätte herausschreien können, aber natürlich verbot mir das meine Kinderstube. Was war das nur für ein verhexter Fall! Nichts, was ich zusammengetragen hatte, machte Sinn, passte zusammen oder brachte Licht in die Angelegenheit! Statt harter Fakten oder wasserdichter Beweise grub ich nur Groteskes und Bizarres aus, Müll aus der Rumpelkammer von Satans Großmutter: Einen angeblich vierhundert Jahre alten Nixenschwanz, den ein unbekanntes Segelschiff verloren hatte, einen Kunststoff, der so modern war, dass es ihn noch nicht gab und ihn nur die kleinen grünen Männchen zusammengerührt haben konnten, und den Fliegenden Holländer, ein Geisterschiff aus der Mottenkiste!
Und meine einzige Zeugin war ein personifizierter Widerspruch: Sie sprach allem Anschein nach die Wahrheit und kannte die Materie, denn sie hatte Schiffbau studiert; nach menschlichem Ermessen aber musste sie lügen – oder zumindest fantasieren! Damn, damn, damn!
Wie hatte ich das verdient? Welche schlimmen Sünden musste ich abbüßen? Hatten die Mächte, die mein Schicksal steuerten, vergessen, dass ich Jim Cunningham war, nicht Crocodile Dundee oder Indiana Jones?
Ich sehnte mich nach Laxmis Weisheit, ihrem messerscharfen Intellekt. Dieser Fall schaffte mich! Sollte ich ihn dem fetten Hogg überlassen, den Fahnderjob hinschmeißen und stattdessen im Londoner Oberhaus gedrechselte Reden halten, bei denen die adligen Peers schliefen? Brachte ich das über mich?
Ich merkte zu spät, dass Mrs. Shearer stehen geblieben war und schoss ein paar Schritte über sie hinaus. Rasch drehte ich um. Wir waren fast an der Stelle angelangt, wo der Trampelpfad zum Hotel in den Strandhafer abzweigte. »Nach seinem Tod hielt ich es weder in unserer Wohnung in Margate noch in dem Haus auf Guernsey aus«, sagte sie. »Alles erinnerte mich dort an Howard, verstehen Sie? Und dann die Anrufe der Reederei und von Freunden und Bekannten, die mir sagten, er sei ja nur vermisst; es gebe Hoffnung. Vielleicht sei er in einer Rettungsinsel und werde bald gefunden.
Was wussten die denn? Ich hatte Howard sterben gesehen oder gehört, aber ich konnte nichts erzählen. Es war schrecklich, und ich floh hierher. Aber hier ist er auch. Wissen Sie, dass ich jeden Abend die Anrufbeantworter in Margate und auf Guernsey abhöre, weil ich denke, er könnte es vielleicht doch geschafft haben?
Und nachts hole ich mein Notebook hervor, starte Skype, gebe seine Telefonnummer auf der ‚Palermo Express’ ein und lasse das Programm wählen. Es kommt immer nur das Besetztzeichen, und das tut weh, denn es gaukelt mir vor, dass er noch lebt und telefoniert. Wie schön wäre es, wenn seine Leitung wirklich besetzt wäre – und er noch auf der Brücke stünde!« Sie schaute zu Boden. »Ich vermisse ihn so! Ich habe Sehnsucht nach ihm wie zuletzt vor dreißig Jahren!«
Nach einer Pause, die mir ewig lang vorkam, fuhr sie fort. Sie sprach so leise, dass ich sie kaum verstehen konnte. »Und es ist ja auch unvorstellbar, dass er tot ist. Howard war der Inbegriff von Unzerstörbarkeit, Widerstandskraft, Härte. Er überwand alle Hindernisse, schaffte alles, was er sich vornahm. Er war wie ein Fels. Und jetzt soll er tot sein! Er ist verschwunden, und ich werde ihn nie mehr sehen. Nicht mal ein Grab werde ich haben, dem ich Blumen bringen und an dem ich stehen und mit ihm reden kann ...« Ihre Stimme verging.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die üblichen Beileidsbekundungen erschienen mir angesichts dieses Schmerzes schal und platt. Wenn nur Laxmi hier wäre, dachte ich. Sie hätte die passenden Worte gefunden.
Weil die Stille zu drückend wurde, räusperte ich mich und wollte etwas sagen, auch auf die Gefahr hin, dass es abgedroschen klang. Aber Mrs. Shearer kam mir zuvor. Sie fasste meine Hände und sagte: »Danke, Jim, dass ich Ihnen mein Herz ausschütten durfte, und dass Sie mich so getröstet haben!« Sie versuchte ein Lächeln.
Während ich mich noch fragte, wie in aller Welt ich sie getröstet hatte, erwiderte ich, dass allein ich zu danken hätte und bat darum, noch einmal ganz kurz in die Rolle des Ermittlers schlüpfen und ein paar letzte Fragen stellen zu dürfen. Sie nickte.
Ob sie vor dem Wegkippen des Schiffes – oder was immer es war – eine Detonation oder einen Explosionsblitz bemerkt habe, erkundigte ich mich. Sie verneinte. Dann fragte ich sie, wie viele Minuten zwischen dem Beginn ihres Anrufs und seinem abrupten Ende vergangen sein mochten. Das war wichtig, denn mithilfe der exakten Uhrzeit des Untergangs der »Palermo Express« konnte man ihre Position zum Zeitpunkt der Katastrophe relativ genau hochrechnen und nach ihr suchen. Damit hatte sich mein Besuch bereits gelohnt.
»Anderthalb Minuten«, sagte sie. »Ich habe es unzählige Male durchgespielt und dabei auf die Uhr geschaut. Es waren nur 90 Sekunden. Ich weiß, ein so großes Schiff kann überhaupt nicht so schnell sinken, aber wenn das Wasser die Brücke erreicht, die fast 50 Meter hoch ist ...« Sie ließ das Satzende offen.
Wir gingen hintereinander durch den Strandhafer. Ich ließ ihr den Vortritt. Als wir die Büsche erreichten, fragte ich, ob ich sie wirklich alleine lassen könne. Sie bejahte entschieden.
Am Tor zum Hotelgarten bekräftige ich noch einmal mein Versprechen, die Sache mit dem Geisterschiff für mich zu behalten und bat sie, sich in eigenem Interesse keinem Anderen anzuvertrauen. Ich wisse, sagte ich, dass ein besonders verrufener Versicherungsfahnder, ein unförmig dicker Kerl, nach ihr suche. Er sei einer der schlimmsten Halsabschneider, Strolche und Galgenvögel, von denen sie gesprochen habe.
Er habe ein Gemüt wie eine Planierraupe, ihm sei jedes Mittel recht, um an seine Erfolgsprämie zu kommen, und die Reputation ihres Mannes interessiere ihn nicht die Bohne. Sie nickte. »Rufen Sie mich an, wenn er Sie belästigt!«, sagte ich und reichte ihr meine Karte, auf deren Rückseite ich meine Handynummer vermerkt hatte. Ich bin, was die Weitergabe meiner mobilen Nummer angeht, sehr zurückhaltend.
Ich überlegte, ob ich über Nacht im Georgian House bleiben sollte. Vielleicht würden Mrs. Shearer noch weitere wichtige Details einfallen, und möglicherweise konnte ich sie vor Hogg beschützen. Er würde bald auftauchen, das war klar. Aber es ging nicht: Alle vier Gästezimmer waren belegt.
Ich verabschiedete mich von Mrs. Shearer und bestellte an der Rezeption ein Taxi. Als es nach einer halben Stunde immer noch auf sich warten ließ, ging ich zu Fuß zum Flughafen. Ich wollte die letzte Maschine nicht verpassen, und es war ja nur eine Meile.
Während ich die Straße entlangtrottete, rief ich Laxmi an. Ich erzählte ihr in allen Einzelheiten, was die Kapitänsgattin berichtet hatte, wies auf den Zwiespalt zwischen glaubwürdiger Schilderung und unbestechlichen, gegen die Darstellung sprechenden Fakten hin, stöhnte über den immer rätselhafter werdenden Fall und glaubte, sie werde mich bemitleiden.
Aber nichts da. »Die arme Frau!«, sagte meine Freundin, und es kam aus tiefster Seele. »Verliert ihren Mann so kurz vor der Pensionierung und muss seinen Tod noch dazu quasi live miterleben! Wie furchtbar! Hoffentlich warst du rücksichtsvoll!«
Trost für mich hatte sie nicht parat. Es schien sie nicht weiter zu stören, dass ich statt Tatsachen wieder nur Mysteriöses ausgegraben hatte. Ja, sie betrachtete die Nachricht, dass der Fliegende Holländer beim Untergang der »Palermo Express« mitgewirkt hatte, sogar als Durchbruch bei den Ermittlungen und schlug alle meine rationalen Einwände in den Wind.
»Ich glaube Mrs. Shearer!«, sagte sie lapidar, das »ich« provokant betonend. Basta. Das war weibliche Logik. Laxmi bemitleidete die Kapitänsfrau und glaubte ihr jedes Wort. Sie hatte einen messerscharfen Verstand, doch den setzte ihr Mitgefühl matt. Oder verstand sie etwas, das mir verborgen blieb? Konnten Intuition und weibliches »Bauchgefühl« der Logik überlegen sein?
Männer und Frauen, sagt die Humanbiologie, haben unterschiedlich gebaute und organisierte Gehirne. Hier hatte ich den Beweis.
Nach dem Gespräch mit Laxmi ging es mir keinen Deut besser. Ich hatte Mühe, die Enttäuschung zu verwinden, dass sie mich nicht getröstet und kein bisschen aufgebaut hatte. Vor lauter Selbstmitleid und Grübelei wäre ich um ein Haar an dem Flughafeneingang vorbeimarschiert. Nur, weil gerade eine der gelben Maschinen von Aurigny Air landete, bekam ich mit, wo ich war.
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich hektische und von durcheinanderquirlenden Menschenmassen verstopfte Drehscheiben wie Heathrow, Charles de Gaulle oder O’Hare gewohnt war – Labyrinthe aus Glas, Stahl und Beton voller Unruhe, Hast und Reisestress, synthetischer Luft, Lärm und Lautsprecherdurchsagen, piependen Elektrokarren, blinkenden Anzeigetafeln und Monitoren. In ihnen musste man sich durch Wälder von Wegweisern und Reklametafeln, nervöse Menschenhorden, Duty–free–Läden voller Parfüm, Tabak und Alkohol, Passkontrollen und über Laufbänder kämpfen, wurde in Sicherheitsschleusen befummelt und verlief sich permanent.
Himmlische Ruhe, frische Seeluft, wogender Strandhafer, ein unscheinbares Tor, das genauso gut zu einer Autowerkstatt hätte führen können, ein Dutzend Pkws und zwei Dutzend Menschen assoziierte ich einfach nicht mit dem Begriff »Flughafen«.
Ich flog um 16.40 Uhr nach Guernsey und von dort um 17.30 Uhr nach Gatwick weiter. Es war die letzte Maschine nach London, und ich bekam gerade noch den letzten Platz. Ich war so sehr in Gedanken versunken, dass ich in den paar Minuten am Gate in Guernsey vollkommen vergaß, nach Hoggs unförmiger Gestalt Ausschau zu halten.
Auf dem Flug nach London peinigte mich ein Schreckensbild: Das Meer brandete gegen die Brücke der »Palermo Express«, die seine Oberfläche gerade noch um fast fünfzig Meter überragt hatte, überspülte in gierigen Strudeln die Fenster, und drang nach dem Aufprall des Containers mit triumphalem Rauschen ins Steuerhaus ein. Es war eine Szene wie aus einem Horrorfilm.
Kaum hatte ich die Zwangsvorstellung abgeschüttelt, ließ mich ein anderer Gedanke erstarren: Warum in aller Welt hatte mich der Elefantengott – oder wer immer mich bei dieser Ermittlung am Gängelband führte – zuerst nach Port Elizabeth und dort aufs Meer geschickt, damit ich die amputierte Nixenfluke aus dem Wasser zog – einen mehr als nebulösen Hinweis auf die Präsenz eines alten Segelschiffes am »Tatort«?
Warum hatte er mir das nicht erspart, wenn er mir wenige Tage später ohnehin die Existenz des Geisterschiffes durch Mrs. Shearer offenbaren wollte?
Wieso das überflüssige und kostspielige Vorspiel? Wer trank erst den Kaffee und schlürfte dann die Sahne? Weshalb zuerst ein Stück wurmstichigen Holzes als Hinweis auf den »Fliegenden Holländer«, dann die Zeugenaussage der Kapitänsgattin? Folgte Ganeshas Hilfestellung etwa den Gesetzmäßigkeiten weiblicher Logik?
Oder war die antike Schnitzerei mehr als eine Visitenkarte des sagenhaften Geisterschiffes? War ihre eigentliche Botschaft, wie immer sie lauten mochte, in dem rätselhaften Plastiküberzug versteckt? Oder lag sie anderswo verborgen? Mir war klar, dass ich etwas übersah. Aber ich wusste nicht, was. Natürlich nicht. Mir war übel vor Hunger, und die Ratlosigkeit machte alles schlimmer. Ermittler aller Schattierungen hassen nichts mehr als Ratlosigkeit. »Bitte, Ganesha«, betete ich, in der Finsternis des Unterbewusstseins einen Ansprechpartner suchend, »schick mir nach all den Rätseln auch mal einen Lichtblick!«
Ich glaube, es war mein erstes Gebet seit meiner Kindheit.