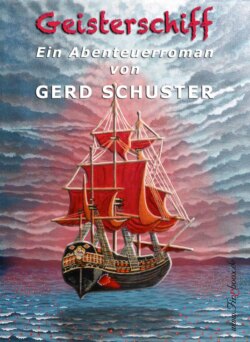Читать книгу Geisterschiff - Gerd Schuster - Страница 7
Kapitel 4
ОглавлениеDie Schiffsunglücke von »Lloyds List« als Schlummerlektüre
oder
Ein plüschiges Hotel im Ärmelkanal
Auf der Rückfahrt nach London schwiegen wir die ersten dreißig Meilen lang. Dann begannen wir uns zu streiten. Es war nicht der übliche Zank um Geschwindigkeit, Fahrstil oder Streckenführung, von dem fast alle Paare beim gemeinsamen Autofahren heimgesucht werden. Es ging um Hoare: Ich war sauer auf den Professor, und Laxmi verteidigte ihn.
Was sollte das heißen, monierte ich, der Kunststoff sei »nicht von dieser Welt«? Es handelte sich doch ganz offenbar um eine Mixtur von zwei durch und durch bekannten irdischen Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. In jedem Kaufhaus waren sie, nahm ich an, in Dutzenden oder Hunderten von Plastikartikeln zu finden – unzerbrechlichen Trinkgläsern, Billig–Lesebrillen oder Wegwerfkameras.
Nur, weil die Kettenlänge und die molekulare Struktur der Acrylate Hoare Rätsel aufgaben und er nicht wusste, wie man diese zustande brachte, erklärte er den Plastikfilm auf der Nixenfluke zu einem Produkt von kleinen grünen Männchen aus dem Weltall! Das war lächerlich – eine Konsequenz der beleidigten Eitelkeit eines überfragten Forscherstars.
Wie sollte ich Chemikern auf den Zahn fühlen, die in den Weiten der Milchstraße herumsausten? Damn, ich war Jim Cunningham von der MIA und nicht Nick, der Weltraumfahrer!
Laxmi konterte mit der zweiten Vorlesung in Polymerchemie, die ich an diesem Tag über mich ergehen lassen musste – und die ich Ihnen, lieber Leser, leider nicht ganz ersparen kann. Sie redete über das Wachstum von Molekülketten, Start–, Wachstums– und Abbruchreaktionen, Katalysatoren aus Vanadiumjodid und Cobaltbromid und den enormen Schwierigkeiten, die Polymerisation wunschgemäß zu steuern.
Ich verstand vieles nur halb, aber mir wurde klar, dass Hoare nicht übertrieben hatte, als er das Material vom Überzug der Nixenfluke als »außergewöhnlich« bezeichnet hatte. Dass es außerirdischen Ursprungs war, glaubte ich trotzdem nicht. Das war Unfug. Da konnte Laxmi reden, wie sie wollte. Es war typisch menschlich, Dinge für extraterrestrisch zu halten, die zunächst unerklärlich schienen. Selbst der mühsam dahinkrauchenden ersten Dampflokomotive war das so gegangen.
Laxmi beschränkte sich darauf, mir zu verdeutlichen, wie unwahrscheinlich es aus wissenschaftlicher Sicht war, dass die Acrylatmischung aus irdischen Chemieretorten stammte. Sie vermied es, auf die kleinen grünen Männchen einzugehen. Das war clever, denn sie wusste genauso wenig wie ich, was in Dreiteufelsnamen eine derartige Substanz auf einem jahrhundertealten Stück Treibholz zu suchen hatte, wie und wann sie aufgebracht worden war und wer sie warum appliziert hatte.
Ich setzte Laxmi an ihrer Wohnung am Holland Park in Kensington ab. Sie sagte, sie wolle noch die Probe für die Dendrochronologie nehmen und per Kurier an die süddeutsche Universität abschicken, die mithilfe ihrer »mitteleuropäischen Eichenchronologie« ihr Alter bestimmen konnte – und vielleicht den Wald, in dem die Eiche vor einer kleinen Ewigkeit gewachsen war. Wir waren beide gereizt. Sicher hätten wir gern eine Pizza gegessen oder einen doppelten Cappuccino in einem Café getrunken und Zärtlichkeiten ausgetauscht, aber keiner von uns schaffte es, das zuzugeben. Das war idiotisch, weil wir uns aufgrund meiner Reisen und Laxmis Forschung ohnehin viel zu selten sahen. Die verdammte Fluke war drauf und dran, unsere Beziehung zu ruinieren.
Mürrisch fuhr ich nach Hause. Admiral Nelson war verärgert, dass ich Laxmi nicht mitbrachte und verbiss sich in meine Schuhriemen, obwohl er sehr gut wusste, dass das verboten war. Ich hatte große Lust, Laxmi anzurufen, sie um Verzeihung zu bitten, zum Abendessen bei einem Edel–Inder einzuladen und die Nacht mit ihr zu verbringen. Aber ich wusste, dass sie mir jedes Einlenken als Schwäche auslegen und keinesfalls kommen würde.
Es war schon komisch: Laxmi hasste Machos und deren »hartes« oder »cooles« Gehabe, verfluchte den unguten Einfluss der Männer, ihrer Politik und Aggressivität sowie der von ihnen angezettelten Kriege auf die Welt und ihre Geschichte, und sie rieb mir bei jeder Gelegenheit unter die Nase, welchen Prozentsatz der Verbrecher und Mörder in den Haftanstalten Männer ausmachten.
Aber man durfte keine »Schwäche« zeigen, ohne dass sie die edle Nase rümpfte. Rajasthanische Männer entschuldigten sich nun mal nicht bei Frauen. Keiner der einundvierzig Singh–Maharajas der Jaipur–Linie hatte je, so war zu vermuten, eine ihrer zahlreichen Frauen um Verzeihung gebeten – egal, wie schlimm ihr Vergehen war. Es ging einfach nicht. Es war nicht vorgesehen.
Zwar lebten wir im einundzwanzigsten Jahrhundert und in London, einer der freizügigsten Metropolen der Welt; Laxmi war ein Freigeist, hatte mit vielem Althergebrachtem aus ihrer Heimat gebrochen und hier im Westen gerade einen akademischen Grad erworben. Aber ihre erzkonservative Erziehung und ein von bärtigen Maharaja–Feldherren geprägtes Männerbild steckten ihr immer noch tief in den Knochen.
Ich las die »Times« und den »Independent«, fütterte Admiral Nelson mit seiner geliebten Lachspastete, goss mir einen Gin Tonic ein und setzte mich an den PC. Ich überflog meine Mails, schrieb ein paar Antworten und las »Lloyds List Casualty Focus«, eine Kurzfassung der Unfälle aus Schifffahrt, Flugverkehr, Eisenbahn und dem Energiesektor weltweit. Nachdem er sich auf meinem besten Sessel ausführlich geputzt hatte, nahm der große blaue Kartäuser zwischen Bildschirm und Tastatur Platz und schnurrte laut. Sein Fell verdeckte sämtliche Funktionstasten. Es war angenehm, zu wissen, dass ich wenigstens bei einem meiner beiden Hausgenossen gut angeschrieben war.
Ich beschränkte mich auf die Schiffsnotizen. Vierzehn Pötte waren am gestrigen Tag auf den sieben Meeren zu Schaden gekommen, darunter ein riesiges schwimmendes Hotel, das eine Tonnage wie die »Palermo Express« besaß. Ein Feuer war auf einem der 700 Außenbalkone ausgebrochen und hatte auf andere Veranden und das Schiffsinnere übergegriffen. Balkone, dachte ich grimmig, hatten auf Schiffen eben nichts verloren. Man baute ja auch keine Häuser mit Ankerklüsen oder Wulstbug. Oder? Architekten war alles zuzutrauen.
Ein Fischkutter war gesunken, weil sich sein Netz in einer nordwestlich von Aberdeen auf dem Meeresgrund verlegten Ölpipeline verfangen hatte, deren Verlauf in jeder Seekarte eingezeichnet war und die jeder Fischer selbst bei zwei Promille nicht vergaß. Große Schiffe hatten kleine gerammt und versenkt. Das Übliche eben.
Ich klickte das Lesezeichen der »Marine Accident Investigation Branch« (MAIB) an, einer dem britischen Verkehrsministerium angegliederten Abteilung von Ermittlern, die weltweit die Unfälle britischer Kähne unter die Lupe nahmen und sich obendrein den Havarien von Schiffen in britischen Gewässern widmeten. Die vier Teams von jeweils einem Oberinspektor und drei Inspektoren waren ausgebufft und professionell, hatten ein festes Gehalt plus Pension, jede Menge Zeit zum Schnüffeln, und hinter ihnen standen die Mittel und die Autorität einer staatlichen Behörde. Letzteres beschleunigte die Wahrheitsfindung oft ungemein.
Bei der Lektüre ihrer akribischen Analysen von Unfallursache und –hergang hatte ich schon einiges gelernt, obwohl sich die Studien oft über 50 und mehr Seiten hinzogen und in trockenster Beamtensprache abgefasst waren.
Als Gegenmittel holte ich mir noch einen steifen Gin Tonic aus der Bar und begann, die neu dazugekommenen Untersuchungsprotokolle zu lesen. Admiral Nelson schnarchte dazu. Bei der Rückkehr von einer mitternächtlichen Spritztour nach einem langen, feucht–fröhlichen Abendessen war ein mit drei Ehepaaren besetztes Sportboot mit hoher Geschwindigkeit in die Felsen am Eingang des Naturhafens der schottischen Stadt Tarbert im Loch Fyne geknallt. Drei der Insassen waren ums Leben gekommen, die andern hatte schwere Verletzungen erlitten. Der tote Bootsführer hatte dreimal mehr Alkohol im Blut gehabt als erlaubt.
Ein üppig motorisiertes Großschlauchboot namens »Yellow Duck« hatte sich mit einer Ladung Feriengäste vor der Küste von Cornwall bei 25 Knoten Geschwindigkeit plötzlich in seine Bestandteile aufgelöst. Mehrere Insassen waren ins Wasser katapultiert worden, hatten aber gerettet werden können. Die fast fabrikneue Touristenschleuder – schon bei leichtem Wellengang wurden die dreizehn Passagiere bei dem hohen Tempo durchgeschüttelt wie in einer Knochenmühle – war fehlerhaft gefertigt und entlang der Längsachse ungenügend versteift gewesen.
Die Herstellerfirma hatte diverse Stabilitätstests gefälscht. Dem Bootsfahrer hatten einige Papiere gefehlt, die zum Pilotieren des Bootes berechtigten, und dem Hafenkapitän von St. Ives war das nicht aufgefallen, denn er hatte nicht gewusst, welche Genehmigungen erforderlich waren.
Ein nagelneuer deutscher Containerfrachter, der beinahe so groß war wie die »Palermo Express«, war wegen des Ausfalls der Hauptmaschine beim Anlegemanöver in die Docks von Southampton geknallt, dem Sitz der MAIB. Wie sich herausstellte, waren nach und nach alle vier Drucksensoren des revolutionären elektrohydraulischen Antriebs ausgefallen, bei dem die Schrauben nicht über eine lange Welle vom Schiffsdiesel gedreht wurden, sondern durch vom Diesel mit Strom versorgte Elektromotoren. Ersatz für die Anzeigeinstrumente fehlte, weil der südkoreanische Hersteller Lieferschwierigkeiten hatte.
Ohne Daten über den Hydraulikdruck konnte der Chefingenieur aber nicht mehr mit der Maschine umgehen, denn er hatte den nötigen Einführungskurs beim Hersteller nicht besucht und arbeitete nach der Devise Pi mal Daumen. Er deutete die Anzeigen diverser anderer Instrumente falsch und würgte die Maschine durch Bedienungsfehler ab. Er wusste nicht, dass es eine 24–Stunden–Hotline nach Südkorea gab, mit deren Hilfe er sich hätte Rat holen können. Außerdem waren die beiden Schlepper, die dem Pott bei seinem Drehmanöver beistehen sollten, zu schwach, um das große Schiff vor Schaden zu bewahren.
Nach Murphys Law war alles schief gegangen, was schief gehen konnte.
Es war immer dasselbe: Menschliches Versagen, Alkohol und technische Probleme. Aber es machte Spaß, die Protokolle zu lesen. Sie waren peinlich genau, und man konnte nachvollziehen, in welchen Schritten die Inspektoren vorgegangen waren. Es war spannende Lektüre, und ich vergaß den Ärger mit Laxmi völlig.
Ich genehmigte mir noch einen Drink. Ein vollbesetztes Ausflugsschiff war in Nottingham bei einer Nachtfahrt auf dem Hochwasser führenden Trent mit einer Brücke kollidiert und unter ihr eingeklemmt worden. Es hatte 25 Verletzte gegeben. Die Opfer waren zur Behandlung ins Georgian House in Alderney eingeliefert worden.
Ich riss meinen Kopf hoch, der nach vorne gefallen war und schreckte auf – zusammen mit Admiral Nelson, der mit einem vorwurfsvollen Maunzer floh. Ich war vor dem PC eingenickt! Aber halt! Was hatte ich da gelesen? Die Verletzten waren von Nottingham auf eine Kanalinsel gebracht worden? Das konnte nicht sein! Ich schaute auf den Bildschirm. Dort wurde in allen Einzelheiten geschildert, wie das Touristenboot ein Baugerüst an der Brücke gestreift hatte und darauf hin zum Spielball der Strömung geworden war. Von einem Georgian House war nirgends die Rede, auch nicht von Alderney.
Ich war plötzlich hellwach. Ich hatte eine Adresse auf einer Kanalinsel geträumt! Ich brauchte keine Minute, um mit Google festzustellen, dass auf Alderney tatsächlich ein Georgian House existierte. Natürlich war es kein Hospital, sondern ein Hotel.
War das ein Tipp von Ganesha? Zwar wusste ich nicht, was ein Hotel auf einem Eiland im Ärmelkanal mit der »Palermo Express« zu tun haben konnte, die auf der anderen Seite der Welt versunken war; aber das Stochern im Nebel wurde bei dieser Ermittlung ja mittlerweile zur Routine. Ich hatte keine Ahnung, auf welcher Fährte ich war; aber solange sie zum Ziel führte, war das okay. Laxmi hatte recht: Geduld war angesagt. Und Gottvertrauen.
Ich rief Laxmi an. Wie erwartet, war sie zunächst kratzbürstig und fauchte mich an. Wahrscheinlich dachte sie tatsächlich, ich wollte Süßholz raspeln und Abbitte leisten. Sie war aber sofort Feuer und Flamme, als ich ihr von der Botschaft erzählte. »Kapitän Shearer war ein leidenschaftlicher Segler und liebte die schwierigen Gewässer um die Kanalinseln«, rief sie aufgeregt. »Auf Guernsey, der Nachbarinsel von Alderney, hatte er ein Häuschen, in dem er im Sommer mit seiner Frau oft seinen Landurlaub verbrachte! Dort lag auch sein Boot!«
Die Süße war glücklich, dass sie mir helfen konnte. »Ich weiß das von meiner Freundin bei WW&W. Hogg hat Dossiers von allen Offizieren und dem indischen Chefingenieur der »Palermo Express« anfertigen lassen, und Saida hat an ihnen mitgearbeitet.«
Jetzt schlug mein Herz schneller. Erstmals deutete sich eine mögliche Verbindung zur »Palermo Express« an! Ich bat Laxmi, ein Bild der Kapitänsfrau und die Adresse ihres Hauses zu besorgen – oder, wenn möglich, die kompletten Dossiers. Ich sagte ihr, dass ich schon am nächsten Morgen nach Alderney fliegen würde, wenn ich einen Flug bekäme, dass ich per Handy erreichbar sei und wünschte ihr eine gute Nacht. Gern hätte ich ihr gesagt, dass ich sie liebte; aber das war heute nicht ratsam.
Was waren Menschen nur für komische Wesen! Ich dachte an Hogg – und grunzte unwillkürlich vor Unmut, obwohl diese Art Laut eher zu ihm als zu mir passte. Aber wie es aussah, würde ich zum ersten Mal in meiner Karriere von dem rosigen Fettwanst profitieren. Warum nicht? Skrupel hatte ich keine.
Ich gab den Inselnamen bei Google ein. Nelson, der die Suchmaschine schätzte, weil sie langes Sitzen vor dem Rechner garantierte, sprang auf meinen Schoß.
Eine halbe Stunde später wusste ich, dass Alderney die nördlichste der Kanalinseln und die kleinste mit einem Flughafen war. Sie lag nur acht Meilen vom Cap de la Hague an der französischen Normandieküste entfernt, hatte drei Quadratmeilen Fläche und etwa 2400 Einwohner. Bis nach Guernsey, mit dem sie zusammen eine »Vogtei« bildete, waren es zwanzig Meilen. Sympathischerweise fehlten auf Alderney wie auch auf Guernsey und Jersey politische Parteien völlig. Nicht, weil sie verboten waren; die Insulaner interessierten sich einfach nicht dafür!
Die Insel, die nicht zu Großbritannien gehörte, sondern als »Kronbesitz« der britischen Krone direkt unterstellt war, wurde von einem Spielzeugparlament geführt, den sogenannten »States of Alderney«. Die zehn gewählten Abgeordneten, denen ein »Präsident« vorstand, trafen sich einmal im Monat in der Hauptstadt St. Anne, um über Probleme wie den chronischen Geldmangel des klammen Eilands, die Geldspritzen aus Guernsey oder nötige Steuererhöhungen zu beraten. Oder um zu entscheiden, ob der Müll weiterhin kostspielig nach Guernsey verschifft oder eine eigene, kurzfristig aber noch viel teurere, Verbrennungsanlage gebaut werden sollte.
Es gab jedoch keinen Grund, die Nase zu rümpfen: Das Miniparlament wirtschaftete verantwortlich, reell und seriös: Schulden, die sich in den meisten »großen« Staaten auf Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Milliarden Euro oder Dollar beliefen und deren Zinsen einen erklecklichen Teil der Haushalte aufzehrten, hatte Alderney nicht. Vielleicht würde sich das mit der Anschaffung der Müllverbrennungsanlage ändern.
Jährlich besuchten rund fünfzigtausend Touristen die hübsche Insel, die ihnen neben vielen Banken und Briefkastenfirmen fünfzehn Läden, zwölf Kneipen, vier Kirchen, drei Polizisten, zwei Schulen sowie einen Ort und ein Postamt bot – und viel Wasser, Strand und Natur als Zugabe.
Das Hotel »Georgian House« war ein viereckiges, schmuckloses Gebäude mit zwei Stockwerken und lag in der Victoria Street im Zentrum der kleinen Inselhauptstadt. Es rühmte sich einer erstklassigen Küche, hatte vier sehr plüschige Zimmer, ein Restaurant, eine Orangerie, einen großen Garten und ein Pub. Auf den Fotos im Internet sah alles ganz manierlich aus – und extrem britisch.
Die Software der meisten Internet–Reisebüros hat bei mir noch nie funktioniert, und ich bin sicher, das ist nicht meine Schuld. Heute war es – natürlich – nicht anders: Obwohl ich als Abflugort »London All« auswählte, also alle Londoner Flughäfen, bekam ich erst die Flüge aus Kingston auf Jamaika gezeigt, dann die aus Lusaka. Nach langem Suchen gelang es mir schließlich auf der sechsten oder siebten Site, die Verbindung nach Alderney zu klären. Mehrere kleine Fluglinien flogen von London Gatwick nach Guernsey, wo es mehrmals täglich Anschluss nach Alderney gab.
Da ich einige böse Überraschungen mit Online–Buchungen erlebt hatte, rief ich das Büro von Marktführer Aurigny Air in Gatwick an und kaufte ein Ticket für die Maschine um 8.30 Uhr. Den Rückflug ließ ich offen. Ankunft in Guernsey war 9.35 Uhr. Weiter nach Alderney ging es erst um 12.00 Uhr. Planmäßige Landung war 13.00 Uhr. Ich stutzte: Welcher Flieger brauchte eine Stunde für zwanzig Meilen?
Aber die Insel gehörte ja nicht zum Vereinigten Königreich, fiel mir ein. Sie lag im Dunstkreis Frankreichs, das sie Aurigny nannte; da durfte man sich über nichts wundern. Eine Portion gesunder Skepsis gegen alles Französische hatte noch keinem Briten geschadet.
Am nächsten Morgen saß ich in einer Trislander–Maschine von Aurigny Air, einem kanariengelben 15–sitzigen Turbo-Prop-Flieger mit drei Triebwerken – eines an jeder Tragfläche und eines in der Höhenflosse.
Drei Reihen vor mir hockte Hamish Hogg. Er quoll aus dem schmalen Sitz direkt am Ausgang wie Hefeteig aus einer zu kleinen Kuchenform, und die Flugbegleiterin hatte große Mühe, ihr Getränkewägelchen an seinen Ausläufern vorbeizuschieben.
Ich hatte den fetten Fahnder erst bemerkt, als er sich schwitzend durch die Kabinentür zwängte; in der Abflughalle hatte ich ihn nicht gesehen. Hogg hatte mich keines Blickes gewürdigt, als er sich prustend gedreht hatte, um seinen enormen Achtersteven auf den Sitz zu wuchten, und auch ich hatte so getan, als sei er mir unbekannt. Ich glaube, dieses Mal war es umgekehrt wie in PE: Er ärgerte sich, mich zu sehen.
Ich war ebenfalls nicht gerade begeistert über unser Zusammentreffen, aber ich fühlte ein wenig Schadenfreude: Wenn der Dicke bei der Kapitänsfrau vorsprechen wollte, wie es schien, so hieß das, dass die kostspielige Containerbergung vor PE ihn nicht weitergebracht hatte.
Gut möglich, dass die Blechkiste das Meer schon jahrelang unsicher gemacht hatte; denn Container gingen immer wieder durch »Seeschlag«, wie es im Fachjargon hieß, oder aufgrund schlampiger Befestigung über Bord. Zwar versank der Großteil sofort, aber einige der Transportbehälter trieben als schwimmende Riffe ihr Unwesen. Wieder andere spuckten ihren Inhalt aus, bevor sie untergingen, und Zehntausende von Turnschuhen, Plastikentchen oder Tennisbällen verschönerten noch Jahre später die Strände der halben Welt.
Offenbar lief es bei Hogg nicht besser als bei mir: Außer Spesen nichts gewesen! Doch hatte ich einen Trumpf im Ärmel! Ich hoffte, er wusste nichts von »meinem« Hotel auf Alderney.
In Guernsey begab ich mich nicht zur Transfer Lounge, sondern folgte dem Dicken zum Mietwagenschalter in der Ankunftshalle. Ich stellte mich bei der Gesellschaft mit der längsten Schlange an, um ihn glauben zu lassen, dass ich gleichfalls vorhatte, auf der Insel herumzukurven. Ich war noch lange nicht an der Reihe, als der Mann von WW&W mit seinen Schlüsseln und Papieren zum Ausgang watschelte. Ich sah zu, wie er sich draußen in einen Vauxhall Senator quetschte und abfuhr – ich nahm an, zum Haus der Shearers. Schön, dass auf dem Spielzeugflughafen alles so übersichtlich war.
Erst dann begab ich mich zu meinem Gate. Gott sei Dank war reichlich Zeit für das harmlose kleine Täuschungsmanöver gewesen. Aber bis die Maschine abhob, hielt ich ständig Ausschau nach Hogg. Mich plagte die Zwangsvorstellung, mein überdimensionaler Landsmann könne auftauchen – mit einer Bordkarte für den Hopser nach Alderney in der Pranke.
Aber Hogg hatte keine echte Chance: In knapp zwei Stunden hätte er das Haus finden und feststellen müssen, dass die Kapitänsfrau ausgeflogen war. Er hätte ihren Aufenthaltsort in Erfahrung bringen, zum Airport fahren, seinen Vauxhall zurückgeben und ein Ticket nach Alderney kaufen müssen. Nein, das war selbst für den schwergewichtigsten Ermittler des Universums nicht zu schaffen.
Ich hoffte, dass ich ihm wirklich einen Schritt voraus war.
Der Luftsprung nach Alderney dauerte kaum eine Viertelstunde. Von oben sah die Insel wie ein Eichenblatt aus, das in einer Pfütze schwamm. Der ganze obere und untere Rand des Blattes war von Schädlingen zerfressen, und der Baum hatte es deshalb schon früh abgestoßen, weshalb es sich erst an den Rändern herbstbraun gefärbt hatte. Der längliche grüne Fetzen hatte fünf oder sechs halbrunde Fraßstellen. Das waren die Strände.
Der einzige intakte Teil des Blattes unterhalb der Mitte war nach Eichenart gelappt. Zwischen den tiefen Buchten auf beiden Seiten blieb nur noch eine relativ schmale Taille. Oberhalb der rechten Einbuchtung, die klar die größte der Insel war, schien an einem landzungenförmigen Überrest des nächsten »Lappens« der Blattstiel zu sitzen, obwohl er dort keinesfalls hingehörte.
Dennoch spießte ein langer Stängel an dieser Stelle schräg nach unten in den Ärmelkanal, der bemüht war, sich in ein freundliches Mittelmeer–Blau zu kleiden. Am Ufer der Landzunge und über den Rest der Insel verteilt, standen viele kleine Hexenhäuschen.
Als der dreimotorige Kanarienvogel auf der kurzen Landebahn aufsetzte und sofort kräftig bremste, tat ich dem vergleichsweise riesigen Flughafen von Guernsey stillschweigend Abbitte. Aber was konnte man erwarten? Alderney war lediglich dreieinhalb Meilen lang und anderthalb Meilen breit und damit nur etwa doppelt so groß wie der Londoner Hyde Park!
Ich erwischte das erste der beiden wartenden Taxen und ließ mich zum Georgian House Hotel fahren, das nur wenig mehr als eine Meile entfernt war. Das Inselhauptstädtchen St. Anne mit seinen gepflasterten Straßen und den malerischen georgianischen Häusern kam mir wie eine rustikale Miniausgabe von Oxford vor – antik, aber lange nicht so barock und bombastisch. Eher ein wenig derb und wohltuend untouristisch. Es war das zweite historische Freilichtmuseum, das ich innerhalb von zwei Tagen besuchte.
Mit ein wenig Herzklopfen ging ich zur Rezeption des Hotels und fragte so selbstverständlich nach Mrs. Shearer, als wohnte ich schon drei Wochen in einem der plüschstrotzenden Gästezimmer mit ihr zusammen.
Die Dame sei um diese Zeit gewöhnlich im Restaurant oder im Pub, sagte die hübsche Brünette hinter dem Tresen ohne mit der Wimper zu zucken und strahlte mich an. Bingo! Mir fiel ein Stein vom Herzen, und ich hätte am liebsten sofort Laxmi angerufen und ihr die gute Nachricht mitgeteilt. Aber das hatte Zeit. Also bedankte ich mich höflich und ging in die Schankstube.
Obwohl ich noch kein Foto von der Kapitänsgattin erhalten hatte, erkannte ich sie sofort. An einem runden Mahagonitischchen saß eine große, stattliche Dame um 50 in einem graublauen Kostüm. Sie hatte eine eisgraue Kurzhaarfrisur, die ein wenig maskulin wirkte, ein großflächiges, kluges und offenes Gesicht, viele Ringe an den Fingern und war tief in Gedanken versunken. Ab und zu nippte sie an einem Likörglas mit wasserklarem Inhalt. Ich tippte auf Cointreau.
Ich bestellte einen Gin Tonic, füllte das Glas aus der kleinen gelben Schweppes–Flasche auf und ging an ihren Tisch. »Guten Tag, Mrs. Shearer«, sagte ich in meinem besten House–of–Lords–Englisch und verbeugte mich förmlich. »Mein Name ist Jim Cunningham. Ich arbeite für die Maritime Investigation Agency in London. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie mir gestatten würden, mich einen Moment zu Ihnen zu setzen.«
Die Frau des toten Kapitäns schaute auf und sah mich mit ihren großen grauen Augen an. Ihr Blick berührte mich, denn in ihm lagen Trauer und Einsamkeit, aber auch Selbstdisziplin, Gefasstheit – und je ein Funken Wohlwollen und Angst. Weil sie nichts sagte, setzte ich mich auf den zweiten Polsterstuhl. »Mir tut sehr leid, was mit der »Palermo Express« geschehen ist, was immer es war,« sagte ich. »Welche Tragödie – solch ein Unglück auf der letzten Reise Ihres Mannes!«
Ich bedauerte die Brutalität des Meeres aufrichtig, und ich spürte, dass sie das merkte. Sie nickte kurz und schaute mich weiter an. In ihren Augen konnte ich lesen, dass sie viel von der Welt gesehen hatte – und dass sie mich taxierte, um herauszufinden, ob sie sich mir anvertrauen konnte. Ich erwiderte ihren Blick, ohne etwas zu sagen. Die ehrliche Fassade machte mir keine Mühe – ich hatte ein reines Gewissen.
Es dauerte ein paar Minuten, bis sie das Wort ergriff. »Ich habe Sie erwartet!«, sagte sie bedächtig. Ihre Stimme war ruhig, rauchig und überraschend tief. Sie hatte einen Upper–Middle–Class–Akzent mit einem kleinen kultivierten schottischen Beiklang. »Wenn so ein teures Schiff spurlos verschwindet, drehen die Versicherer durch. Lloyds war mit mindestens dreißig Millionen Euro dabei.«
Sie schwieg und betrachtete ihren Likör. Dann schaute sie auf: »Wir hatten ein paar Mal mit Schiffsversicherern zu tun,« sagte sie. »Die haben immer nur Galgenvögel, Strolche und Windhunde losgeschickt – oder Halsabschneider.« Sie nahm einen Schluck. Es war tatsächlich Cointreau. Ich konnte die Pomeranzen und Apfelsinen riechen. »Aber erfreulicherweise gehören Sie nicht zu diesem Pack!« Sie schaute mich an. »Ich kannte Ihren Vater. Lernte ihn vor fünfundzwanzig Jahren in Edinburgh kennen. Ich habe dort Schiffbau studiert.«
Ich staunte, aber ich hielt es für angebracht, das nicht zu zeigen und einfach abzuwarten. Weil ihr Glas leer war, holte ich, ohne zu fragen, einen weiteren Likör. Sie nickte und bediente sich. So saßen wir zehn Minuten. Ich trank meinen Gin Tonic, sie nippte an ihrem Cointreau. Die Musikbox spielte, und die beiden Glücksspielautomaten dudelten und sprachen mit Menschenstimmen. Wurfpfeile sausten in die Zielscheibe, und eine Gruppe von einheimischen Biertrinkern lachte laut über Männerwitze.
Auf einmal setzte sich Mrs. Shearer auf. Sie schaute mir wieder mit diesem Blick direkt in die Augen und sagte: »Ich kann Ihnen Dinge erzählen, die für Sie sehr interessant sein werden. Aber Sie müssen den Namen meines Mannes, von einer bloßen Erwähnung abgesehen, unter allen Umständen aus dem Spiel lassen! Das ist meine einzige Bedingung, aber von ihr rücke ich nicht ab.«
Ich überlegte kurz. »Wenn ihr Mann am Untergang der ‚Palermo Express’ unbeteiligt war, die Katastrophe also in keiner Weise mitverursacht hat – Sie wissen, wie ich das meine –, kann ich ihn völlig außen vor lassen,« erwiderte ich. »Ich soll nur klären, warum das Schiff verloren ging!«
»Howard trifft keine Schuld – das weiß ich mit Sicherheit«, sagte Mrs. Shearer. »Und die Ursache der Katastrophe interessiert mich mindestens ebenso sehr wie Sie!« Ihre Augen wanderten einen Moment zum Fenster. Dann lehnte sie sich vor, dämpfte ihre Stimme zu einem Flüstern und sagte: »Wenn Sie mir Ihr Ehrenwort als Earl geben, die Person und den Namen meines Mannes in Ihrem Bericht nicht zu beschmutzen und meine Angaben strikt für sich zu behalten, erzähle ich Ihnen, was geschehen ist. Ich kann mir vieles nicht erklären – aber ich habe die Katastrophe miterlebt. Ich war sozusagen dabei, als das Schiff sank!«