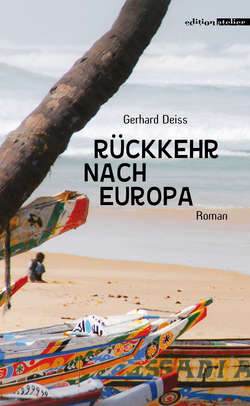Читать книгу Rückkehr nach Europa - Gerhard Deiss - Страница 11
VI
ОглавлениеAls ich mich nach meiner Rekonvaleszenz kräftig genug fühlte, wollte ich meine frühere Tätigkeit auf der Corniche wieder aufnehmen. Gegen die Bettelei hatte sich allerdings in mir ein innerer Widerstand entwickelt, vielleicht auch, weil ich in den letzten Tagen so viel erhalten hatte, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Ich fragte Aziz, ob er mir ein Kontingent von zu verkaufenden Wertmarken überlassen könnte. Er lehnte jedoch ab.
»Du musst verstehen, Mamadou, ein weißer Wertmarkenverkäufer würde allen anderen das Geschäft wegnehmen, zu sensationell wäre es, dass ein Schwarzer einem Weißen etwas auf der Corniche abkaufen soll. Meine anderen Verkäufer kämen stark ins Hintertreffen, Proteste und Streitigkeiten wären die Folge. Nein, gleiche Wettbewerbsbedingungen müssen aufrechterhalten werden.«
Ich fragte mich, ob Aziz einmal ein Wirtschaftsstudium begonnen hat, aber seine Begründung war einleuchtend. So kehrte ich etwas widerwillig zu meinem Bettlerdasein zurück. Ich suchte mir einen Standort am Boulevard de la République, der von höheren Häusern auf beiden Seiten eingesäumt wird und wo die Laubbäume mehr Schatten spenden als die kümmerlichen Palmen auf der Corniche. Allerdings warf man mir auch dort vor, als Weißer den zahlreichen anderen Bettlern die Almosen wegzunehmen. Anders als auf der Corniche leben die Bettler dort zum Teil sogar auf der Straße. Einige Kreuzungen sind Standorte von Rollstuhlfahrern, an anderen versuchen Gehbehinderte ihr Glück, zwischendurch Blinde, meist alte Männer, die von Kindern geführt werden. Und überall tauchen die Talibés auf, zerlumpte Kinder mit ihren leeren Konservendosen, deren Inhalt sie abends ihrem Koranlehrer abzuliefern haben.
Alle verbündeten sich gegen mich. Am aggressivsten waren die Rollstuhlfahrer, die mich am ersten Tag bereits regelrecht einkreisten und bedrohten. Ohne Gebrechen hätte ich hier nichts zu suchen und als Weißer schon überhaupt nicht. Einige der sich auf Krücken vorwärts Bewegenden wollten, dass ich ihnen zumindest einen Teil meines Tageserlöses ablieferte. Und einmal kam ein Marabout vorbei, beschuldigte mich, dass seine Talibés meinetwegen mit leeren Dosen nach Hause kämen, und holte einen Polizisten (der früher ebenfalls einmal sein Schüler, und anders als viele der ausschließlich zum Betteln herangezogenen sogar ein richtiger Schüler gewesen war). Der hörte sich die Anschuldigungen an und tat, was Polizisten dort üblicherweise tun.
»Pass, Aufenthaltsgenehmigung!« Beides hatte ich nicht bei mir, sie lagen in der Höhle. Dass ich eine Höhle auf der Corniche bewohnte, wagte ich nicht zu sagen, denn das ist im Allgemeinen strengstens verboten.
»Na, dann muss ich dich mitnehmen, es sei denn …« Er streckte mir seine Hand mit einer unmissverständlichen Geste entgegen. Ich sah mich bereits in einem der hoffnungslos überfüllten Gefängnisse wieder und gab ihm alles, was ich an Bargeld bei mir hatte. Der Polizist nickte zufrieden, gab gleich einen Teil dem Marabout weiter und sagte: »Wehe, ich sehe dich hier wieder, dann landest du im Loch!«
An jenem Abend, als ich ratlos und hungrig zu meiner Höhle zurückkehrte und die Corniche zum Meer hin überquerte, überfiel mich eine so große Leere, dass ich meinte, ein Sturz vom Felsen herab wäre das Beste, was mir passieren könnte. Ich ging zum Absturz vor, stellte aber fest, dass ein derartiger Sprung nicht unbedingt tödlich ausgehen müsse, zu niedrig war der Felsen und von etlichen Vorsprüngen zergliedert. Kein glatter Tod.
Während ich so dastand, war wie aus dem Nichts plötzlich Coumba hinter mich getreten, in Begleitung von Aziz, der ja über alles, was sich auf diesem Teil der Corniche und auf dem angrenzenden Teil des Boulevards abspielt, bestens Bescheid weiß. Er ließ uns aber gleich allein und zog sich zurück, uns etwas zweideutig eine gute Nacht wünschend.
Plötzlich war alles anders. Vergessen waren die Absichten von eben, Hunger und das Gefühl totaler Leere. Ich ergriff ihre Hände und suchte ihr Gesicht im Dunkel. Ihre Augen waren offensichtlich zuerst etwas scheu zu Boden gerichtet, dann glänzten sie mir entgegen, als würden zwei Sonnen gleichzeitig aufsteigen.
Wortlos stiegen wir zu meiner Höhle hinab, wortlos legten wir uns auf meine Matte und ließen unsere Körper ineinander übergehen. Das Meer rauschte wohl heftiger als sonst, nicht nur hatte die Flut eingesetzt, sondern draußen auch ein Sturm, der die Wellen der Brandung bis zur Höhle aufspritzen ließ.
Doch nachdem wir einander zum wiederholten Mal umarmt hatten, wurde mir mit einem Mal schwarz vor Augen. Gerade noch konnte ich Coumba bitten, mir etwas zu trinken zu beschaffen, dann trat ich weg, ab in die schwarze Zwischenwelt. Ein kleiner Tod, nicht der petit mort als Nachklang eines besonders vollkommenen Liebesakts, der hauptsächlich dem anderen Geschlecht beschieden ist, nein, ein simpler Rückfall, wenngleich auch nicht so heftig wie vor ein paar Tagen, als ich in die Klinik eingeliefert wurde. Dank Coumbas gutem Zureden, es war mehr ein beschwörendes Murmeln, und einer Flasche Wasser, die sie mir einflößte, kehrte ich wieder zurück.
»Coumba, die Zauberin, die Verzauberin«, murmelte ich leise. Sie lächelte und legte ihre Hand auf meine Lippen. In jener Nacht nahm sie mir das Versprechen ab, dass ich mich gleich am nächsten Tag an die Behörden meines Heimatstaates wenden würde, um deren Hilfe zu erbitten.
Dieses Versprechen war mir wie ein Wermutstropfen, der die Erinnerung an unsere erste gemeinsame Nacht am nächsten Morgen verbitterte. Coumba war nicht mehr da, sie hatte angekündigt, noch in der Nacht in das Haus ihrer Schwester zurückkehren zu müssen, da man sonst über sie reden würde. Widerwillig schlüpfte ich in meine zerrissenen europäischen Kleider.
Der Zugang zur Botschaft wurde von zwei Uniformierten einer der hier üblichen Bewachungsfirmen kontrolliert. Ich bin zwar ein Weißer, aber mein ungepflegtes Äußeres hatte diesen Vorteil wieder zunichtegemacht. Man verweigerte mir den Eintritt. Ich wurde laut, was wiederum die Aufmerksamkeit eines Anzugträgers weckte, der gerade mit einer Limousine samt Landesflagge vorfuhr und offenbar erwartet wurde, da man ihm bereitwillig den Eingang öffnete. Ich nutzte diese Gelegenheit und schlüpfte hinter ihm in das Gebäude. Ein weißer Polizist, offenbar ein Landsmann von mir, hielt mich auf. Er sprach mich gleich in meiner Muttersprache an – offensichtlich war er des Französischen nicht mächtig –, und das mit einer starken dialektalen Färbung.
Mir war es unangenehm, in meiner Muttersprache reden zu müssen. So lange war es her, als ich sie das letzte Mal verwendet hatte. Zunächst sprach ich wohl in einer Mischung aus Französisch und Deutsch, was bei dem Polizisten für Misstrauen sorgte, denn der Eingang, durch den ich hineingeschlüpft war, sei nur für Landsleute bestimmt, wie er mir sehr amtlich erklärte. Aber nach einigen Sätzen meinerseits war sein Misstrauen zerstreut, er nahm meine Personalien auf und meldete mich beim »Herrn Konsul« an.
Im Raum, in dem ich wartete, blickte mich stumm ein Gesicht auf einem Porträtfoto an, wohl jenes unseres aktuellen Staatschefs, denn ich kannte diesen weder vom Namen noch vom Aussehen her. Er sah nicht streng aus, sondern hatte ein liebenswürdiges verbindliches Lächeln aufgesetzt, wie es die Berater heutzutage wohl allen Politikern empfehlen, auch jenen, die bereits gewählt sind, vielleicht damit sie bereits für eine Wiederwahl werben können.
Auch einige – alte – Zeitungen aus der Heimat lagen auf, wohlgeglättet und ausgerichtet. Ich fühlte mich nicht zu Hause, sondern eher unangenehm an etwas erinnert, dem ich einst hatte entkommen wollen.
Der Konsul war ein Mann fortgeschrittenen Alters, glatt rasiert und mit offenem Hemd, aber mit makellos gebügelter Hose und glänzenden schwarzen Schuhen, deren benagelten Sohlen der Steinboden besondere klangliche Vornehmheit zuteil werden ließ. Auch er setzte das verbindlich-freundliche Lächeln des Staatsoberhauptes vom Foto auf. Was er für mich tun könne, erkundigte er sich, während er meinen Anmeldezettel überflog und meinen Pass durchblätterte. Beim Anblick des Einreisestempels runzelte er die Stirn. Als ich nicht nur die Frage nach finanziellen Mitteln, sondern auch nach einer Aufenthaltsgenehmigung verneinte, war das Lächeln endgültig verflogen. Er war mit einem Problemfall konfrontiert. Ich erzählte ihm von meinem Zusammenbruch und vom Drängen meiner Freundin, mich in Europa behandeln zu lassen. Als er merkte, dass mir selbst gar nicht so sehr an einer Rückreise und einer finanziellen Aushilfe lag, schien er zuerst erleichtert, dann aber wieder nervös, als sein Blick zufällig auf die aufliegende meistverkaufte Zeitung unserer Heimat fiel, auf deren Titelseite in dicken Lettern die angeblich mangelnde Unterstützung für einen hilflosen Pensionisten durch eine Auslandsvertretung empört kommentiert wurde (diese hatte sich geweigert, dem Bittsteller Geld für den Kauf eines teuren, doch im Vergleich zu Europa wiederum spottbilligen Seidenanzugs vorzuschießen).
Ob ich zu Hause Verwandte hätte? Diese Frage hatte ich befürchtet. Ob meine Eltern noch lebten? Meine Mutter war ja tot, ob mein Vater noch lebte, war mir nicht bekannt. Widerwillig erwähnte ich Adele, meine ältere Schwester, konnte aber keine Adresse bekannt geben. Adele hatte sich vor einiger Zeit scheiden lassen, ob sie ihren früheren und damit meinen Familiennamen angenommen hatte, war mir entfallen.
»Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden sie schon finden. Sicher wird sie ihrem Bruder aus der Klemme helfen und den Heimflug bezahlen können.«
Er mahnte mich, diese Hilfe auch tatsächlich anzunehmen. Die Botschaft werde gerne behilflich sein, die Fahrt zum Flughafen und das Check-in zu organisieren, ebenso auch die Frage des illegalen Aufenthalts mit den Behörden des Landes zu klären. Man verfüge über hervorragende Beziehungen, schließlich würden die maßgeblichen Personen stets zu diversen Essen und Empfängen eingeladen, die niedrigeren Chargen erhielten die üblichen Aufmerksamkeiten. Wo man mich zur Zeit erreichen könnte? Als ich ihm die Höhle beschrieb, zuckte er zusammen, dorthin etwas zustellen zu lassen, erschien ihm absurd.
»Wir lebten früher alle in Höhlen, vor allem unsere Vorfahren zu Hause in den gebirgigen Regionen. Ich sehe nichts Abwegiges darin.«
Der Konsul versuchte, auch hier das Beste herauszuholen: »Besser, Sie melden sich in zwei bis drei Tagen bei uns.«
Als ich nach vier Tagen ebenso widerwillig wie das erste Mal bei der Botschaft erschien, war der Konsul bestens gelaunt: »Ihre Frau Schwester war gleich bereit, Ihnen ein Flugticket zu buchen und Sie daheim an den richtigen Arzt zu vermitteln. Wann wollen Sie fliegen?«
Ich war erstaunt, dass Adele tatsächlich etwas für mich tun wollte.
»Da muss ich erst mit Coumba reden, sie muss auf jeden Fall mit mir nach Europa.«
Das Gesicht des Konsuls verdüsterte sich: »Wie stellen Sie sich das vor, ohne Visum kommt die Dame nicht nach Europa. Dafür muss sie erst einen Antrag bei uns stellen, wobei sie besonders nachweisen muss, hierzulande verwurzelt zu sein, sprich, nicht die Absicht zu haben, sich klammheimlich während einer als kurzfristig angegebenen Reise – und nur eine solche kann sie überhaupt hier beantragen, soweit ich das sehe – in Europa niederzulassen und die Zahl der bereits vorhandenen Illegalen noch weiter zu erhöhen. Illegale wie Sand am Meer! Sehen Sie sich doch nur die Strandverkäufer in Italien an. Der europäische Tourist kann sich ja gar nicht richtig erholen angesichts der zahlreichen Belästigungen und der Realitäten auf dieser Welt, denen er ausgesetzt ist. Die Schwarzen haben ja schon alle Bastionen gestürmt – sehen Sie sich doch nur die französische Fußballmannschaft an, kein Weißer mehr darunter! Täglich die Nachrichten von Durchbrüchen an den Grenzzäunen um die spanischen Exklaven in Marokko und über die Ankunft Tausender auf Booten über das Mittelmeer. Da müssen doch zumindest wir unseren bescheidenen Beitrag leisten und, soweit es geht, das illegale Ausnützen von Besuchsvisa unterbinden.«
Er biss sich auf einmal auf die Lippe, offenbar hatte er sich gehen lassen und war sich dessen erst jetzt bewusst geworden.
»Verzeihen Sie, wenn ich jetzt emotional wurde, aber wir sind hier tagtäglich eben mit allen möglichen Versuchen konfrontiert, zu einem Visum für das magische Schengenland zu gelangen. Ganz als hätten die Leute hier nicht genug mit dem Magic Land, dem Vergnügungspark auf der Corniche, nein, es muss mehr sein als das, die eine Illusion reicht ihnen wohl nicht.«
Und er fing an, das, wie er es nannte, »Regelwerk« des Schengener Kodexes zu zitieren, als ob ein Schauspieler den Faust rezitiert, oder eher noch aus dem Tractatus logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein, demzufolge ja die Welt alles ist, was der Fall ist. Erschöpft hielt er nach einiger Zeit inne, blickte auf die Armbanduhr und drückte mir seufzend ein Formular in die Hand, mit dem Coumba ihr Visum beantragen könne.
»Aber machen Sie sich keine Hoffnungen, dass sie es auch bekommt«, meinte er zum Abschied, indem er mich mit einem Händedruck sanft durch die Eingangstür ins Freie hinausschob.
Als ich Coumba vorschlug, sie solle mich nach Europa begleiten – denn ich war mir damals sicher, dass ich dank Adele alles bekommen würde, das zweite Ticket und das Visum –, war sie verwundert, ja eigentlich schien sie alles andere als erfreut.
»Aber wenn du meinst, dass du nicht allein reisen kannst, komme ich natürlich mit. Was wird nur meine Familie dazu sagen? Viele meiner Bekannten träumen davon, nach Europa zu reisen und dort arbeiten zu können. Ich meinerseits fühle mich hier bei uns recht wohl. Ich würde den Ruf des Muezzins vermissen, die heiße Sonne unserer Heimat, die warmen Abende, wenn wir alle im Freien sitzen und uns austauschen, jeder über sein Leben, seine Erlebnisse, auch wenn sie vielleicht nur einfach und ärmlich sind. Meine Schwester, ihre Kleinen, meine Freundinnen, meine Arbeitskolleginnen bei Madame Mbengue, wir sind doch alle wie eine große Familie, die ich zurücklassen müsste.«
Ich war enttäuscht. Wäre die Fahrt nach Europa nicht auch eine Verbesserung ihres Lebens?
»Dann fahre ich halt allein«, reagierte ich trotzig und wandte mich beleidigt ab. Sie begann zu weinen. Still flossen die Tränen über ihr hübsches Gesicht.