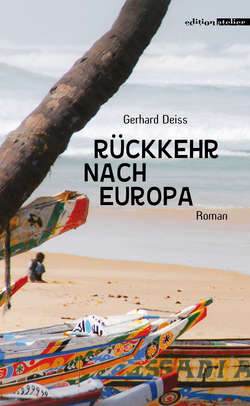Читать книгу Rückkehr nach Europa - Gerhard Deiss - Страница 8
III
ОглавлениеDie ersten Sonnenstrahlen fallen schräg ins Boot und beleuchten Coumbas Gesicht. Sie wacht langsam auf und reibt sich die Augen. Ich war zuvor wach geworden, weil ich den allgemeinen Kübel zur Verrichtung der Notdurft benötigte. Die Sonne fällt nun auch auf mich. Ich halte mir die Hand vors Gesicht, aber es ist zu spät. Aufgeregte Stimmen erheben sich, als die anderen Bootsinsassen der zwei Außenseiter ansichtig werden.
»Ein Weißer und eine Frau an Bord – das sind sicher Spione«, rufen die einen, »Sie bringen auf jeden Fall Unglück«, die anderen.
Das Boot gerät ziemlich ins Wanken, als die Passagiere zu unserem Schlafplatz stürzen oder auch fallen, abhängig von den weiterhin starken Schwankungen, denen unser Platz im Bug ausgesetzt ist.
»Spione – sie geben sicher der Küstenwache Signale. Und wenn nicht: Ein Weißer an Bord bringt Unglück, eine Frau noch viel mehr!«
Sie schreien heftig durcheinander. Einer der Lebous schlägt vor, man solle die zwei Eindringlinge dem lokalen Meeresgott opfern. Wenngleich die Muslime in Afrika meist noch über animistische Wurzeln verfügen, geht das den meisten doch zu weit: »Unschädlich machen ja, aber nicht als Opferung. Es gibt keinen Gott außer Allah. Fesselt sie, damit sie nichts anstellen können.«
Der alte Mann, offenbar der Anführer der Gruppe aus Guinea, ist trotz seiner sanften Stimme sehr bestimmt. Man will uns bereits mit den Fischernetzen festbinden, da tritt Badou dazwischen.
»Ich bin hier der Kapitän und bestimme, was geschieht. Coumba und Mamadou haben nicht nur das Doppelte für die Überfahrt bezahlt, sie stehen auch unter meinem persönlichen Schutz. Wehe, jemand rührt sie an.«
Betretenes Schweigen weicht nach einiger Zeit halblautem Gemurmel. Unsere Mitreisenden haben sich mit den Umständen abgefunden. Wenn sie uns auch in der Folge nichts antun, so ignorieren sie uns aber weitgehend und rücken räumlich, soweit es der beschränkte Platz zulässt, von uns ab, was uns immerhin mehr Komfort verschafft. Nur der junge Mann zu meiner Rechten, der während der gesamten Auseinandersetzung nichts gesagt und offenbar weitergeschlafen hat, verbleibt auf seinem Platz, die Decke über den Kopf gezogen und in sich gekrümmt wie ein Embryo im Mutterleib des Bootes liegend. Das nun sanfter werdende Meer tut auch das Seine, um die Gemüter zu beruhigen. Die steigende Sonne und die sanften Wellenschläge gegen die Ada Bintou versetzen die meisten in einen quasi euphorischen Zustand. Es scheint, als mache die Ada Bintou gute Fahrt und als sei es überhaupt nur noch eine Sache von wenigen Stunden, bis wir die Inseln erreichen würden.
Ich stelle mir vor, wir befänden uns an Bord eines großen Ozeandampfers, wie er vor einigen Jahrzehnten noch das gängige Fernreisevehikel war, ehe ihn die Flugzeuge gänzlich verdrängten, als noch nicht die hypertrophen Kreuzfahrtschiffe, hoch wie Wolkenkratzer, nur zu Vergnügungszwecken und ohne ein wirkliches Ziel mit Tausenden vornehmlich älteren und wohlhabenden Weißen auf den Weltmeeren kreuzten. Auch wenn wir hier ein Ziel haben, lassen wir uns von der Sonne bescheinen und sehen den glitzernden Wellenkämmen zu. Schon ist der Aufruhr von zuvor vergessen. Coumba fängt sogar an, mit ihrer schönen Stimme leise einige Lieder vor sich hin zu summen, als wolle sie das sich wiegende Boot wie ein Kind zum Einschlafen bringen. Die Sonne lässt nicht nur die Wellen mit einer silbernen Aura glitzern, auch Coumbas Gesicht erstrahlt darin. Fast verklärt erscheint sie mir, wie sie zurückgelehnt mit halb geschlossenen Augen vor sich hin singt. Ich muss mich beherrschen, nicht ihre langen Wimpern zu küssen, ein derartiger Akt hätte an Bord wieder für Unruhe gesorgt. Aber sie wird ohnehin immer weniger die Frau, die ich begehre und die ich in meine Arme schließen möchte, sondern vielmehr entrückt, fast wie eine Göttin, die zu uns Irdischen in dieses Boot gestiegen ist, um uns mit ihrer Gegenwart zu beglücken. Während ihres Gesanges merke ich an manch verstohlenen Blicken der anderen Bootsinsassen, dass diese beginnen, Ähnliches zu empfinden.
Als die Sonne hoch über dem Horizont steht, ruft einer der Guineer nach längerem Studium seiner Armbanduhr zum Mittagsgebet auf. Verunsichert ist seine Stimme, schließlich ist er es nicht gewohnt, einen Muezzin zu ersetzen. Doch hier gilt es, sich zu behelfen und selbst die Initiative zu ergreifen. Die anderen Guineer wechseln von der sitzenden in eine kniende Position und beten halblaut vor sich hin. Die übrigen Bootsinsassen schließen sich dem nicht an. Erst eine halbe Stunde später ruft ein kleiner Serer mit melodiöser Stimme zum Gebet, offenbar auf Wolof, um von allen verstanden zu werden, jedenfalls nicht auf Arabisch, dazu fehlt ihm wohl die Übung. Jetzt wären die Guineer an der Reihe, sich in ihren Gesprächen zurückzuhalten. Halblaut setzen sie ihre Konversation fort. Nach Ende des Gebets wird ihnen vorgeworfen, gestört zu haben. Wir selbst werden gar nicht wahrgenommen. Coumba hat bereits vor geraumer Zeit mit dem Singen aufgehört, da sie darüber eingeschlafen ist. Ich stelle mir vor, die Gebete werden an sie gerichtet.