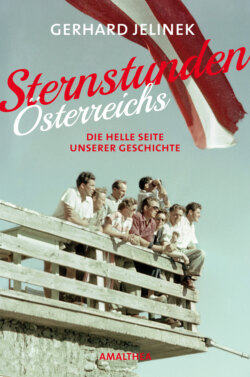Читать книгу Sternstunden Österreichs - Gerhard Jelinek - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1797
Оглавление»Die Vernunft wird Gesetz«
Josef II. und seine Reformen – das Westgalizische Gesetzbuch
»Die Partei der Ignoranz ist immer ohne Vergleich die Stärkere, kein Wunder also, dass sie auch noch die Oberhand behält.« Karl Anton Freiherr von Martini schreibt die eher bittere Erkenntnis in einem Brief an seinen Freund Josef Anton Riegger im Jahre 1777, also zwölf Jahre vor Beginn der Französischen Revolution, die Europas feudales System schwer erschüttern sollte. Im Josefinischen Wien hat sich zur Zeit der Aufklärung eine Gruppe von bemerkenswerten Männern zusammengefunden: Joseph von Sonnenfels, Karl Egon Fürst zu Fürstenberg, Gottfried Freiherr van Swieten, Franz Martin Pelzel und der Naturrechtsgelehrte Karl Anton Freiherr von Martini. Die gelehrten Herren sind von einem Gedanken beseelt: der Vernunft zum Sieg zu verhelfen, und sie genießen das Wohlwollen des Herrschers. Josef II. versucht in wenigen Jahren nach dem Tod seiner alles überstrahlenden Mutter Kaiserin Maria Theresia Österreich seine Reformen von oben aufzuzwingen. »Ich habe aufgehört, Sohn zu sein, und das war doch, was ich am meisten zu sein glaubte.« Josef der Sohn, der aus dem großen Schatten seiner Mutter fast heraus»flüchtet«, wird dabei in vielen Bereichen scheitern. Doch der Fortschritt, der in seinem Scheitern bleibt, macht die Habsburgermonarchie zu einem einigermaßen modernen Staat. Josef II. greift überall ein und überall hin. Von Gottes Gnaden und im Auftrag der »Aufklärung« verpasst er dem Bildungs- und Rechtssystem seiner Monarchie einen Modernisierungsschub ohne Beispiel.
Das Toleranzpatent von 1781 ist ein Meilenstein der österreichischen Geschichte. Durch das Machtwort des Kaisers wird die gesellschaftliche Stellung der Protestanten, der orthodoxen Christen und der Juden verbessert. Die Beschränkungen zur Ausübung ihres Glaubens fallen schrittweise. Der absolute Herrscher öffnet die Universitäten auch für Nichtkatholiken und gibt damit Millionen seiner – noch sind sie es – Untertanen neue Lebenschancen. Obwohl der katholische Monarch weiterhin die staatstragende Bedeutung der römischen Kirche nicht antastet, dürfen fortan Andersgläubige Gotteshäuser errichten und zu dem Gott beten, an den sie glauben. Vor allem die jüdische Bevölkerung erlebt Josef II. als großen Befreier. Die Reformen stehen am Beginn der jüdischen Emanzipation und des Aufstieges des jüdischen Bürgertums zu einer der tragenden Säulen des Kultur- und Wirtschaftslebens der Habsburgermonarchie.
Buchstäblich zum Befreier wird der Kaiser durch die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern. Der größere Teil der Bevölkerung lebte am Ende des 18. Jahrhunderts am Land, sehr oft in bitterer Not und persönlicher Unfreiheit. Die noch aus dem Mittelalter abgeleiteten feudalen Rechte zwangen die Landbevölkerung zu Arbeit auf den Gütern des Adels, der noch dazu von der allgemeinen Grundsteuer befreit war. Mit der Abschaffung dieser Privilegien und der Befreiung der Bauern zog sich der Habsburger in Wien die Feindschaft weiter Kreise des Adels zu. In den nur zehn Jahren seiner Herrschaft fegten die Reformen Josef II. und seiner Berater mit eisernem Besen durch mittelalterliche Ordnungen.
Der Kaiser brach auch die verkalkten Strukturen der katholischen Kirche auf. Er löste etwa ein Drittel aller Klöster auf, kassierte das Eigentum der Orden und zwang Mönche und Nonnen zur Arbeit in Schulen und Spitälern. Den Erlös aus dem Zwangsverkauf des Kirchenvermögens investierte der Kaiser in einen Religionsfonds, aus dem neue Pfarren bezahlt werden sollten. Die römische Amtskirche wurde so zu einer österreichischen Beamtenkirche umgebaut, der Pfarrer wurde zum »Beamten im schwarzen Rock«. Gegen die Rückständigkeit der Kirche setzte Josef eine staatliche Ausbildung der Religionslehrer und Priester. Die enge Verknüpfung von Staat und Kirche, die Österreich bis in die Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts prägen sollte, geht maßgeblich auf die »Verstaatlichung« der Kirche im Jahrzehnt der Regentschaft Kaiser Josef II. zurück. Wütende Proteste des römischen Papstes Pius VI. ignorierte er. Der Kaiser sperrte das Kirchenoberhaupt anlässlich seines Besuches in Wien praktisch in der Hofburg ein, ließ gar in seinen Gemächern eine eigene kleine Kapelle hinter einer Wandvertäfelung errichten, damit der Heilige Vater seine Gebete von der Öffentlichkeit abgeschirmt verrichten konnte – ja eigentlich musste. Amtierende republikanische Bundespräsidenten zeigen ausländischen Staatsgästen gern die »Einbaukapelle« hinter barocker Vertäfelung. Die Überraschung ist ein Fixpunkt der Führung durch die Prunkräume im Leopoldinischen Trakt der Hofburg.
Niemals zuvor und niemals danach wagte es ein Regierender in Österreich, so tiefgreifende Maßnahmen so rasch umzusetzen. Populär und beliebt wurde der Sohn Maria Theresias damit nicht. Immerhin bewirkten die teilweise brachial durchgeführten Reformen, dass es in der Habsburgermonarchie am Ende des 18. Jahrhunderts zu keiner blutigen Revolution kam, wie in Paris. Ein wichtiges Erbe der kurzen Josefinischen Epoche ist der langlebige österreichische Beamtenstaat, der bei seiner Schaffung ein Attribut eines modernen Staats war.
Schon Josefs Mutter, Kaiserin Maria Theresia, hatte mit dem Aufbau eines schlagkräftigen Beamtenapparats begonnen, da ihr die Unfähigkeit des alten Systems auf die Nerven ging. Maria Theresia begann die Sache systematisch und stiftete eine eigene Anstalt zur Ausbildung eines »Beamtenadels«, die Theresianische Akademie, die es heute noch als Stiftung und höhere Schule in Wien gibt. Zum Todestag der Kaiserin müssen heute noch »Theresianisten« am Grabmonument der Kaiserin in der Kapuzinergruft einen Kranz niederlegen. Von der einst großzügigen Stiftung ist im Zeitenlauf nicht mehr viel geblieben. Das einstige Jagdschloss Maria Theresias »Favorita« beherbergt aber immer noch die Schule, und in der früheren Reitschule des Instituts hat sich die Diplomatische Akademie eingemietet.
Für das Funktionieren des Beamtenapparats bedurfte es klarer Regeln und vollziehbarer Gesetze. Karl Anton Freiherr von Martini wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Der in »Welsch-Tirol« geborene Jurist schreibt praktisch im Alleingang eine neue Zusammenfassung des gesamten Privatrechts. Der ideale Beamte aus der Sicht Kaiser Josefs II. war Teil einer gemäß den präzisen Vorgaben der Gesetzeslage »selbstlos und vorurteilsfrei« arbeitenden Verwaltungsmaschinerie. So ist eine der größten österreichischen Leistungen die Implementierung einer funktionierenden Verwaltung, die viel verspottet, karikiert und kritisiert wurde, doch eine wichtige Stütze der Monarchie bildete.
Martinis »allgemeines bürgerliches Recht« wird von Josefs Nachfolger, Kaiser Leopold II., mit einem »Patent vom 13ten Februar 1797« für das soeben erst erworbene polnische Gebiet Westgaliziens in Kraft gesetzt. Schon die Präambel gibt die Richtung vor: »In der Überzeugung, wie erwünscht und beruhigend jedem Bürger es sey, den Umfang und die Grenzen seiner Rechte und seiner Pflichten gegen seine Mitbürger in einem ordentlich zusammengefassten Gesetzbuche bestimmt zu haben, und dadurch den Genuß seiner Rechte befestigt, die Erfüllung seiner Pflichten erleichtert, seine Person und sein Eigenthum gegen ungerechten Anfall geschützt zu wissen, wird geordnet, die Unterthanen in Westgalizien dieser Wohltat so geschwind als möglich theilhaft zu machen.«
Es ist eine wahrhaft revolutionäre Tat, den Bürgern nicht nur Pflichten, sondern auch klare Rechte öffentlich kundzumachen und damit Untertanen mit Rechten auszustatten. Es ist die Befreiung von Willkür. Es ist eine rechtliche Großtat, auf der unser heutiges Rechtssystem noch immer aufbaut. Was damals eine kaiserliche »Wohltat« war, ist heute ein Menschenrecht. Während in weiten Teilen der Monarchie noch das alte Mariatheresianische System galt, konnten sich die galizischen Neubürger des österreichischen Kaiserreichs auf ein modernes Rechtssystem berufen: »Jedermann sich nach demselben zu achten, nach demselben in allen Verhältnissen des bürgerlichen Lebens seine Handlungen einzurichten, seine Kontrakte abzuschließen, seine lebzeitigen oder letztwilligen Anordnungen zu errichten, seine Rechte zu genießen, seine Pflichten zu erfüllen, und allen seinen Geschäften die zweckmäßige Richtung zu geben, nach selben Recht zu suchen und zu nehmen, die Gerichtshöfe aber hiernach bei vorfallenden Zwistigkeiten Recht zu sprechen und Hilfe zu erteilen wissen.«
In der Form antiquiert, im Inhalt revolutionär fortschrittlich. Kaiser Josef II. und seine Nachfolger machen den Untertan zum Bürger. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch gibt den Menschen Rechte und Pflichten – allen gleich.
In den »deutschen Erblanden« war ein Jahrzehnt zuvor noch unter Kaiser Josef II. der erste Teil eines geplanten umfassenden allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft gesetzt worden. Das Josefinische Gesetzbuch enthielt freilich nur das Ehe-, Erb- und Kindschaftsrecht, aber damit jene ideologisch sensiblen Rechtsbereiche, die besonders im Zeitalter der Aufklärung wichtig geworden waren und die im Sinne der Vernunft die gesellschaftliche Veränderung markieren sollten. So wurde die Rechtsstellung der unehelichen Kinder deutlich verbessert. Die Regelung war dem eher klerikalen »Zeitgeist« um Jahrzehnte voraus. Es gab heftige Kritik an den »unmoralischen« Gleichstellungen zwischen ehelich und unehelich Geborenen. Die ehe- und erbrechtlichen Bestimmungen Josefs II. griffen tief in die Gesellschaft ein. So stellte der Kaiser der Aufklärung erstmals Söhne und Töchter im Erbrecht gleich. Was heute selbstverständlich anmutet, war anno 1786 eine Revolution. Er unterschied auch nicht mehr zwischen Erstgeborenen und später auf die Welt gekommenen Kindern. Josef II. griff mit seinem Erbfolgepatent frontal die Sonderrechte des Adels an, der einen Vorrang der Söhne vor den Töchtern und des Erstgeborenen vor seinen Geschwistern über Jahrhunderte verteidigt hatte. Durch die mit dem neuen Erbrecht erzwungene Aufteilung des Vermögens schwächte das josefinische Erbrecht den Adel zugunsten eines zwar aufgeklärten, aber absolutistisch regierenden Herrschers. Das Zeitalter der Vernunft war nicht notwendigerweise auch das Zeitalter der Demokratie.
Josefs Bruder und Nachfolger, Kaiser Leopold II., berief nach dem frühen Tod des 49-jährigen Reformkaisers ein neues Team zur Kodifizierung des Rechtes ein. Karl Anton von Martini wurde Präsident der »Hofkommission in Gesetzessachen« zur Ausarbeitung einer Gesamtrechtskodifikation und ging mit naturrechtlichem Pathos an die Sache heran. Kaiser Leopold II. hatte als Großherzog der Toskana sogar mit der Idee einer Einführung einer echten Verfassung gespielt. Diese Idee ging dann doch zu weit. Immerhin wollte Leopold das Bürgerliche Gesetzbuch um einen Politischen Kodex ergänzen, der die Rechte aller Staatsbürger garantieren sollte. Auch Leopold war damit seiner Zeit um fast sieben Jahrzehnte voraus.
Karl Anton von Martinis – weitgehend – eigenhändig verfasster Entwurf für ein umfassendes Gesetzbuch war von naturrechtlichen Ideen geprägt. Der Gesetzestext enthielt zahlreiche Bestimmungen, die erstmals in Österreich Grundrechte für die Bürger sicherten. Das Naturrechtsdenken der Neuzeit hatte sich im Anschluss an Martin Luthers Reformation entwickelt: Aus der Gleichheit aller Menschen vor Gott wurde die Gleichheit vor dem Gesetz, die prinzipielle Gleichheit aller Menschen untereinander.
Auch das war eine Revolution und eine Sternstunde.
Dieser Urentwurf des späteren Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) trat als Westgalizisches Gesetzbuch in einem kleinen, abgelegenen Teil der Monarchie in Kraft. Die wirtschaftlich unterentwickelte Region im Süden des heutigen Polen wurde zum rechtspolitischen Laboratorium, in dem das neue Paragrafenwerk erprobt werden konnte. Westgalizien war etwa zwei Drittel so groß wie das heutige Österreich, mit geschätzten 1,3 Millionen Einwohnern aber nur dünn besiedelt. Für die Monarchie stellte es einen weitgehend rechtsfreien Raum dar.
Wenig später wurde das Gesetzbuch auch im östlichen Teil Galiziens eingeführt. Österreich hatte sich Galizien mit der polnischen Königsstadt Krakau im Rahmen der sogenannten »dritten polnischen Teilung« 1795 einverleibt. Dabei wurde Polen wieder Opfer seiner Geografie. Zwischen den Mächten Preußen, Österreich und dem zaristischen Russland gelegen, zerfledderten diese das Land und beraubten es seiner Eigenstaatlichkeit.
Der Rechtsgelehrte Karl Anton von Martini wird in Revò – etwa dreißig Kilometer nördlich von Trient – als Carlo Antonio geboren. Seine Muttersprache ist Italienisch. Das Fürsterzbistum Trient ist zu dieser Zeit offenbar ein fruchtbarer Ort für Advokaten, Notare und Rechtsgelehrte. Vielleicht beflügelt die Nähe und der Einfluss oberitalienischer Universitäten wie Padua und Bologna das juristische Denken. Carlo Antonio besucht das Jesuitenkolleg in Trient und schreibt sich an der Universität in Innsbruck ein, wo er Philosophie und Theologie studiert, und zieht später nach Wien an die »Alma Mater Rudolphina«. In der Hauptstadt des Reichs hört Martini rechtswissenschaftliche Vorlesungen. Aus »Geldmangel oder aus Ablehnung des für Promovenden vorgeschriebenen Eides auf die unbefleckte Empfängnis Mariens« beendet er sein Studium ohne Promotion zum »Doktor iuris«. Universitätsprofessor wird er dennoch. Kaiserin Maria Theresia ordnet die juridische Fakultät neu und setzt den Trientiner auf den Lehrstuhl für »Institutionen und Naturrecht«. Die Kaiserin kennt und schätzt ihn. Martini ist am Hof Maria Theresias in die Erziehung der Prinzen eingebunden. Er macht das offenbar so gut, dass die Monarchin seine Leistungen mit der Verleihung des Reichsritterstandes würdigt. Der geborene Welschtiroler darf sich mit dem Prädikat »Edler zu Wasserberg« schmücken. Martini ist offenbar ein hervorragender Lehrer, der es versteht, eine Generation von begabten Juristen zu fördern, sie in wichtige staatliche Positionen zu bringen und so ein »naturrechtliches Netzwerk« aufzubauen. Als Krönung seines beruflichen Lebenswerkes erhält der mit 64 Jahren bereits pensionsreife Martini im Jahr nach Ausbruch der Französischen Revolution die Chance, die Kodifikation eines bürgerlichen Gesetzbuches als »Gesetzgebungsminister« zu fördern.
Ein typischer Österreicher: Carlo Martini wird im Trentino geboren, spricht italienisch und schafft eine »deutsche Rechtssprache«. Sein Entwurf für ein Westgalizisches Gesetzbuch wird zur Grundlage des ABGB – ein Gesetzbuch für das Volk.
»Reformer« ist unter dem Regime der Kaiserin eine Berufsbezeichnung. Martini modernisiert die Gymnasien, arbeitet als Richter und Staatsrat, sitzt in der kaiserlichen Zensurkommission und begleitet die Neuauflage des damaligen Kirchenrechts. Martinis rechtshistorische Leistung für das Gelingen der Arbeit am österreichischen bürgerlichen Gesetzbuch besteht darin, dass er sich von der Einzelfallsgesetzgebung des preußischen Rechts abwendet und dadurch die österreichische Privatrechtskodifikation strafft und verständlich macht. Zählte der Codex Theresianus noch 8367 Paragrafen, so kommt Martini mit einem Fünftel davon aus. Der Naturrechtler geht nämlich vom damals nicht selbstverständlichen Gedanken aus, dass ein Gesetzbuch auch von der einfachen Bevölkerung gelesen und verstanden werden sollte. Sein Entwurf für das Westgalizische Gesetzbuch richtet sich daher direkt an die Bürger. Es ist ein »Volks-Gesetzbuch«, das nicht nur für gefinkelte Juristen geschrieben ist. Viele Formulierungen wirken beinahe wie ein »väterlicher Ratgeber für das Volk«, und zwar nicht nur für das wachsende Bürgertum in den Städten, sondern auch für die Masse der Bauern und die neue Klasse der Arbeiter. In klarer Sprache werden die Gesetzesnormen anschaulich und beispielhaft formuliert. In seiner Denkschrift aus dem Jahre 1792 an Maria Theresias Nach-Nachfolger Kaiser Leopold II. wird deutlich: »Es wird sich die oesterreichische Gesetzgebung vor der preussischen durch Aufwand von Fleiß und Nachdenken wenigstens den Vorzug erringen können, daß die erste mehr gedrängt und populärer verfasst, und also auch die Gesetze besser begriffen und leichter behalten werden können.«
Dafür müssen die Paragrafen auch in einer für alle Volksschichten verständlichen Sprache geschrieben werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der am kaiserlichen Hof auch französisch gesprochen wird und Advokaten mit lateinischen Rechtsbegriffen und Ausdrücken argumentieren, disputieren und parlieren. Der Italiener Martini schafft also zunächst eine deutsche Rechtssprache: Einfachheit, Klarheit, Bildhaftigkeit und ein weitgehender Verzicht auf Fremdwörter sind seine Leitschnur. Er ist auch damit fortschrittlich und beinahe revolutionär. Schon der Philosoph Leibniz hatte ja geklagt, die Gelehrten in den deutschen Landen seien »allein mit dem Latein beschäftigt gewesen, und haben die Muttersprache dem gemeinen Lauf überlassen«. In seiner Arbeit an einer deutschen Sprache für die Rechtsprechung und die Verwaltung setzt Martini den Willen von Kaiser Josef II. um. Der Sohn Maria Theresias wollte einen weitgehend zentral gelenkten modernen Staat auf dem Gebiet der Monarchie mit ihrem Dutzend unterschiedlichen Völkern entwickeln. Dazu brauchte es eine gemeinsame Ebene der Kommunikation. Diese sollte eine reformierte deutsche Sprache bieten. Josef II. will Deutsch als alleinige Verwaltungs- und Verkehrssprache durchsetzen. Er hält das für vernünftig. Allerdings scheitert der Kaiser (und seine Nachfolger) an diesem ehrgeizigen Ziel. Das dem Westgalizischen Gesetzbuch folgende ABGB wird in alle Sprachen der Monarchie übersetzt. An der Vielfalt der Völker und Sprachen in ihren Regionen scheitern auch absolutistische Vorsätze.
Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) trat am 1. Jänner 1812 in den »Deutschen Erbländern der Österreichischen Monarchie in Kraft«. Franz von Zeiller, der Schöpfer dieses bis heute geltenden Gesetzeswerks, war ein Schüler Martinis. Zu dieser Zeit beherrschte Napoleon noch weite Teile Europas, in denen der französische Code Civil die Rechtsbeziehungen von Millionen Menschen regelte. Das ABGB bildet trotz zahlreicher Novellierungen nach wie vor die Grundlage des österreichischen Zivilrechtssystems, und es ist damit neben dem französischen Code Civil die älteste noch in Kraft stehende, von vernunftrechtlichen Gedanken geprägte Zivilrechtskodifikation. Und Martinis Urentwurf ist selbst dieser Tage nicht völlig überholt. Er wird in zeitgenössischen Streitfällen herangezogen. Die Tiroler Agrargemeinschaften berufen sich in ihrem Kampf um wertvolles (Bau-)Land auf Martini. Demnach stehen Rechte an Sachen dem Staat, den Bürgern und »Gemeinden« zu. In der historischen Juristensprache bedeutete eine »Gemeinde« einen Zusammenschluss von Privatpersonen – ein heute in Vergessenheit geratenes gesetzliches Organisationsmodell.