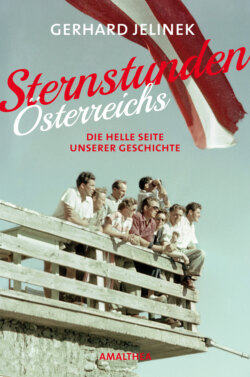Читать книгу Sternstunden Österreichs - Gerhard Jelinek - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1156
Оглавление»Zwei Fahnen für ein Herzogtum«
Die Geburtsstunde Österreichs
Österreichs Geburtsstunde ist eine Niederlage. Es ist der Spatz in der Hand statt die Taube auf dem Dach. Am 8. September des Jahres 1156 verzichtet Markgraf Heinrich II. Jasomirgott auf das mächtige Herzogtum Bayern. Jahrelang hat der Babenberger mit dem Welfen Heinrich, Beiname »der Löwe«, um das Herzogtum gerittert. Der Welfe siegt und herrscht in der bayerischen Landeshauptstadt Regensburg. Heinrich Jasomirgott weigert sich, seine untreue Hauptstadt auch nur zu betreten. Er, seine byzantinische Frau Theodora und das Gefolge schlagen ihr Lager rund drei Kilometer östlich der Mauern von Regensburg auf. Die Stadt im Blick. Ein Herzogtum verloren. Ein Herzogtum in Aussicht.
Der Babenberger vor der Stadt, sein Rivale hinter den Mauern. Beide Herren warten auf die Ankunft des Kaisers. Friedrich I. Barbarossa will den Streit zwischen Lehensmännern endlich schlichten. Während der vergangenen Monate haben seine Berater einen Kompromiss ausgearbeitet. Der Welfe soll sein angestammtes Bayern zurückbekommen, der Babenberger mit dem neu zu schaffenden »Herzogtum Österreich« abgefunden werden. Die Markgrafschaft ist nicht viel mehr als der östliche Teil des Herzogtums Bayern, ein Grenzland: Teile des heutigen Oberösterreichs und Niederösterreich. Den Kompromiss haben der Kaiser und die deutschen Fürsten auf dem Hoftag zu Regensburg beraten, verhandelt und schließlich beschlossen. Kaiser Friedrich I. Barbarossa ist an einem Ausgleich der Spannungen interessiert. Heinrich der Welfe und Heinrich der Babenberger haben beide gute Argumente für ihre jeweilige Rechtsposition. Es wird eine salomonische Lösung gefunden, die beiden Streitparteien einen gesichtswahrenden Ausstieg ermöglicht.
Besiegelt soll der Friedensschluss für alle sichtbar mit einer lehensrechtlichen Zeremonie werden: Samstag, der 8. September 1156, wird zum Geburtstag Österreichs.
Die Teilung des Herzogtums Bayern wird öffentlich erfolgen. Bischof Otto von Freising, ein Sohn des österreichischen Markgrafen Leopold III. aus dem Hause der Babenberger und der salischen Kaisertochter Agnes, Zisterziensermönch und größter Geschichtsschreiber der salisch-staufischen Zeit, ist der Chronist von Österreichs Geburtsstunde als eigenständiges Herzogtum. In seinen Gesta Friderici I imperatoris beschreibt er als Augenzeuge das Ereignis: »Mitte September kamen die Fürsten in Regensburg zusammen und erwarteten die Ankunft des Kaisers. Als dann die Begegnung des Kaisers mit seinem Oheim stattfand – dieser blieb nämlich zwei Meilen vor der Stadt in einem Zeltlager – wurde in Gegenwart aller Vornehmen und Großen die Vereinbarung, die man seit geraumer Zeit geheim gehalten hatte – veröffentlicht.« Das große Fürstentreffen findet im Lager Heinrichs »Jasomirgott« statt, der sich mit seinem Gefolge in den Barbinger Wiesen breitgemacht hat. Markgraf Heinrich empfängt seinen Onkel, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, vor seinem Zelt. Im Gefolge des Kaisers sind alle deutschen Fürsten aus der Stadt ins Lager geritten. Sie bilden die bunte Kulisse eines mittelalterlichen Staatsaktes: Otto Bischof von Freising ist ebenso anwesend wie sein Amtsbruder Eberhard, Bischof von Salzburg, und der Patriarch von Aquileja. Die weltliche Macht ist durch den Kärntner Herzog Heinrich, Konrad, den Bruder des Kaisers, und Dutzende Markgrafen des Reiches vertreten.
Heinrich »Jasomirgott« übergibt dem Kaiser als Lehensherrn sieben Fahnen, die die Grafschaften Bayerns symbolisieren. Dieser reicht fünf Standarten an Heinrich den Löwen weiter, zwei gibt der Kaiser dem Babenberger Heinrich »Jasomirgott« zurück. Die Sensation des Augenblicks wird von den anwesenden Fürsten mit Erstaunen registriert: Nicht nur der zum Herzog beförderte Markgraf darf die Lehensfahnen berühren, Kaiser Friedrich I. übergibt die Insignien der Macht auch an Heinrichs Gattin Theodora.
Bayern verloren, aber Österreich gewonnen: Markgraf Leopold und Herzog Heinrich »Jasomirgott« aus dem Geschlecht der Babenberger formen Grafschaften der »Ostmark« zu einem selbstständigen Herzogtum.
Die Herrschaft Österreichs wird gleichberechtigt Mann und Frau übertragen. Diese symbolische Handlung ist keine Laune des Augenblicks. Im Mittelalter haben öffentliche Gesten der Macht eine entscheidende Bedeutung. Mit der Erhebung der Grafschaften der einstigen bayerischen Ostmark zum eigenständigen Herzogtum hat sich der Babenberger Heinrich eine Reihe von Privilegien herausverhandelt. Eines davon: Seiner Familie wird die männliche und weibliche Nachfolge zugebilligt. Sollte er ohne männlichen Nachfolger sterben, fällt damit das Herzogtum nicht als Lehen an den Kaiser zurück.
Die Umwandlung der Mark in ein Herzogtum war das Ergebnis mehrjähriger schwieriger diplomatischer Verhandlungen. Friedrich I. Barbarossa war bemüht, den für ihn lästigen Konflikt seines Vaters mit dem Welfen Heinrich dem Löwen durch die Rückgabe des Herzogtums Bayern zu beenden. Das angestammte »Familiensilber« war den Welfen strafweise entzogen und Markgrafen aus dem Geschlecht der Babenberger zur Verwaltung übergeben worden. Aber weder Leopold IV. noch Heinrich II. hatten sich in Bayern und bei den bayerischen Ständen wirklich durchsetzen können. Die betrachteten es als Affront, dass Heinrich II. seine Residenz von Regensburg nach Wien, an den östlichsten Rand des Herzogtums, verlegt hatte. Aber jetzt brauchte Barbarossa dringend die Truppen des »Löwen« für seinen Italienzug. Und überdies hatten im Oktober 1155 alle bayerischen Grafen Heinrich dem Löwen die Treue geschworen. Sein Namensvetter Heinrich »Jasomirgott« hatte keine guten Karten, er weigerte sich jedoch beharrlich, das einmal übertragene Herzogtum wieder abzutreten. Bayern war eine Macht; die Gegend, die »Ostarrichi« genannt wurde, waren Grafschaften an der Grenze des Reichs: nicht besonders groß, nicht besonders reich, nicht besonders bedeutend.
Auf vier Hoftagen, zu denen der römisch-deutsche Kaiser die Fürsten zur Beratung geladen hatte, versuchten die Herrschaften eine Lösung des Problems zu finden. Vergeblich. Der Babenberger spielte auf stur, ignorierte die Einladungen des Kaisers mit erfundenen Ausreden und blockierte damit eine Entscheidung, die nicht zu seinen Gunsten ausfallen würde, wie er ahnte. Friedrich I. Barbarossa hatte in der Zwischenzeit Wichtigeres zu erledigen. Er ließ sich in Rom vom Papst zum Kaiser krönen und kehrte erst 1155 in seine deutschen Lande zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Geheimdiplomatie führte schließlich zu einem Übereinkommen mit seinem Neffen Heinrich »Jasomirgott«. Die beiden trafen einander Anfang Juni anno 1156 heimlich bei Regensburg und verhandelten den Kompromiss. Auf dem Hoftag zu Regensburg wurde dann am 8. September 1156 der feierliche Akt der Umwandlung Österreichs in ein Herzogtum möglich.
Die schriftliche Ausfertigung des Vertrages dauerte dennoch neun Tage. Erst am 17. September erhielten Heinrich und Theodora ihr Herzogtum buchstäblich mit Brief und Siegel. Der Vertragstext war von einem gewieften Notar verfasst worden, alle Rechte für die Babenberger waren darin penibel aufgezählt: Das Privilegium minus wird die amtliche Geburtsurkunde des Herzogtums Österreich. Ihr lateinischer Text beschreibt die Ausgangslage des politischen Zanks klar: »Daher möge die gegenwärtige Generation und die künftige Nachwelt aller Getreuen Christi und unseres Reiches wissen, dass wir unter Mitwirkung der Gnade dessen, von dem der Friede vom Himmel auf die Erde gesandt wurde, als wir auf dem allgemeinen Hoftag zu Regensburg das Fest der Geburt der heiligen Maria feierlich begingen, in Gegenwart vieler gottesfürchtiger und rechtgläubiger Fürsten den Rechtsstreit um das Herzogtum Bayern, der zwischen unserem liebsten Oheim, dem Herzog Heinrich von Österreich, und unserem teuersten Vetter, dem Herzog Heinrich von Sachsen, lange Zeit hindurch hin und her wogte, in der Weise beendet haben, dass der Herzog von Österreich uns das Herzogtum Bayern aufgelassen hat mit allem ihrem Recht und mit allen Lehen, die einst Markgraf Leopold vom Herzogtum Bayern innehatte. Damit aber dadurch die Ehre und der Ruhm unseres geliebtesten Oheims in keiner Weise gemindert erscheinen, haben wir nach dem Rat und dem Spruch der Fürsten, wobei der erlauchte Herzog Vladislav von Böhmen das Urteil verkündete, und mit Billigung aller Fürsten die Mark Österreich in ein Herzogtum umgewandelt und dieses Herzogtum mit allem Recht unserem genannten Oheim Heinrich und seiner allerdurchlauchtigsten Gattin Theodora zu Lehen gegeben.«
Vor den Toren der Reichsstadt Regensburg: Am 8. September 1156 schlägt die Geburtsstunde Österreichs. Heinrich »Jasomirgott« und seine Frau Theodora erhalten aus der Hand des Kaisers zwei Fahnen als Symbole des neuen Herzogtums – eine Sternstunde.
Als Preis für den Verzicht auf seine – ohnehin nur theoretisch durchzusetzenden – Ansprüche an Bayern verhandelt Heinrich sehr geschickt Sonderrechte für sein neues Herzogtum. Sollte er kinderlos sterben, darf das Land an wen immer weitergegeben werden. Dieser Passus war auf die Situation von Heinrich und Theodora maßgeschneidert. Das Paar hatte – möglicherweise aufgrund der engen Blutsverwandtschaft – keine Kinder. Heinrichs Brüder Otto von Freising und Konrad von Passau waren zwar mächtige und reiche Bischöfe, konnten aber aufgrund ihrer geistlichen Profession keine – zumindest keine legitimen – Kinder haben. Der Staufer Friedrich Barbarossa war am Überleben des Babenberger-Geschlechts höchst interessiert. Sie sollten ihm als Gegengewicht zum stets streitlustigen Welfen-Herzog in Bayern dienen. Als weiteres Privileg ließ sich der neue »Herzog von Österreich« verbriefen, Hoftage nur im nahen Bayern besuchen zu müssen. Auch für Feldzüge des Kaisers musste der Herzog keine Soldaten finanzieren. »Er soll auch keine Heeresfolge schuldig sein außer diejenige, die der Kaiser etwa gegen die Österreich benachbarten Königreiche und Länder anordnet.« Auch das war im Interesse von Friedrich und Heinrich. Der Kaiser plante ohnehin nur militärische Aktionen in Italien, und da war die Grenzmark Österreich zum Mittun verpflichtet.
Gezeichnet wird die Pergamenturkunde mit »Friedrich, des unbesiegtesten Kaisers der Römer in Christus glückbringend, Amen«.
Das alles können wir auf einem in Packpapier eingewickelten Pergament, das sich in einer schlichten Metallschublade im Haus-, Hof- und Staatsarchiv am Wiener Minoritenplatz befindet, lesen. Dieser erste »Staatsvertrag« Österreichs ist freilich nur eine Abschrift – wie auch der Staatsvertrag des Jahres 1955 nur als Kopie in Wien lagert. Die älteste Überlieferung findet sich im Codex 929 der Stiftsbibliothek Klosterneuburg und wurde wohl ein Jahrhundert nach der Ausfertigung des Originals geschrieben.
Das ursprüngliche Pergament wurde im Auftrag von Herzog Rudolf IV. irgendwann um die Jahreswende 1358/59 vernichtet – wahrscheinlich. Sicher wissen wir es nicht. Es galt, die Spuren einer frechen Fälschung zu verwischen. Die Tat ist erwiesen. Das Motiv ist bekannt. Der Anstifter bleibt straffrei. Die Vorgeschichte reicht sieben Jahrzehnte zurück: Rudolf I., der erste Habsburger auf dem Thron der römischen-deutschen Könige, hatte nach dem kinderlosen Aussterben der Babenberger ihren Besitz eingezogen und 1282 seine beiden Söhne Albrecht und Rudolf mit den österreichischen Ländern belehnt. Es war Nepotismus pur. Damit katapultierte sich das eher bescheidene Grafengeschlecht aus dem schweizerischen Aargau in die erste Liga der mittelalterlichen Aristokratie. Es ist der Beginn der Habsburger Herrschaft in Österreich, die erst nach 636 Jahren, im November 1918, enden sollte.
Die Habsburger hatten viel vor, planten zielstrebig und mit Glück den Ausbau ihrer Hausmacht. Die zum Herzogtum umgewandelte Grenzmark hatte sich unter den Babenbergern fein entwickelt. Die Steiermark und Krain waren erworben worden. Mit Österreich war schon Ende des 13. Jahrhunderts ein Staat zu machen. Herzog Rudolf IV. strebte nach mehr. Das Privilegium minus als staatsrechtliche Gründungsurkunde (der Begriff wird erst im 19. Jahrhundert von der Geschichtswissenschaft erfunden) sollte kräftig aufgebessert werden. Rudolf befiehlt eine Fälschung. In seiner Kanzlei entsteht der »große Freiheitsbrief« oder das Privilegium maius. Der Habsburger Rudolf IV. maßt sich in dieser Fälschung ähnliche Rechte an, wie sie die sieben Kurfürsten, denen in der »Goldenen Bulle« das Vorrecht der Wahl des römisch-deutschen Kaisers zugestanden wurde, innehatten. Wenn er schon kein Kurfürst ist, dann verlangt der Habsburger wenigstens Sonderrechte und lässt eine diesbezügliche Urkunde fälschen. Das Schriftbild, äußere Merkmale und weite Textpassagen des echten Privilegiums aus dem Jahr 1156 werden in das neue Dokument eingearbeitet und die originale Bulle von Kaiser Friedrich Barbarossa an das neue Pergament kunstvoll angebracht. Die Herzöge aus dem Hause Habsburg nennen sich fortan unter Berufung auf das Privilegium maius »Erzherzoge«, was ja noch besser als »Kurfürst« klingt.
Historische CSI-Ermittler haben den königlichen Kaplan Albert von Sponheim als Täter ausgeforscht. Die relativ plumpe Fälschung wird von dem italienischen Dichter und Gelehrten Francesco Petrarca entlarvt, dem zwei beigelegte Urkunden – eine vorgeblich von Caesar persönlich und die andere vom römischen Kaiser Nero – doch eher suspekt erscheinen. So dauerte es fast hundert Jahre, ehe der habsburgische Kaiser Friedrich III. die gefälschte Urkunde doch noch als echt anerkennt. Ein Habsburger kratzt dem anderen kein Auge aus, und »echt« ist eben, was machtpolitisch durchgesetzt werden kann.