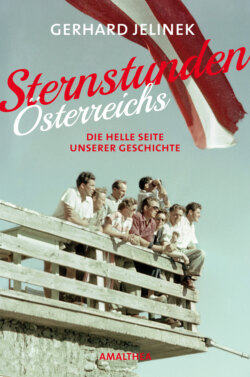Читать книгу Sternstunden Österreichs - Gerhard Jelinek - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1515
Оглавление»So erklären wir hiemit Euer Liebden eine Königin«
Die Doppelhochzeit zu Wien
Die hohen Herrschaften schwätzen und tratschen. Die Psalme und Huldigungen der höchsten Geistlichkeit sind kaum zu verstehen. Auch die so sorgsam vorbereitete lateinische Hochzeitsrede des Humanisten Riccardus Bartholinus Perusinus geht im Trubel unter. Der gelehrte Herr ist darüber sehr ungehalten. Schließlich wird er am Hofe von Kaiser Maximilian gerade wegen seiner Fähigkeit, schmeichlerische Gedichte auf den Dienstgeber anzustimmen, bezahlt und geehrt.
In der gotischen Kathedrale St. Stephan zu Wien drängten sich am St.-Magdalenen-Tag die Gesandten aller europäischen Staaten und der Hochadel des Heiligen Römischen Reichs. Die Wienerinnen und Wiener blieben ausgesperrt. Denn die festlich geschmückte Kirche war nur für die »vornehmsten Gäste zugänglich«. Rechts des Chores saßen der römisch-deutsche Kaiser, die Könige von Ungarn und von Polen sowie ein schmaler zehnjähriger Knabe, Prinz Ludwig. Nach dem Hochamt legte der Kaiser seinen prunkvollen Ornat an. Vor dem Altar des Stephansdoms, dessen Kanzel und Orgelfuß eben erst von Dombaumeister Pilgram fertiggestellt worden war, schlossen ein 56-jähriger Kaiser und ein zwölfjähriges Kind unter dem Thronhimmel den Bund der Ehe, der aber keineswegs für die Ewigkeit bestimmt war. Maximilian I. ehelichte vor Gott – so sah man das damals – Anna, die Tochter des mächtigen Jagiellonen-Königs von Ungarn, Böhmen und Kroatien, freilich in Stellvertretung für einen seiner Enkel Karl oder Ferdinand, die erst gar nicht ins ferne Wien gekommen waren. Und noch war nicht klar, welcher der beiden Enkel die junge Anna später tatsächlich ins Brautgemach führen dürfe.
Die vom Großvater eingefädelte dynastische Verbindung zweier großer europäischer Herrscherhäuser hatte natürlich kaum etwas mit der Ehe als Institution, geschweige denn mit Liebe und Zuneigung zu tun. Maximilian und die Fürsten seiner Zeit betrachteten das »heilige Sakrament« als Besiegelung machtpolitischer Pläne und Allianzen. Kaiser Maximilian, der »letzte Ritter«, setzte seine Enkelkinder Ferdinand und Maria als Figuren auf das europäische Brettspiel. Die Kinder stammten aus der Ehe seines Sohnes Philipp »des Schönen« mit der spanischen Thronfolgerin Johanna, die später von ihren Zeitgenossen den Beinamen »die Wahnsinnige« erhalten sollte: »Wiewohl wir Itzt Euer Liebden das Wort gegeben, daß Ihr Unser Gemahlin sein sollet, so ist doch solches geschehen im Namen Unserer beiden abwesenden Enkel und in der Meinung, Euer Liebden an einen von denselben zu vermählen, den wir auch hiermit Euch ehelich versprechen. Und weil mein Enkel Carl die Königreiche Castillien und Arragonien, sein Bruder Ferdinand aber das Königreich Neapel zu erben und zu erwarten hat, so erklären und nennen wir hiemit Euer Liebden eine Königin, und wollen Euch zu einer solchen gekrönet haben!«
Mit diesen überlieferten Sätzen hielt Maximilian die Stephanskrone über das kleine Haupt des Kindes und machte Anna damit zur Königin Ungarns. Ihr Vater stand ergriffen daneben. Der verwitwete Habsburger Kaiser hatte sich vor der stellvertretenden Eheschließung verpflichtet, das 44 Jahre jüngere Mädchen Anna notfalls selbst zur Frau zu nehmen, falls seine beiden Enkel ausfallen sollten. Nach der ersten Eheschließung gaben der neunjährige Ludwig, Sohn des Jagiellonen-Königs, und die zehnjährige Maria aus dem Haus Habsburg einander das Ja-Wort. Immerhin waren beide Kinder in der Kirche anwesend.
Die andächtige Teilnahme an der Stunden dauernden pompösen Doppelhochzeit lohnte sich für alle Anwesenden. Der Bischof gewährte allen Hochzeitsgästen einen Ablass aller ihrer Sünden. Und zum »Drüberstreuen« wurden mehr als zweihundert Herren zu Rittern geschlagen. Die Rückstellung des Sündenkontos auf Null sollte sich bei den anschließenden Festtafeln und einem »babylonischen Festmahl« inklusive eines Turniers auf dem Hohen Markt als günstig erweisen.
Sechs Tage lang war Wien im Ausnahmezustand. Kaiser Maximilian und seine Berater nutzten die Zeit zu weiteren Verhandlungen und zum Redigieren der Verträge, die von Schreibern in eine würdige Form gebracht werden mussten.
Die kleine Königin Anna wurde nach der pompösen Scheinhochzeit von ihrem Vater in die Obhut Maximilians übergeben, der sie gemeinsam mit Maria, der »Ehefrau« von Annas Bruder Ludwig, so lange unter seinen Fittichen halten würde, bis die beiden Ehen tatsächlich vollzogen werden konnten. Die Hochzeitsnacht zwischen Anna und Ferdinand folgte sechs Jahre später in Linz. Die beiden Ehegatten waren damals fünfzehn Jahre alt und mochten einander – keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen und diesen Kreisen. Der höchst intime Akt des ehelichen Beischlafs war eine öffentliche Staatsaffäre. Erst mit dem Vollzug der Ehe wurde diese – zumindest kirchenrechtlich – geschlossen. Anna und Ferdinand fanden Gefallen aneinander. Sie war klug, sprach vier Sprachen und galt als attraktiv. Ferdinand I. trennte sich selbst auf Reisen kaum von seiner Ehefrau. Ein durchaus unübliches Verhalten. Er »entschuldigte« sich dafür mit dem Satz, es sei besser, die Reisespesen für seine Frau zu verwenden als für eine Geliebte. Anna brachte fünfzehn Kinder zur Welt, die das Paar auch noch selbst betreute und erzog, was ein für Herrscherhäuser gänzlich ungewöhnliches Verhalten war. Die Modernität des Paares ging so weit, dass die kaiserlichen Kinder in Innsbruck eine Schule besuchten.
So wurde posthum die Übereinkunft der beiden benachbarten Herrscher Maximilian und Vladislav vollendet. Sie hatten den Ehepakt bereits im März des Jahres 1506 bei einem Gipfeltreffen in Wiener Neustadt mit Brief und Siegel vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt war Anna gerade mal drei Jahre alt und ihr Bruder Ludwig ein Säugling. Der Vertrag war ein Zeichen erfolgreicher mitteleuropäischer Nachbarschaftspolitik. Der König von Ungarn aus dem Hause der Jagiellonen durfte zu Beginn des 16. Jahrhunderts stattliche Ländereien sein Eigen nennen. Seine Dynastie beherrschte seit drei Jahrhunderten weite Teile Ostmitteleuropas. Seine Macht reichte von der Ostsee bis zur Adria. Die Jagiellonen regierten halb Europa. Im Vergleich zu diesem polnisch-litauischen Geschlecht waren die Habsburger der damaligen Zeit Armutschkerln, fast.
Ein alter Kaiser ehelicht stellvertretend für einen seiner Enkel ein Kind. Die Wiener Doppelhochzeit zu St. Stephan ordnet Europa neu und begründet einen Mythos: Tu felix Austria nube!
Maximilian hatte schon durch seine erste Eheschließung mit Maria von Burgund eine stattliche Mitgift kassiert und die Besitzungen des reichen Burgunds unter die Fittiche des habsburgischen Adlers geholt. Mit der »spanischen Doppelhochzeit« dehnte sich der Einfluss der einstigen Schweizer Grafenfamilie von der Südspitze der spanischen Halbinsel bis an die Nordsee aus. »Bella gerant alii, tu felix Austria nube – Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate. Denn was Mars den anderen gibt, schenkt dir die göttliche Venus.« Diese Abwandlung eines Satzes des Griechen Horaz passte so perfekt, dass er als Leitspruch für das »Haus Habsburg« übernommen wurde.
Den 59-jährigen König Vladislav II. plagten anno 1515 Sorgen. Seine Gesundheit war angeschlagen. Im Südosten seines Reiches rückten die Osmanen nahe an seine Grenzen heran und bedrohten Ungarn. Im Osten musste sich der Jagiellonen-König gegen Begehrlichkeiten der Moskowiter behaupten, und an der Ostseeküste hatten sich die Ritter des Deutschen Ordens festgesetzt und bedrohten die Macht seines Bruders Sigismund, der Polen regierte. Da schien es für Vladislav II. durchaus sinnvoll, mit dem Habsburger Maximilian in gutem Einvernehmen zu stehen – und mit seinen beiden Kindern Anna und Ludwig eine Verschränkung der beiden Herrscherhäuser zu besiegeln. 1515 war nicht abzusehen, wer von dem Vertrag und der Doppelhochzeit mehr profitieren würde: das Haus Habsburg oder die Jagiellonen?
Nach dem Tod des Ungarnkönigs Matthias Corvinus, der Wien und den Osten Österreichs besetzt gehalten hatte, konnte Maximilian die österreichischen Erbländer in einer Hand vereinigen und machte alte vertragliche Ansprüche auf Ungarn geltend, die er freilich nicht durchsetzen konnte. Die ungarischen Stände wollten keineswegs von einem starken Habsburger dominiert werden, noch nicht. Sie wählten den – in Prag regierenden – König Vladislav II. zum ungarischen König. Der »letzte Ritter« war nicht nachtragend, weil auch er etwas bekam. Im Frieden von Preßburg 1491 wurde Maximilian als Trostpflaster die formelle Führung des Titels eines Königs von Ungarn zugestanden sowie die Thronfolge in Ungarn, sollte Vladislav, wie zum damaligen Zeitpunkt, kinderlos bleiben.
Der Jagiellone hatte mit zwei Frauen gleichzeitig den Bund der kaiserliche Berater Bund der Ehe geschlossen, was eigentlich gar nicht ging und daher heikle Rechtsprobleme aufwarf. Der durchaus fromme Vladislav war trotz formaler Bigamie nicht untreu. Seine erste Ehefrau Barbara von Brandenburg hat er nie gesehen und seine zweite Ehe mit Beatrix von Aragón, der Witwe des Königs Matthias Corvinus, war lediglich ein formaler Bund. Da es damals zwar Ferntrauungen, aber noch keine Fernzeugungen gab, blieben beide Ehen kinderlos und konnten so – kirchenrechtlich abgesegnet – im Jahr 1500 vom Papst praktischerweise in »einem Aufwasch« am selben Tag geschieden werden. Im europaweit vernetzten Hochadel anno 1500 ließ sich rasch eine neue Gemahlin finden. Mit seiner dritten Frau Anne de Foix-Candale aus einer Nebenlinie des Hauses Navarra klappte das Kinderkriegen dann doch noch. Tochter Anna wurde 1503 in Prag geboren. Die Geburt des ersehnten Thronfolgers Ludwig überlebte die Königin Anne nur um drei Wochen. Sie starb 1506 an den Folgen der Niederkunft in der Prager Residenz. Drei Ehen waren für Vladislav genug. Er suchte keine neue Frau mehr, kümmerte sich aber um adäquate Heiratskandidaten für seine Kinder, die kaum den groben Stoffwindeln entwachsen waren. Da fügte es sich schön, dass Kaiser Maximilian nach dem frühen Tod seines Sohnes Philipp »des Schönen« Vormund seiner Enkelkinder war, die in den spanischen Niederlanden unter der Obhut seiner Tochter Margarete heranwuchsen. Die tüchtige Erzherzogin war zur Generalstatthalterin der Niederlande und Erzieherin der kaiserlichen Enkel befördert worden.
Die Doppelhochzeit wurde für Sonntag, den 22. Juli 1515 in Wien angesetzt. Eine Woche zuvor trafen einander die beteiligten Herrscher mit großem Gefolge in Sarasdorf bei Trautmannsdorf an der Leitha, angeblich unter einem Birnbaum. Die Wahl des Ortes erfolgte keineswegs, weil die Felder rund um den unbedeutenden Weiler so lieblich gewesen wären. Maximilian war Vladislav und dessen Bruder, König Sigismund I. von Polen, und den bräutlichen Kindern Anna und Ludwig auf halbem Weg nach Preßburg entgegengereist. Die Stadt an der Donau war damals ungarische Hauptstadt, da die Verwaltung des Reichs aus Angst vor den Osmanen möglichst weit in den Westen des Königreichs verlegt worden war. Die gut dreißig Kilometer von der Wiener Burg bis nach Sarasdorf entsprachen einer Tagesreise.
Für die Habsburger hatte der Wiener Stadtanwalt Johannes Cuspinian die Details des europäischen Fürstentreffens verhandelt. Beide Seiten waren peinlich darauf bedacht, den gleichwertigen königlichen Rang zu wahren. Die Herren waren – für die damaligen Verhältnisse – schon ein wenig betagt und konnten das hohe Ross nicht mehr ohne fremde Hilfe besteigen. Daher begegneten die Könige einander in prunkvollen Sänften und begrüßten sich mit lateinischen Psalmen von Fenster zu Fenster am Straßenrand. So musste keiner vom Pferd absteigen und auf den anderen zugehen. Nach der staatsförmlichen Begrüßung wird es ein wenig heiterer zugegangen sein. Für die Nachtruhe der drei Monarchen war auf freiem Feld ein Zeltlager errichtet worden. Am nächsten Morgen rumpelten der Kaiser und die zwei Könige mit ihrer Begleitung in Wagen über die matschige Straße nach Wien. Es regnete. Das tat der Hochstimmung freilich keinen Abbruch.
In seinem Tagebuch Diarium (Joannis Cuspiniani) Praefecti urbis Viennensis, de congressu Caesaris Maximiliani Augusti, et trium Regum beschreibt der kaiserliche Berater Cuspinian den »herrlichsten Einzug, den man je gesehen«. Der kaiserliche Hofarzt und Politiker hatte das Ereignis auch diplomatisch vorbereitet und eingefädelt. Cuspinian war zu jener Zeit so etwas wie der »Kabinettschef« des Kaisers, der – wie Zeitgenossen berichteten – »ihn so liebte, dass er halbe Nächte mit ihm durchsprach«. Der bekannt Eloquente war eher profan als Hans Spießheimer im bayerischen Schweinfurt auf die Welt gekommen, ehe er zum kaiserlichen Leibarzt, Rektor der Wiener Universität, Dichter, Humanisten, Politiker und Diplomaten aufstieg, sich dabei ein ansehnliches Vermögen erwarb und mit zwei Frauen acht Kinder zeugte. Dem Vertrauten des Kaisers gehörte – nebst anderem Besitz – in Wien das Haus Singerstraße Nummer 10.
Die Doppelhochzeit im Stephansdom sollte der Abschluss und Höhepunkt eines europäischen Fürstenkongresses werden, an dem dreihundert Jahre vor dem »Wiener Kongress« schon einmal die Neuordnung Europas verhandelt und beschlossen wurde. Dafür hatte Kaiser Maximilian tief in die Haushaltskasse greifen müssen. Es war eine teure Hochzeit, immerhin wurde nach der kirchlichen Zeremonie fast eine Woche lang gezecht. Wien hatte schon im Spätmittelalter den Ruf einer eher leichtlebigen und sinnenfreudigen Stadt. Enea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., beschrieb anno 1438 in einem Brief an einen Freund die Wiener Sittenlosigkeit: »Ein lockeres und schlampiges Volk, groß ist die Zahl der Dirnen, selten ist ein Weib mit seinem Mann zufrieden.« Herr Piccolomini war in Sachen Sittsamkeit ein Experte: Er wurde schließlich zum Papst gewählt. Das Leichtlebige zeigte sich nicht nur in der Völlerei. Stimmen die zeitgenössischen Berichte auch nur einigermaßen, dann war Wien ein regelrechter Sündenpfuhl. Kam hoher ausländischer Besuch in die Stadt, mussten sich die zahlreichen Prostituierten besonders herausputzen, um den Gästen die sinnliche Pracht Wiens augenfällig zu machen. Der Magistrat bezahlte gar die Ausstaffierung von Damen aus dem »Frauenhaus«. Der Aufwand brachte 1515 vielfachen Ertrag. Die Bezahlung der Festivitäten erfolgte auf Kredit. Der Kaiser hatte wieder einmal seinen Hauptfinanzier Jakob Fugger um ein Darlehen ersucht. 54 000 Gulden streckte das Augsburger Bankhaus vor. Es war kein Hochzeitsgeschenk, wohl aber ein gutes Geschäft. Die Fugger erhielten als Kreditbürgschaft für sechs Jahre die Einnahmen der Tiroler Kupferminen.
Der Augsburger Kaufmann Jakob Fugger trug seinen Beinamen »der Reiche« nicht ohne Grund. Das Familienunternehmen der Gebrüder war an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert der bedeutendste europäische Konzern. Vom ursprünglichen Baumwollhandel hatte Fugger sein Unternehmen zum größten Rohstoffhändler und Bankhaus seiner Zeit geformt. Die Fugger kontrollierten das Kupfer- und Silbergeschäft und hatten sich mit großem Risiko an Bergwerken und Minen in Tirol und der heutigen Slowakei beteiligt.
Fugger finanzierte Kaiser Maximilian und er bezahlte auch die Königswahl von dessen Sohn Karl. Die Bestechung der Kurfürsten verschlang Unsummen. Das Bankhaus Fugger finanzierte mit 545 585 Gulden zwei Drittel der rund 800 000 Gulden, die die Wahl Karls I. zum römisch-deutschen König kostete. Mit diesen Summen konnte nicht einmal der französische König mithalten. In den Geschäftsbüchern von Jakob Fugger sind die Beträge auf Gulden und Heller genau angeführt. Das Familienunternehmen hatte sich auf das Bündnis mit den Habsburgern eingelassen und musste im eigenen Interesse deren politische Macht stützen. Jakob Fugger war freilich kein Wohltäter. Er erwartete die Rückzahlung seiner Kredite und ließ sie sich durch die Übertragung von Bergbaurechten und Steuereinnahmen absichern.
Bei seinem Tod stand Maximilian I. bei Jakob Fugger so tief in der Kreide, dass dem Augsburger Bankhaus gar nichts anderes übrigblieb, als die Habsburger weiter zu finanzieren. Das »Haus Österreich« war »too big to fail« geworden. Maximilian investierte geborgtes Geld in seinen Nachruhm. Als einer der ersten Fürsten erkannte der Habsburger die Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit. So ließ er die besten Dichter, Maler und Humanisten an seinem Ruhm arbeiten und das Bild des heroischen »letzten Ritters« malen. Albrecht Dürer entwarf für Maximilian einen »Großen Triumphwagen« und eine Triumphpforte. Die Bilder Dürers fanden durch die neue Drucktechnik große Verbreitung im ganzen Reich und transportierten das erwünschte Bild eines »idealen Herrschers« im humanistischen Sinn. Peter Altendorfer ließ in seiner Werkstatt auf 109 Pergamentbögen einen mehr als hundert Meter langen Triumphzug malen, den es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hatte. Marketing ist eben fast alles.
Das Hochzeitsfest dauerte bis zum 29. Juli, am 3. August 1515 besiegelten die drei Herrscher einen offiziellen Freundschaftsvertrag. Anna wurde vor Ablauf eines Jahres die Frau von Ferdinand, der nach dem Tod seines Schwagers die Königskrone von Ungarn und Böhmen errang. Damit stieg das Haus Habsburg zu einer der führenden Mächte Europas auf.
Nach diesem ersten Wiener Kongress war freilich keineswegs fix, dass die Habsburger tatsächlich das Erbe Böhmens und Ungarns antreten würden. Das machte erst elf Jahre später ein unerwarteter Todesfall möglich: Nach dem Hinscheiden seines Vaters Vladislav II. war der zehnjährige Ludwig zum böhmischen und ungarischen König gekrönt worden. Er ertrank aber eher unrühmlich als Zwanzigjähriger nach der Schlacht bei Mohács 1526 gegen die weit überlegenen Türken auf der Flucht. Sein Leichnam wurde erst Wochen später aufgefunden. Nach dem Ende des jungen König Ludwig wären Ungarn und Böhmen – zumindest theoretisch – an die Habsburger gefallen. Aber: Die ungarischen Stände fürchteten um ihre verbrieften Rechte und wählten einen Gegenkönig: So wurden der Habsburger Ferdinand I. und der ungarische Adelige János Szapolyai beide Könige. Ferdinand musste sich in einem langen Bürgerkrieg die Herrschaft über das Land erkämpfen, nur um damit einen fast zweihundert Jahre währenden Konflikt mit dem Osmanischen Reich zu erben. Das türkische Großreich unter Sultan Süleyman dem Prächtigen entwickelte eine starke Expansionskraft. Die osmanischen Heere drangen über den Balkan und Ungarn immer weiter nach Westen vor. 1526 waren sie zu direkten Nachbarn Habsburgs geworden. Und nur drei Jahre nach der Schlacht von Mohács, bei der ein ungarisches Heer besiegt wurde, belagerte die osmanische Streitmacht das befestigte Wien. Die zahlenmäßig weit überlegenen Angreifer konnten mehrere Breschen in die längst nicht mehr zeitgemäßen Befestigungsanlagen Wiens schlagen. Die Stadtmauern stammten noch aus dem 13. Jahrhundert und waren weitgehend vernachlässigt worden. Trotzdem brachen die Osmanen ihren Feldzug ab. Sie hatten Schwierigkeiten mit dem Nachschub, weil sie die Belagerung zu spät begonnen hatten, und kapitulierten schließlich vor dem schlechten Wiener Herbstwetter – das in der »Kleinen Eiszeit« noch deutlich kühler war als heute. Mit diesem Misserfolg war die Expansion der Osmanen nach Mitteleuropa bis zum Jahr 1683 gestoppt, ehe sie wieder vor Wien auftauchten und den »goldenen Apfel« ein zweites Mal erobern wollten.
Die Wahl Ferdinands I. zum König von Böhmen und Ungarn mündet aber schließlich in der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie. Die Fundamente für die Vergrößerung der habsburgischen Hausmacht werden unter Kaiser Maximilian I. gelegt: Durch eine strategische Heiratspolitik wachsen dem Haus Habsburg Burgund mit den reichen Niederlanden sowie Spanien, Ungarn und Böhmen zu. Die Familie Habsburg steigt innerhalb weniger Jahrzehnte, und ohne blutige Feldzüge zur Eroberung von Ländern und Staaten zu führen, zur für vier Jahrhunderte bestimmenden Dynastie Europas auf. Die Habsburger begreifen sich schon damals als »Haus Österreich« und verwenden diesen Begriff synonym mit dem »Haus Habsburg«. Es geht um die Familiendynastie und ihre Stärkung durch das Knüpfen eines dichten Netzes verwandtschaftlicher Beziehungen. Da jedoch die Hausmacht des Kaisers ganz wesentlich dessen Einfluss auf die Reichspolitik bestimmt, stärken die Gebietserweiterungen, die ja vor allem auch Einnahmen bringen sollen, die Funktion des römisch-deutschen Kaisers. Dieses Netz aus verwandtschaftlichen Beziehungen legt sich über Europa und mit Karl V. auch darüber hinaus. In dessen Reich ja mit den Besitzungen in Südamerika »die Sonne nie untergeht«.
Die »Doppelhochzeit« in Wien markiert den Beginn der Weltmachtgeltung einer – wenn auch großen – Familie. Kaiser Maximilian stirbt nur vier Jahre nach seiner stellvertretenden Eheschließung mit der neunjährigen Anna im Stephansdom. Er ist gerade einmal 63 Jahre alt geworden und wird in der Georgskapelle in der Burg von Wiener Neustadt beigesetzt, wie es sein Wunsch war. Die letzten Monate seines Lebens leidet der Kaiser unter Angstvorstellungen. Auf seinen Reisen muss immer sein Sarg mitgeführt werden. Er fürchtet den göttlichen Richterspruch und hat Angst, in die Hölle verdammt zu werden. Maximilian spürt die Notwendigkeit zur Buße. Nach der Letzten Ölung verzichtet er auf alle Titel und verfügt, dass sein Haupthaar geschoren werden soll. Sein toter Leib möge gegeißelt werden, um ihn von aller Schuld zu reinigen. Nach dem Tod tut es nicht mehr weh. Offenbar haben sich in seinem Leben einige Sünden angesammelt, die noch rasch bereut werden müssen.