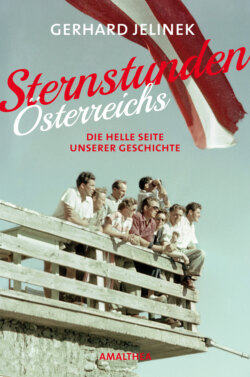Читать книгу Sternstunden Österreichs - Gerhard Jelinek - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1193
Оглавление»Wertvoller noch denn Gold und Edelgestein«
24 000 Kilo Silber für den englischen König
Der Pilger hat eine weite Reise hinter sich. Drei Tage vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1192 macht ein Engländer mit seinen Begleitern Rast im sogenannten »Jägerhaus«, einem Nebengebäude eines größeren Meierhofs vor dem mittelalterlichen Wien. Der Weiler, nahe einem Arm der Donau, die die Ebene vor Wien durchströmt, wird von der Bevölkerung hier »Erpurch« genannt. Das Gut gehört dem Babenberger Herzog Leopold V., der hier seine Jagdhunde mit eigens für sie gebackenem Brot füttern lässt. Es ist ein unfreundlicher Tag. Entlang des großen Flusses hält sich feucht-kalter Nebel. Der Reisende aus dem Heiligen Land will für sich und seine Knappen eine geheizte Stube und Labung. In seinem dicken Lederbeutel klingen Münzen. Ein Kreuzfahrer erregt Aufsehen. Der noble Pilger schickt einen Weggefährten in die nahe Stadt. Die Jäger, Bauern und Knechte haben noch nie byzantinische Goldmünzen gesehen. Sein deutsch sprechender Begleiter soll in Wien das wertvolle Goldstück in kleinere Silbermünzen wechseln und Lebensmittel einkaufen. Dieser Handel wird teure Folgen haben.
Die Ankunft eines offenbar reichen ausländischen Ritters, der aus dem Morgenland mit einem Goldschatz zurückkehrt, spricht sich herum. Auch der Herzog in seiner Burg erfährt von dem geheimnisvollen Reisenden – wenn er ihn nicht schon über Wochen bespitzeln hat lassen. Er lässt Soldaten in die Vorstadt marschieren. An einem Dienstag, den 22. Dezember 1192, wird Englands König Richard Löwenherz aus dem Geschlecht der Plantagenets gefangen genommen. Zeitgenössische Berichte über die Festnahme sind nicht überliefert. Richard wird sich den österreichischen Soldaten wohl sofort zu erkennen gegeben haben. Er wird höflich behandelt. Im Inneren eines Hausflurs in der Wiener Erdbergstraße erinnert eine Marmortafel die Hausbewohner an diese Sternstunde Österreichs. Sternstunde? Wir werden sehen!
Ein König genießt im Mittelalter fast heiligen Respekt. Der vermeintliche Pilger wird in die Stadt und direkt in die Herzogsresidenz gebracht. König Richard und Herzog Leopold sind alte Bekannte. Freunde sind sie nicht.
Die beiden Fürsten haben im dritten Kreuzzug miteinander gegen Sultan Saladin im »Heiligen Land« gekämpft und nach monatelanger Belagerung die Küstenstadt Akkon erobert. Dieser Sieg im Namen des Kreuzes ist die Wurzel des Konflikts. Nach der Erstürmung von Akkon pflanzten die Kreuzfahrer ihre Banner auf den Turm der Zitadelle. Damit markierten sie sichtbar ihren Sieg und ihren Anspruch auf die eroberte Stadt. Neben der englischen Fahne König Richards wehte das französische Banner König Philipps II. August. Herzog Leopold V., der seit dem Tod von Kaiser Friedrich I. Barbarossa und seines Nachfolgers Friedrich von Schwaben das Häuflein deutscher Ritter kommandierte, ließ sein eigenes Banner, einen schwarzen Panther auf silbernem Grund, auf einem der Mauertürme von Akkon befestigen. Damit erhob der Babenberger Anspruch auf seinen (und des Kaisers) Anteil am Sieg über die Muselmanen und die gewaltige Beute. Vor der Übergabe der Festung hatten die Belagerer für das Leben der muslimischen Bewohner ein hohes Lösegeld erpresst.
König Richard war über Leopolds Forderung »not amused«. Er ließ das Wappen des Babenbergers entfernen. Aus seiner Sicht verständlich: Die wenigen deutschen Kreuzritter, die es nach dem Tod von Kaiser Friedrich Barbarossa nach Palästina geschafft hatten, hatten nur einen bescheidenen Beitrag zur Eroberung Akkons geleistet. Außerdem empfand Englands König den Anspruch eines eher unbedeutenden Herzogs auf ein Drittel der Kriegsbeute als Anmaßung. Europäische Machtpolitik erwies sich allemal stärker als »christliche Werte«.
Dass der Engländer Österreichs Banner tatsächlich in den Burggraben werfen ließ, wie die Überlieferung besagt, ist eher unwahrscheinlich. Als Begründung für das Kidnapping des englischen Königs sollte diese Episode später eine große propagandistische Bedeutung erlangen. Leopold V. musste in Akkon zurückstecken. Er und die deutschen Ritter machten sich aus dem Staub Palästinas und kehrten nach Hause zurück.
Machtpolitische Gegensätze aus dem Abendland wurden im Morgenland nahtlos weiter ausgetragen. Auch zwischen dem König von England und seinem Waffengefährten König Philipp II. von Frankreich war die Rivalität dort wieder voll ausgebrochen. Die beiden Intimfeinde stritten mit voller Brutalität um den Titel eines »Königs von Jerusalem«, als Symbol für die Über- beziehungsweise Unterordnung des einen oder anderen. Richard und Philipp fochten in der Normandie und in Aquitanien einen blutigen Kleinkrieg um englische beziehungsweise französische Besitzungen aus. Englands König war auch Herzog der Normandie und von Aquitanien und als solcher Lehensmann des französischen Königs Philipp. Philipp hatte die durchaus lebensgefährliche Kreuzzugsfahrt in erster Linie deshalb unternommen, damit Richard Löwenherz im Morgenland nicht unbeobachtet morden und brandschatzen konnte. Und auch im Heiligen Römischen Reich war es nach dem Tod des Staufers Friedrich Barbarossa wieder zu dynastischen Rivalitäten zwischen den mächtigen Clans der Welfen und der Staufen um die Vorherrschaft gekommen. Europas politisches Kräftegleichgewicht war Ende des 12. Jahrhunderts wieder einmal in einem höchst labilen Zustand.
Richard Löwenherz und seine Truppe kämpfen auch nach der Eroberung der Küstenstadt Akkon weiter, bauen zerstörte Kreuzritterburgen auf, sichern Wege und Nachschubrouten, und sie bedrängen Saladin, der sich mit seiner noch immer intakten Armee nach Jerusalem zurückzieht. Die Kreuzritter müssen erkennen: Ihre Kräfte reichen zur Eroberung Jerusalems nicht aus.
Der englische König verhandelt mit seinem muslimischen Widerpart und schließt einen Waffenstillstand für drei Jahre. Christliche Pilger sollen ungehinderten Zugang zu den heiligen Stätten in Jerusalem haben. Mit diesem – halben – Erfolg endet der dritte Kreuzzug. Richard I. Löwenherz wird in England gebraucht. Nach Jahren der Abwesenheit muss er seine Autorität wiederherstellen.
Richard hat es eilig. Im Oktober 1192 besteigt er ein Schiff und segelt über Zypern nach Norden. Er will auf schnellstem Weg nach England. Seine Route soll ihn zunächst über die Adria zu seinen Verwandten nach Sachsen führen. Das Unheil kündigt sich an. Das Meer ist stürmisch. Knapp vor dem Ziel, an der Adriaküste vor Aquileia, geht Richards Schiff zu Bruch. Der König muss im Winter den beschwerlichen Landweg quer durch das Herrschaftsgebiet seines Rivalen Herzog Leopold V. nehmen.
Das Netz ist schon ausgelegt, als Richard von Oberitalien aus gegen Norden zieht. Er ahnt nicht, dass er Opfer einer großangelegten europäischen Erpressungsaffäre werden soll. Im Mittelalter ist man nicht sehr zimperlich.
Der englische König reist als einfacher Pilger und Kreuzritter mit kleinem Gefolge. Er weiß, dass er sich in Feindesland bewegt. So kommt er bis vor die Tore Wiens – bis nach Erdberg. Die Gefangennahme des Helden von Akkon durch den österreichischen Herzog löst ein politisches Erdbeben in der mittelalterlichen Welt aus. Von London über Paris, von der Normandie über das römisch-deutsche Reich, nach Wien, Zypern und ins Heilige Land laufen die Fäden dieser unerhörten Geiselnahme.
Herzog Leopold beginnt ein gewagtes Spiel. Die »Affäre Löwenherz« wird sich über zwei Jahre ziehen und in die romantische Sagenwelt eingehen. Legenden werden die Wahrheit verschleiern und den europäischen Konflikt überdecken.
Zunächst ist die von Leopold befohlene Gefangennahme ein eklatanter Rechtsbruch. Pilger stehen unter dem Schutz der katholischen Kirche und genießen »freies Geleit«. Ein Angriff wird mit dem Kirchenbann geahndet. König Richard ist kein gewöhnlicher Pilger, er hat im Heiligen Land für die christliche Sache (und um unermessliche Beute) gestritten.
Die Verhaftung eines Königs kann kein Alleingang eines gekränkten und vergleichsweise eher unbedeutenden Herzogs gewesen sein. Leopold V. hätte nie ohne Wissen und Auftrag seines »Chefs« und Lehensherrn, des Kaisers, handeln können. So war es auch.
Der französische König und der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs hatten schon im Herbst 1191 bei einem geheimen Gipfeltreffen in Mailand ein gemeinsames Vorgehen gegen den Engländer besprochen. Zu diesem Zeitpunkt prügelte sich Richard mit seinen englischen Rittern noch im Morgenland mit den Muslimen unter Sultan Saladin herum.
Bis Erdberg geht die beschwerliche Reise durch den Winter gut. Bei der Gefangennahme leisten der jähzornige englische Herrscher und sein Gefolge keinen Widerstand, es wäre zwecklos gewesen. Herzog Leopold V. von Österreich hat den Fang seines Lebens gemacht und beginnt sein Spiel. Mit reitenden Boten wird Kaiser Heinrich VI. auf dem Weg von Eger in Nordböhmen nach Regensburg informiert. Er zeigt sich vom eklatanten Rechtsbruch seines Herzogs weder überrascht noch empört. Kaiser Heinrich taxiert die Beute und befindet: »Wertvoller noch denn Gold und Edelgestein.« Das europäische Informationsnetzwerk funktioniert auch im Mittelalter. Der deutsche Kaiser schreibt nur sechs Tage nach der Gefangennahme dem französischen König, schildert die Tat und kriminalisiert den englischen König als »Feind des Reichs und Störer deines Königreichs«. Deutschland und Frankreich verbünden sich gegen England.
Am gleichen Tag geht auch Post nach Wien ab. Der Kaiser befiehlt seinem Lehensmann, die königliche Geisel zum Hoftag nach Regensburg mitzunehmen und den englischen König dem deutschen Kaiser in Gewahrsam zu geben. Aus Gründen der Ehre, natürlich: »Weil es sich nicht gezieme, dass ein Herzog einen König gefangenhalte, es wäre im Gegenteil nicht ungebührlich, wenn die königliche Würde von der kaiserlichen Erhabenheit bewahrend erhalten werde.«
Jetzt wird die Sache ernst. Österreichs Herzog kann es machtpolitisch kaum wagen, der »Bitte« des Kaisers nicht zu entsprechen und seine immens wertvolle Geisel auf der Burg Dürnstein in der Wachau zu belassen. Das wäre ein eklatanter Treuebruch und würde zu einem Konflikt mit dem Staufen führen. Der Babenberger Leopold ist zwar mittlerweile ein wichtiger Herzog des Reichs, steht aber machtpolitisch doch noch in der zweiten Reihe der strengen ritterlich-feudalen Ordnung des Mittelalters. Auf eigene Faust und eigene Rechnung kann Leopold die Geiselnahme nicht beenden. König Richard gehört zur »ersten Garnitur« europäischer Macht. Im Vergleich zu Richard ist der Babenberger ein kleines Licht. Ohne Gegenleistung für seine schlaue Aktion will Leopold den englischen König Richard Löwenherz aber auch nicht an den Kaiser ausliefern. Der Herzog lässt die Pferde satteln und beeilt sich mit seiner Geisel von Dürnstein die Donau aufwärts zum Hoftag nach Regensburg. Schon am Dreikönigstag des Jahres 1193 trifft Herzog Leopold mit dem Gefangenen in der Pfalz Regensburg ein. Auf dem Hoftag führt er seinem Kaiser den englischen König Richard als Gefangenen vor. Er weigert sich jedoch, seine Geisel zu übergeben. Der Kaiser und sein Herzog beginnen intensive Verhandlungen über die Modalitäten der Übergabe. Es kommt zu keiner Einigung. Der Babenberger lässt seinen Gefangenen heimlich wieder nach Dürnstein bringen. Leopold fürchtet einen Handstreich des Kaisers. Richard Löwenherz muss wieder nach Dürnstein, in die stattliche Burg Hademars II. von Kuenring, mit ihrem prachtvollen Blick über das Donautal. Hademar ist ein enger Vertrauter von Leopold und sorgt sich um das Wohlergehen seines prominenten »Gastes«. Entgegen den Darstellungen der zeitgenössischen englischen Propaganda muss der mächtige König keineswegs in einem Verlies schmachten. Er darf sich in der Burg und der Umgebung frei bewegen, hält Kontakt zu englischen Emissären und vertreibt sich die Zeit mit Rauf- und Sauf-Wettbewerben. Sein unfreiwilliger Aufenthaltsort ist kein Geheimnis. Im 19. Jahrhundert werden die Haftbedingungen von »Lionheart« als eher kommod beschrieben: »Er durfte sich, von deutschen Rittern gefolgt, frei bewegen. Der Verkehr mit seinen Freunden und Landsleuten, die von England herüberkamen, ihm zu huldigen oder zu raten, wurde nicht gehindert. Nur des Nachts musste er allein sein. Der Frohsinn verließ den König auch hier nicht; wer ihn sah, fand ihn launig und heiter. Die größte Belustigung gewährte ihm, mit den Wächtern sein Spiel zu treiben, sie im Ringkampf mit meisterlicher Gewandtheit zu bewältigen oder im Zechgelage sie sämtlich trunken zu machen und allein obenauf zu bleiben.« Die schöne Sage vom treuen Sänger Blondel, der deutsche Burgen abklappert, vor jeder sein Ständchen singt und endlich aus dem Dürnsteiner Verlies die Stimme seines geliebten Königs vernimmt, ist eben eine Sage: Kein Wort wahr. Der nordfranzösische Troubadour Blondel de Nesle schreibt zwar zwei Dutzend Liebeslieder in picardischer Mundart. Löwenherz begegnet er nie. Vor der Burg Dürnstein singt er nicht.
Keine Spur von Bänkelsänger Blondel: Die Burg Dürnstein in der Wachau beherbergt anno 1193 König Richard Löwenherz. Für den Engländer ist dies ein eher längerer und sehr teurer Aufenthalt.
Vier Wochen verhandeln Kaiser Heinrich VI. und Herzog Leopold V. Mitte Februar wird in Würzburg ein Vertrag geschlossen. Darin einigen sich Lehnsherr und Lehnsmann über die Modalitäten einer europäischen Erpressung. »Ich, Leopold, Herzog von Österreich, werde meinem Herrn, Heinrich, dem Kaiser der Römer, den König von England folgendermaßen und unter der Bedingung übergeben und ausliefern, dass eben dieser König dem Herrn Kaiser 100 000 »Kölner Mark Silber« vergönnen werde. Von welchen ich die Hälfte für die auszustattende Tochter des Bruders des Königs der Engländer halten werde, die einer meiner Söhne in die Ehe führen wird. Diese Tochter des Bruders des Königs der Engländer wird darum zum Fest des Heiligen Michael einem meiner Söhne, den ich hierzu auswählen werde, darzureichen sein.« Neben der ungeheuer hohen Lösegeldsumme von 100 000 »Kölner Mark Silber«, zu bezahlen in zwei Tranchen, will der Babenberger sein Haus mit den englischen Plantagenets durch eine Eheschließung verbinden. Das erpresste Lösegeld würde so offiziell als Mitgift »reingewaschen«. Die 100 000 »Kölner Mark Silber« entsprechen etwa dem Gegenwert von 24 Tonnen Silber. So viel hat Richard I. dem Malteser Ritterorden für den Kauf ganz Zyperns gezahlt.
Nach heutigem Geldwert, der nicht der Umrechnung des Silberpreises entspricht, erhält der österreichische Herzog etwa drei Milliarden Euro für seinen Gefangenen. In der Summe aller Vertragspunkte ist die Conventio von Würzburg ein schonungsloses Dokument über Politik durch Erpressung. Der Vertrag skizziert auch ein machtpolitisches Konzept, mit dem die Neuordnung zahlreicher europäischer Konflikte versucht wird. Mehr noch als die eher kommode Haft auf der Burg Dürnstein fürchtet Richard Löwenherz die Auslieferung an den französischen König. Während der Verhandlungen wird der König in der Wachau festgehalten. Ob er in der Haft über die Gespräche informiert wird, wissen wir heute nicht. Wahrscheinlich ist es schon. Schließlich bemüht sich der englische Bischof Savary von Bath in die winterlichen deutschen Lande und vertritt als Anwalt die Interessen des englischen Königs beim Kaiser.
Die Würzburger Conventio dürfte vom engen Vertrauten des österreichischen Herzogs, Ritter Hademar II. von Kuenring, formuliert worden sein, viele Textpassagen sind nur im Interesse des österreichischen Herzogs. Neben einigen kleineren Forderungen, wie etwa der Freilassung weitschichtiger Verwandter seiner byzantinischen Mutter aus dem Gewahrsam der Engländer auf Zypern, erbittet Leopold die Lösung vom Kirchenbann. Der Babenberger versucht sich selbst für das »Jüngste Gericht« entsprechend abzusichern. König Richard hat die zugesagte Fürsprache beim Papst für seinen Geiselnehmer allerdings nicht eingehalten.
Nach der Unterzeichnung des Vertrages von Würzburg, der die Aufteilung des erpressten Lösegelds regelt, wird Richard Löwenherz jedenfalls im März 1193 von Dürnstein in die kaiserliche Pfalz nach Speyer gebracht und dort dem deutschen Kaiser übergeben. Nun ist König Richard Gefangener auf standesgemäßem Niveau, gefangen bleibt er. Es dauert fast elf Monate, ehe die Zahlung der für damalige Verhältnisse ungeheuer hohen Summe Lösegeld abgewickelt werden kann. Wie die Welt aus der Sage von Robin Hood erfahren hat, quetschen die Steuereintreiber und Sheriffs jeden Silberling aus der Bevölkerung. In England müssen die Klöster alle Erträgnisse aus der Schafschur eines Jahres abliefern. Kaiser und Herzog teilen halbe-halbe. Leopold V. verwendet »seine« 50 000 Mark Silber für die Erweiterung Wiens und den Bau der Wiener Münzstätte, außerdem investiert Österreichs Herrscher das englische Silber in die Gründung Wiener Neustadts und zur Befestigung der Städte Enns und Hainburg. Die Geiselnahme von Richard Löwenherz in Erdberg bei Wien wird so tatsächlich eine Sternstunde für Österreich, auch wenn sie moralisch im Zwielicht dämmert.
Englands König Richard konnte erst nach seiner Freilassung am 4. Februar 1194 auf die Insel zurückkehren und sein Reich wieder in Besitz nehmen. Er war fast zwei Jahre lang gefangen.