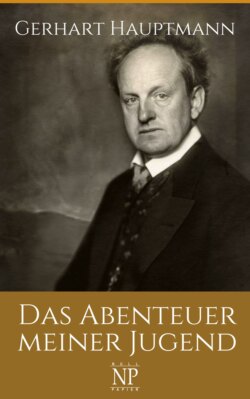Читать книгу Das Abenteuer meiner Jugend - Gerhart Hauptmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel
ОглавлениеAnfang und Ende des Lebens, heißt es, sind dem Lebenden selbst in Dunkel gehüllt. Niemand kann sein geistiges Dasein vom Tage seiner Geburt datieren. So bin ich erst am Beginn meines zweiten Lebensjahres zum Bewusstsein erweckt worden und bewahre davon bis heute die Erinnerung.
Ich konnte weder sitzen noch liegen, weil mein Rücken und mein Gesäß, wie man mir später erklärt hat, zerprügelt und zerschunden war. Mein eigener Gedanke und deutlicher Lichtblitz aber war: Was soll aus mir werden, wenn ich beim Sitzen und Liegen maßlose Schmerzen habe?
Es ist meine Amme gewesen, die mich so misshandelt hat. An die Prügelprozedur selbst habe ich jedoch keine Erinnerung.
Schmerz also hat meinen Geist erweckt, Leiden mich zum Bewusstsein gebracht.
*
Ich saß auf dem Arm der Kinderfrau und schrie, durch irgendetwas aufs schwerste beleidigt. Die Brave trug mich durch einen dunklen Korridor, der auf den Hof unsres Anwesens führte. Dort brüllte mich eine Stimme an, die mich stumm machte. Das war meine erste Begegnung mit dem preußischen Unteroffizier und die zweite Phase meines Bewusstwerdens.
Der ganze Hof lag voll Militär.
Eines Tages saß ich, von meinem Kindermädchen gehalten, auf dem Fensterbrett eines offenen Fensters und guckte auf den Vorplatz hinab. Dort wurden beim Toben der Regimentsmusik Remontepferde zugeritten. Sie stiegen kerzengrade in die Luft, sie bockten und keilten hinten aus, besonders die wütend geführten Schläge der Pauker machten sie unsinnig.
Es war, wie ich später erfahren habe, kurz vor der Schlacht bei Königgrätz.
*
Berührungen zwischen den Sinnen und Objekten, heißt es, veranlassen die Bewegung im Geiste des Neugeborenen, die ihn nach allen Dingen greifen lässt. Dies geschieht etwa bis zum dritten Lebensjahr.
Mit dem vierten Jahr ist es in mir bereits überraschend hell geworden.
Eines Tages erschienen fremde Soldaten, Österreicher, auf der Dorfstraße. Es waren Gefangene und Verwundete, hatte ich aufgefasst. Der eine trug ein weißes, blutiges Tuch um den Hals. Ich nahm an, ihm sei der Kopf vom Rumpfe geschnitten und werde daran durch das Tuch festgehalten. Ein Gefangener hieß Boaba. Er war Tscheche und sprach nicht Deutsch.
Um jene Zeit hatten sich bereits die Gestalten zweier Knaben, meiner Brüder, in meine Seele eingeprägt. Die verwundeten Feinde in den Lazaretten empfingen von ihnen alle möglichen Wohltaten. Georg, der ältere, schrieb von früh bis abends Briefe für sie. Von ihm und dem jüngeren Bruder Carl wurde täglich die Speisekammer der Mutter ausgeplündert und der Raub den kranken Soldaten zugesteckt.
Ich teilte mit Bruder Carl ein Schlafzimmer. Er war, was in diesem Alter viel bedeutet, vier und ein halbes Jahr älter als ich. Er hatte damals schon, ohne es zu ahnen, in mir seinen stillen Beobachter. Ich wunderte mich, ich freute mich, ich machte mich lustig über ihn. Heute ein seltsamer Umstand für mich, ein solches Verhalten in frühester Jugend.
Carl war ein großer Enthusiast. Ich war geneigt, das für Schwäche zu halten. Von Zeit zu Zeit wurde, ebenfalls im Jahre 66, der Durchmarsch der Truppen für eine gewisse Nachtstunde angesagt. In solchen Fällen stellte sich Carl einen großen Korb, gefüllt mit Blumen, unter das Bett, um sie aus dem Fenster über die Marschkolonne auszuschütten. Ich erinnere mich, wie er einmal völlig traumbefangen nach dem Korbe griff, als von der Straße der dumpfe Marschtritt zu uns heraufschallte, wie er schlafend, geschlossenen Auges, damit zum Fenster lief, den Korb entleerte und, ohne ganz erwacht zu sein, ins Bett zurück taumelte. Ich nahm dies nicht erschreckt, sondern kichernd als etwas überaus Komisches auf.
*
Natürlicherweise waren mir um diese Zeit bereits Vater und Mutter und mein Verhältnis zu ihnen bewusst geworden, ebenso mein Elternhaus, dessen Namen ich kannte wie den des Ortes, in dem es stand. Wie war die Kenntnis unzähliger kleiner Beziehungen, in denen ich zu alledem stand, in mich gekommen? Ich hätte es damals nicht sagen können und kann es auch heute nicht. Diese Mutter, dieser Vater, dieses Haus, seine Räume und seine Umgebung, dieser ganze kleine Ort, Ober-Salzbrunn genannt, waren da wie von Ewigkeit. Und eben der Vater, die Mutter, das Haus, der Ort waren alles in allem für mich: es gab nur das, es gab nichts anderes.
Waisenkinder leben ohne Mütter, sie leben und entwickeln sich. Die Seeleneinheit, die mich mit meiner Mutter verband, machte mir das unbegreiflich. Durch das Herz meiner Mutter, durch ihre Liebe bin ich im Verlaufe des ersten Dezenniums erst sozusagen ausgetragen worden. Mein Vater war der mächtige Gott, in dessen Schutz wir beide standen. Nichts in der Welt konnte wider ihn etwas ausrichten. Wie stolz, wie dankbar machte mich das, wie genoss ich das Glück eines solchen Schutzes im Gefühl glückseliger Sicherheit. Aber eine innige, eine trennungslose Beziehung und Verbindung bestand zu meinem Vater nicht.
Wie kann man in die so überaus komplizierten Verhältnisse einer Familie, eines weitläufigen Anwesens, einer Ortschaft mit dreieinhalb Jahren, kommend aus dem Nichts, wissend hineingewachsen sein? Entweder auf Grund einer geistigen Leistung ohnegleichen oder einer Erbschaftssumme, die mitgeboren ist.
*
Salzbrunn, wusste ich, ist ein Badeort. Hier quillt ein Brunnen, der Kranke gesund machen kann. Deshalb kommen im Sommer so viele hierher. Sie werden in den Häusern der Ortsangesessenen untergebracht. Auch in unserm Haus, das der Gasthof zur Preußischen Krone ist.
Aber was ist ein Gesunder, was ist ein Kranker? Wieso und woher wusste ich das? Wieso wusste ich tausende, abertausende Dinge, nach denen ich kaum irgendjemanden gefragt hatte? Die unendliche Vielfalt der Erscheinungen schenkte sich mir mit Leichtigkeit, es war allenthalben ein heiteres Aufnehmen.
Ich hatte am Dasein ununterbrochen leidenschaftliche Freude wie an einer über alle Begriffe herrlichen Festlichkeit. Ich sträubte mich, wenn ich sie abends durch den Schlaf unterbrechen sollte. Im Einschlafen packte mich Freude und Ungeduld in Gedanken an den kommenden Morgen.
Freilich, das Haus war traulich und nestartig wohltuend. Aber das Schönste daran waren die Fluglöcher. Ich genoss sie vollauf, als ich einer schnellen und selbstständig freien Bewegung fähig geworden war. Ich stürzte des Morgens mit einem Sprung und Freudenschrei ins Freie; manchmal wurde der Schrei nicht laut, sondern lag nur im überschäumenden Gefühl meines ganzen Wesens. Alles in der Natur schenkte sich mir: der Grashalm, die Blume, der Baum, der Strauch, die Berberitze, die rote Mehlbeere, der Holzapfel, alles und alles wurde mir damals zur Kostbarkeit. Dabei hatten sich bereits Höhepunkte des Erlebens meinem Geiste unverlierbar eingeprägt. Das Herumkrabbeln auf einem sonnenbeschienenen Abhang mit gelbem Laub und Leberblümchen unter kahlen Bäumen war ein solcher Höhepunkt. Ich hätte ihn gern zur Ewigkeit ausgedehnt, so wunschlos, so paradiesisch fühlte ich mich. Aber er blieb eine Einmaligkeit, ich suchte vergebens, ihn zu erneuern.
Einmal, ich kann nicht über zwei Jahre alt gewesen sein, überkam mich eine an Verzweiflung grenzende Traurigkeit, die sich in unaufhaltsamem Weinen äußerte und die meine Umgebung sich nicht zu erklären vermochte. Die Erinnerung auch daran befestigte sich in mir. Durch eine mit milchigem Wiesenschaumkraut durchsetzte Wiese angelockt, begab ich mich an das Blumenpflücken. Immer tiefer und tiefer, mich ganz vergessend, geriet ich in die Wiese hinein. Ich weiß nicht, wieso man mich ohne Aufsicht gelassen hatte, sodass ich wohl eine Stunde und länger meiner verträumten Beschäftigung nachgehen konnte. Ein Berg von Cardamine pratensis1 häufte sich. Ich hatte ihn unermüdlich fleißig am Rande der Wiese zusammengetragen.
Und nun auf einmal überkam mich diese allgemeine, ich möchte fast sagen kosmische Traurigkeit. Ich hatte alle diese Blüten, die da tot und welk übereinander lagen, tot gemacht. Wieso aber konnte ich das getan haben? War ich mir doch bewusst, dass ich aus Liebe zu ihnen gehandelt hatte und nicht in der Absicht, ihr Leben zu zerstören oder auch nur ihnen wehe zu tun. Ich wollte mir eben doch nur ihre Schönheit aneignen.
*
Der Befehl eines menschlichen Gottes war meines Vaters Gebot.
Eine Mutter wird ihre Kleinen täglich viele Male vergeblich mit den Worten ermahnen: »Bettle nicht!« Die ersten Worte der Kleinsten sind: »Haben, haben!« Mein Vater aber wollte unbedingt vermieden sehen, dass unsere Begehrlichkeit etwa gar den Kurgästen zur Last fiele. Ich, ein besserer kleiner Adam, hielt mich mit bebendem Gehorsam an sein Bettelverbot. Eines Tages kam jedoch einem alten Kurgast, Ökonomierat Huhn, der Gedanke, mich mit einem Spielzeug zu beschenken, das ich mir selber beim Händler aussuchen sollte. Ich wählte einen herrlichen blauen Rollwagen mit Fässern darauf und vier Pferden davor, drückte das Riesengeschenk mit ausgebreiteten Armen an meine Brust und vermochte es kaum fortzuschleppen. Unterwegs nach Hause fiel mir des Vaters Verbot aufs Herz. Zwar gebettelt hatte ich nicht, aber man konnte es leicht voraussetzen, und schließlich sollten wir überhaupt von Fremden nichts annehmen. Bei dieser Erinnerung schrie ich sofort aus Leibeskräften, als ob mich das größte Unglück betroffen hätte. Eine solche tragikomische Mischung des Gefühls in der Brust eines Kindes ist vielleicht eine Seltenheit. Ungeheure Freude über den völlig märchenhaften Neubesitz ward von Entsetzen über den Bruch des Gehorsams überwogen. Ununterbrochen schreiend trat ich mit meinem Schatz ins Haus und vor meine verblüfften Eltern hin, die den scheinbaren Widersinn meines Betragens nicht durchschauen konnten.
*
Den gartenmäßigen Ausbau der Kurpromenade nannte man Anlage. In diese Anlagen führte mich täglich meine Kinderfrau, wobei uns ein kleines Hündchen begleitete. Ich liebte es, wie natürlich, sehr. Noch eben hatte ich mit ihm schöngetan, als es in ein Boskett schlüpfte. Völlig verändert kam es heraus. Mit heller Kehle und langer Zunge Laut gebend, umkreiste es rasend in weitem Bogen mich und die Kinderfrau, die mich auf die Arme nahm und das Haus zu erreichen suchte. Das Hündchen aber in seiner kreisenden Raserei behielt uns als Mittelpunkt. Alles wurde auf den gefährlichen Vorgang aufmerksam, wer konnte, floh, auch mein Vater wurde benachrichtigt und zog uns schließlich durch eine Glastür ins innere Haus, wo wir vor dem wahrscheinlich von Tollwut befallenen Tier sicher waren.
Es war uns bis auf den Hausflur nachgefolgt, wo man es glücklicherweise abschließen und also unschädlich machen konnte. Ich sah durch die Scheiben seinen fortgesetzten, wütenden Todeslauf, immer im Kreis, über Stühle, Tische und Fensterbretter hinweg, ich weiß nicht wie lange, eh man es durch den Tod erlöste.
Ich bin diesen tiefen und grausigen Eindruck bis heut nicht losgeworden. Und immer, wenn später einer meiner Hunde in einem Boskett verschwunden ist, wurde ich unruhig und habe die Zwangsvorstellung zu bekämpfen gehabt, er werde schäumend und rasend herausstürzen.
*
Ich weiß nicht, wann mir der immerwährende Wechsel von Tag und Nacht, ihre Gegensätzlichkeit im Bereich der Sinne, des Empfindens und der Vorstellung deutlich ins Bewusstsein gedrungen ist und wann sie mir zu bewusster Gewohnheit wurde. Nicht der Tag, aber der Abend und die Nacht sowie alles Dunkel waren mit Furcht verknüpft. Ein solcher Ausdruck der Furcht war schon das Abendgebet, das meine Mutter mich täglich im Bett sprechen ließ:
Müde bin ich, geh’ zur Ruh’,
schließe beide Äuglein zu.
Vater, lass die Augen dein
über meinem Bette sein!
Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruhn in deiner Hand …
und so fort.
*
Die Furcht des Kindes ist Gespensterfurcht. Sein Tag kennt sie nicht, aber nachts, wenn es wach oder halbwach ist, umgeben es überall Dämonen. Da sie, woran das Kind nicht zweifelt, bösartig sind, gibt man dem geängstigten Knaben, dem furchtsamen Mädchen die Vorstellung eines Schutzengels. Man sprach auch mir von meinem Schutzengel, aber er wurde mir nie überzeugend gegenwärtig. Er gab mir nie ein Gefühl der Geborgenheit etwa in dem Grade, wie mir die Geister der Finsternis Furcht machten.
Eine Zeit lang teilte ich mit den Eltern das Schlafzimmer. Wenn ich, was vorkam, schlaflos lag und beim Scheine des Nachtlichtchens Vater und Mutter bewusstlos schnarchend in ihren Betten sah, waren sie mir wie atmende Leichname. Dass sie vom Tode wieder erwachen würden, ja dass ich sie wecken konnte, wusste ich. Aber ebenso war mir bekannt, dass man dies nicht darf, weil jemand, der weiterleben will, allnächtlich diesen Tod erleiden muss. Und so musste ich denn das Gefühl einer grenzenlosen Verlassenheit auskosten.
Wenn das Um und An der Nacht mir peinlich war, so sah ich den Schlaf an sich als eine störende Unterbrechung des Tages an und schüttelte ihn des Morgens mit dem Glücksgefühl des Befreiten wie eine gesprengte Fessel ab. Nun konnte ich wieder in himmlischer Betäubung rastlos in der Sonne umherflattern und mich dem überall Selig-Neuen, den Genüssen des Gesichts, des Gehörs, des Geruchs, des Getasts und des Geschmacks hingeben. Ich konnte überall umherfahren, suchend und findend, alles um und um wendend, von der frohen Bezauberung meines Staunens erfüllt.
Vom Morgen gelangte ich so im Rausch des Spiels bis zum Abend hinauf, von dem man mich, und das war die gute Seite der Nacht, bewusstlos wie in einem lautlosen Lift zum Morgen herunterließ, wo das Spiel von Neuem beginnen konnte.
*
An meinem Geburtstage brannten vier Lichter um den Kuchen, in der Mitte das längere Lebenslicht. Die Feier wurde alljährlich mit Geschenken, Kuchen, Lichtern und Blumen gewissenhaft eingehalten. Der Geburtstag fiel glücklicherweise in den Monat November, in die stille, dem Familienleben gehörende Winterzeit. Im turbulenten Gästebetrieb des Sommers würde man seiner kaum oder nur nebenher gedacht haben. So war es ein Tag der Freude, aber auch der Einkehr für mich, da die Mutter mit ernsten Reden des menschlichen Wachsens und Werdens und des menschlichen Schicksals im ganzen gedachte.
Über Spiel und Spielzeug ist viel gesagt und geschrieben worden. Wer den Spieltrieb kennt, weiß, welcher Zauber ihm innewohnt. Echtes Spielzeug kann sogar im Erwachsenen, besonders in Gegenwart von Kindern, das Kind erwecken. Aus dem Spieltrieb erwächst die Kunst. Der Knabe vom vierten, wenn er das Schaukelpferd hinter sich gelassen hat, bis zum achten, neunten Jahr ist ein Universalkünstler. Er hat mit Bauklötzen Dome aufgeführt, er hat sich geübt mit seinem Tuschkasten, er hat allerlei Tiergebilde aus Wachs modelliert, er hat sich zeichnerisch an den Menschen gewagt. Vor allem aber ist er ein Schauspieler ohne Eitelkeit, einer, der keinen Zuschauer braucht, wenn er sich als kommandierender General, als mutiges Pferd oder gar als Lokomotive gebärdet.
Es ist Neigung, niemals Gebot, niemals Pflicht, was zum Spiele treibt. Das Kind ist sein eigener Lehrer und Schüler. Ein Verhältnis von solcher Harmonie und Fruchtbarkeit wird ihm später schwerlich wieder zuteil werden. Es fühlt kein Ziel, es fühlt keinen Zweck. Alles ist, sei es versonnen oder wild, immerwährende Heiterkeit.
Wohl scheint die Natur dabei einen Zweck zu verfolgen: aber selbst die Erwachsenen sehen ihr Walten im Kinde meistens nicht. Deshalb halten sie sich für verpflichtet, schon früh und bei gegebener Gelegenheit, wie meine Mutter an meinen Geburtstagen tat, auf den kommenden Ernst des Lebens in Gestalt des Schulbesuchs hinzuweisen. Ich wollte lange nichts wissen davon, endlich aber wurde ich nachdenklich und sah die Unschuld meines Dahinlebens durch den Gedanken der Mutter gestört, dass dieses so glückliche Leben ein nutzloses wäre und abgelöst werden müsse von einem nützlichen. Seine Berechtigung habe es gleichsam nur als Gnadenfrist. Überschreite es diese Frist, so sei der Mensch, der es weiterführe, ein Taugenichts.
Nun, ein Fohlen, das einen Wasserguss erhält, schüttelt sich und galoppiert dann doppelt schnell und vergnügt in die Koppel.
*
Wenn ich, etwa als Vierjähriger, mit aufgestützten Ellbogen in einem der Frontfenster meines Elternhauses lag, wurde mein Blick bei klarem Wetter durch einen schöngeformten Berg, den Hochwald, angezogen. Er war dann nicht nur die Grenze meiner Welt, sondern der ganzen Welt. Und ich setzte mit stiller, zweifelsfreier Gewissheit voraus, man könne, auf seine Spitze gelangt, in den Himmel steigen. Oft und oft, wenn wieder und wieder die träumerische Stimmung im Angesicht des heiligen Berges über mich kam, habe ich diesen Fall erwogen und alle möglichen Arten, in denen der Plan auszuführen sei. Den Herrgott selber hatte ich auf einem dunklen Treppenabsatz unseres Hauses inzwischen kennengelernt, wo ein Ehrfurcht gebietendes goldgerahmtes Bild des weißgelockten, bärtigen Greises die Wand zierte. Ich hatte ihn zum Erstaunen der Meinen sogleich erkannt.
*
Waren die Lichter meines Geburtstages erloschen, so tauchte gleich eine andere Ballung von Licht, eine zunächst nur innerliche Sonne auf. Diese Sonne war Weihnachten. Unter der Lichtflut dieses Festes hat sich wohl der Familienkreis mir am frühesten und deutlichsten eingeprägt: mein Vater, der einen martialischen Schnurrbart und Brillen trug, meine Mutter mit ihrem Wellenscheitel, mein Bruder Carl, Johanna, die Schwester. An meinen ältesten Bruder Georg habe ich aus dieser Frühzeit keine Erinnerung.
Uns Deutschen kann der volle Begriff eines Festes nur noch an diesem Feste klarwerden. Es erhebt sich aus unabsehbaren Tiefen der Vergangenheit, und seine lebendige, oberirdische Tradition wird von Generation auf Generation in der gleichen Empfängnis entgegengenommen.
Die Freude dieses Festes war nicht die unmittelbare gesunde, irdische, sondern sie war eine mystische. Sie erhob sich in überirdischer Steigerung. Über ihr stand eine immergrüne Tanne, ein Nadelbaum, aus dessen Zweigen Kerzen emporwuchsen und ihn zu einer Pyramide von Flämmchen machten. Der Baum war gesunde Waldnatur, die Kerzen auf ihm und er als ihr Träger Mysterium.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Welche widersinnige Einfalt beseelt dieses kleine Lied, und welche Tiefen des Entzückens werden durch es im Gemüt des Kindes ausgelöst.
Geschenke, Gaben brachte wohl das ganze Jahr hie und da, aber sie waren nicht von dem Zauber berührt und erfüllt wie die Bescherung unterm Weihnachtsbaum. »Vom Himmel hoch, da komm’ ich her.« Nicht die Eltern hatten uns mit Geschenken beglückt, sondern sie waren diesmal wirklich vom Himmel gekommen. Der Vater, die Mutter waren Treuhänder, die sie uns übermittelt hatten.
Darum war die Freude, die Spannung zu Weihnachten übergroß, mitunter so groß, dass mein Organismus sich in der Folge durch eine kurze Krankheit wiederherstellen musste.
Trotzdem stellte man sogleich Berechnungen über das kommende Weihnachten an, über die Monate, Wochen, Tage, die man bis dahin noch zu bestehen hatte.
1 Wiesenschaumkraut <<<