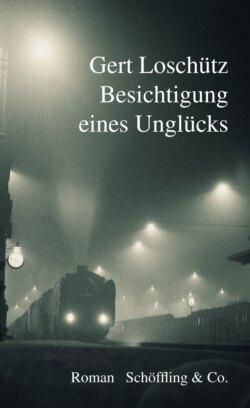Читать книгу Besichtigung eines Unglücks - Gert Loschütz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Es gibt drei Orte, die man sich merken muss.
Die Blockstelle Belicke, rund sechs Kilometer östlich von Genthin, ein zweistöckiges Haus mit drei großen Fenstern, von denen man den herannahenden Zug ebenso wie die beiden Signale im Blick hat, das Vor- und das Hauptsignal.
Den Streckenposten 89, eine Schrankenwärterbude zwischen Belicke und Genthin.
Und schließlich das Stellwerk Genthin Ost, eingangs des Bahnhofs, gelegen am Übergang nach Mützel, einem kleinen Dorf, zu dem eine mit groben Feldsteinen gepflasterte Straße hinausführt, daneben ein schmaler, im Sommer von Gras überwachsener Sandweg.
Diese drei Orte tauchen in allen Berichten über das Unglück auf. Jeder von ihnen spielt in der Geschichte eine Rolle. Das ist sicher. Während sonst fast nichts sicher ist.
In der Blockstelle Belicke hat an diesem Abend der Weichenwärter Friedrich Ackermann Dienst, ein sechzigjähriger Mann, der die anderthalb Kilometer von seinem Wohnort Kaderschleuse mit dem Rad zurücklegt.
Er nimmt nicht den Weg über die Chaussee, den ich als Kind öfter gefahren bin, sondern einen Schleichweg, der das letzte Stück an den Schienen entlangführt und im Herbst von Holz- und Pilzsammlern benutzt wird. Der Weg ist so schmal, dass er absteigen muss, wenn ihm jemand entgegenkommt. Oder der andere müsste einen Schritt in den Wald hineintun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihm jemand begegnet, ist gering. Es ist schon dunkel, als er losfährt, es ist kalt, die Erde gefroren, und es fällt, wie ich jetzt weiß, ein wenig Schnee.
Links die Schienen, rechts der Wald.
Er wird kurz vor sechs bei der Blockstelle angekommen sein, noch ein paar Worte mit seinem Kollegen gewechselt haben. Und nachdem dieser gegangen ist, bleibt er allein. Sein Dienst dauert zwölf Stunden, bis zum nächsten Morgen um sechs.
Anders als bei der Blockstelle Belicke, die ein Steinbau ist, handelt es sich bei dem Streckenposten 89 lediglich um eine mit Teerpappe und Wellblech abgedichtete Holzbude, die direkt an den Schienen liegt und an deren Seite unübersehbar die Zahl 89 prangt. Auffällig der breite gemauerte Schornstein, der von dem flachen Dach aufragt. Der Bahnübergang, an dem die Bude steht, ist auf dem Bild, das ich gesehen habe, nicht zu erkennen, nur ein paar kahle Bäume, ein Telegrafenmast und die nach hinten wegführenden Schienen.
Auch Otto Wustermark hat seinen Dienst abends um sechs angetreten, er endet wie bei Ackermann am nächsten Morgen um sechs. Und wie Ackermann wird er die Strecke von Genthin, seinem Wohnort, zum Posten 89 mit dem Rad zurückgelegt haben.
Was noch? In der Ecke ein Eisenofen, auf dem eine Blechkanne mit Kaffee steht. Ein Stuhl, ein Tisch, das Streckentelefon, mit dem sich die Verbindung zu den benachbarten Posten und zum nächsten Bahnhof herstellen lässt. Auf einem Brett an der Wand: das Signalhorn, die Handlampe und eine Reihe von Knallkapseln, die sogenannten Petarden, die ebenso wie das Signalhorn und die Handlampe immer griffbereit liegen müssen.
So ungefähr hat man sich die Bude 89 vorzustellen.
Die Knallkapseln oder Petarden sind Explosivkörper, die bei Gefahr im Abstand von dreißig Metern auf die Schienen gelegt und durch das darüber rollende Rad ausgelöst werden. Sie sind akustische Signale, die dem Lokführer bedeuten: Sofort halten! Laut Handbuch der Eisenbahn von 1931 ist bei ihrer Anwendung Vorsicht geboten.
Am Stellwerk Genthin Ost, kurz GO, führt außen eine Eisentreppe hoch. Es ist ein richtiges Haus, solide gebaut, mit großen, zur Strecke hin gelegenen Fenstern, die eine Art Erker bilden. Von dort oben hat man sowohl den Bahnhof im Blick als auch die ein- und ausfahrenden Züge.
Auf Adolf Lebrecht, der an diesem Abend dort Dienst hat, lastet eine größere Verantwortung als auf Ackermann und Wustermark. Deshalb dauert seine Nachtschicht auch nicht zwölf, sondern nur acht Stunden, von zehn Uhr abends bis morgens um sechs. Er ist fünfundfünfzig Jahre alt und lebt – wie Wustermark – in Genthin. Auch er benutzt für den Weg zur Arbeit gewöhnlich das Rad. An diesem Abend aber ging er (die Kälte, der Schnee) zu Fuß.
Als er die Eisentreppe erreicht, taucht, eben von seinem Rundgang zurück, Kurt Zeuner aus der Dunkelheit auf. Er ist für die Schneewache eingeteilt und hat dafür zu sorgen, dass die Weichen nicht einschneien; er muss sie mit dem Besen abfegen oder notfalls, wie manchmal bei Verwehungen und starkem Frost, mit den Händen freilegen.
Die beiden reden ein paar Worte miteinander. Dann steigen sie die Treppe hoch. Zeuner lässt Lebrecht, dem Älteren und Ranghöheren, den Vortritt. Als sie die Tür öffnen, schlägt ihnen die Wärme entgegen. Zeuner zieht seinen Mantel aus, wirft ihn auf die Bank und reibt sich die Hände, während Lebrecht, wie immer, zuerst in den Erker tritt, um einen Blick auf die Strecke zu werfen.
An diesem Abend, in dieser Nacht bekommen Ackermann und Wustermark die Lokomotive, die den Unglückszug zieht, zweimal zu sehen. Das erste Mal, als sie, unterwegs von Braunschweig nach Berlin, gegen 20 Uhr 20 mit dem D 33 an ihnen vorbeifährt, das zweite Mal, als sie mit dem D 180 zurückkommt, wenige Minuten, bevor es geschieht.
Während Lebrecht, der um 20 Uhr 20 noch zu Hause vorm Radio sitzt, sie nur einmal sieht, und zwar erst, als es zu spät ist, um sie danach immer zu sehen. Anfangs nur nachts oder beim Betreten eines dunklen Zimmers, dann auch draußen im Hof, auf der Straße, im Hellen. Beim Schneeschippen im Winter, beim Rechen des Sandwegs vorm Haus im Sommer; beim Blick in den Stall, in den schwarz glänzenden Augen der Kaninchen – immer sieht er die beiden Scheinwerferschlitze aus der Dunkelheit auftauchen, unerwartet, bösartig, völlig unbegreiflich.
*
Wernicke und Krollmann, beide aus Magdeburg. Wernicke aus Sudenburg, Krollmann aus Buckau. Von keinem ist eine Beschreibung überliefert, nur diese fleischlosen Sätze, mit denen sie die Schuldvorhaltungen abzuwehren versuchten, und doch kommt es mir vor, als sei Wernicke, der Ältere, zugleich der Größere gewesen, ein massiger Mann, der mit seiner Gewalt den Heizer beiseitezuschieben pflegte, ein Polterer mit glattrasiertem Gesicht, in dessen Nackenfalten Ablagerungen von Ruß zu finden waren, egal, wie gründlich er sich auch wusch, wie viel Seife er auch auf den Lappen gab, wie fest er auch rieb … um die Falten zu glätten, beugte er den Kopf vor, schrubbte dann den Nacken, aber wenn er den Kopf wieder hob, entstanden die Falten erneut, und damit war auch der Dreck wieder da. Zwei schwarze Rußstreifen zwischen drei roten Fettrollen.
Krollmann dagegen: ein Leichtgewicht mit flatternden Hosen, die von einem viel zu langen Gürtel am Rutschen gehindert wurden. Täglich fanden sich in der ihm von seiner Frau mitgegebenen Messingbüchse neben den Broten drei Pferdefleisch-Buletten, von denen eine für Wernicke bestimmt war, dazu ein Gläschen Mostrich aus Bautzen und, sommers, zwei aufgeschnittene Äpfel.
Sein Platz im Führerhaus war links. Wenn er nicht mit dem Feuer beschäftigt war, hatte er (insbesondere beim Rangieren, bei Fahrten mit dem Tender voran oder beim Bahnhofsdurchqueren) die linke Streckenseite im Auge zu behalten. Er stand am linken Fenster, Wernicke am rechten; beide achteten auf die Signale. Wer ihre Stellung zuerst aufnahm, rief sie dem anderen zu, und dieser wiederholte den Ruf, sobald er sie ebenfalls erkannte.
So war es vorgeschrieben.
Sie fuhren seit einem Vierteljahr zusammen, werden sich aber schon vorher gekannt haben. Tach, Wernicke! Tach, Krollmann! Jeder tippte an den Schirm seiner Mütze und ging weiter. Jetzt waren sie zusammengespannt. Ja, so kann man es nennen. Nirgends aber ein Hinweis darauf, dass sie darüber hinaus Umgang pflegten, auch privat. Sie fuhren zusammen und gingen danach ihrer Wege. Wernicke kehrte nach Sudenburg zurück, Krollmann nach Buckau.
Am Tag davor, dem vorm Unglück, endete ihr Dienst abends gegen acht. Ihre Unterkunft lag auf dem Gelände des Rangierbahnhofs. Nachdem sie sich gewaschen und umgezogen hatten, knöpften sie ihre Joppe zu, schlugen den Kragen hoch, klemmten die Tasche unter den Arm und traten auf die Straße hinaus.
Nach Sudenburg brauchte Wernicke ungefähr eine Stunde. Gegen neun kam er zu Hause an, schloss die Tür auf und stieg zu seiner Wohnung hinauf. Ich kenne das Haus. Nach meinem ersten Besuch im Archiv bin ich hingefahren und in der Wolfenbüttelerstraße, in der er wohnte, auf und ab gegangen, es war ein dreistöckiges Gebäude mit zwei übereinanderliegenden Erkerzimmern, von denen das obere zur Wernickeschen Wohnung gehört haben muss.
Was dann geschah, klingt in der Protokollsprache, in die seine Aussage übersetzt wurde, so: Ich habe Abendbrot gegessen und mich noch etwas mit meiner Familie unterhalten. Nachdem die 22-Uhr-Nachrichten im Radio zu Ende waren, habe ich mich zu Bett gelegt. Ich habe bis acht Uhr gut durchgeschlafen. Ich bin dann aufgestanden, habe gefrühstückt und bin zu Fuß wieder nach meiner Dienststelle gegangen, wo ich um elf Uhr ankam und Krollmann traf.
Es ist der Tag, an dem in Berlin vierzehn und in den Außenbezirken sechzehn bis achtzehn Grad minus gemessen werden. Und an dem die Sonne am Nachmittag um 15 Uhr 48 untergeht, während der Mond schon seit 12 Uhr 50 am Himmel steht.
Der Tag verlief, wie im Dienstplan vorgesehen: Fahrt nach Braunschweig, Herausdrücken des Zugs aus dem Bahnhof, Aufnahme von Kohle und Wasser, Reinigen des Feuers und Besanden der Lok. Anschließend Fahrt zur Untersuchungsgrube, um die Lok auch von unten zu revidieren.
Nachdem auch das erledigt war, gingen sie zu ihrer im Betriebswerk gelegenen Unterkunft. Krollmann machte sich lang (wie er sagte), Wernicke setzte sich an den Tisch und füllte Reparaturzettel aus. Das war nichts Besonderes. Das hieß nicht, dass ihm etwas aufgefallen wäre, was die Fahrtüchtigkeit der Lok beeinträchtigt hätte. Was er festhielt, waren kleinere Schäden, wie sie jederzeit auftraten, Undichtigkeiten, die sich nur im kalten Zustand der Maschine beseitigen ließen. Um sie nicht zu vergessen, notierte er sie auf verschiedene Zettel und legte sie in eine Mappe.
»Danach hab ich mich noch eine Viertelstunde lang gemacht.«
Auch er benutzte diesen Ausdruck.
Am frühen Abend Fahrt nach Berlin, wo sie, bei Einhaltung des Fahrplans, um 20 Uhr 21 hätten ankommen sollen, aber da ihre Abfahrt von Braunschweig ohne ihre Schuld mit großer Verspätung erfolgte, passieren sie um diese Zeit herum gerade das Stellwerk Genthin Ost, die Bude 89 und die Blockstelle Belicke.
Normale Fahrt. Gute Sicht, kein Nebel.
Nach ihrer Ankunft am Potsdamer Bahnhof wieder die obligatorischen Arbeiten: Reinigen der Maschine, Wasser und Kohle nehmen. Als Letztes fahren sie die Lok auf die Drehscheibe und bringen sie in die neue Fahrtrichtung: Westen.
Danach gehen sie zu ihrer Unterkunft, eine langgestreckte Holzbaracke.
Beim Nehmen der Kohle passiert etwas, worüber Krollmann später in aller Ausführlichkeit reden wird: Sie erhalten keine Lagerkohle, sondern frische aus der Lore, und zwar westfälische.
»Meistens ist die Lagerkohle so ausgetrocknet, dass sie nicht denselben Heizwert besitzt wie frische. Westfälische Kohle ist die beste, noch besser als die schlesische, die stückereicher und härter ist und deshalb ebenfalls schnell verbrennt. Ich weiß genau, dass wir westfälische Kohle erhalten haben.«
Am Nachmittag im Archiv, als ich Krollmanns Äußerungen zum ersten Mal las, glaubte ich, es sei die Begeisterung für seinen Beruf, die ihn so ausführlich über die Kohle sprechen ließ, bis mir klar wurde, dass sie Teil seiner Verteidigungsstrategie waren. Er wollte sagen, dass er wegen der schnell verbrennenden Kohle keine Zeit hatte, auf die Signale zu achten. Er konnte von seinem Führerstandfenster aus nicht, wie vorgeschrieben, die Strecke im Auge behalten, sondern musste Kohle nachwerfen.
Die schnell und hell brennende.
Die Lok steht jetzt in Fahrtrichtung im Schuppen, das heißt, mit der Spitze in Richtung Genthin, mit dem Tender zum Bahnhof, in dem zur selben Zeit, zu der sie ihre Brote auspacken, die beiden anderen ihre Maschine vor den Zug spannen. Die beiden anderen? Ernst und Stuck, Lokführer und Heizer des D 10, die, nähme man das Entsetzliche sportlich, die andere Mannschaft bildeten.
Ihr Zug wird von Gleis 2 abfahren.
Der Zug von Wernicke und Krollmann von Gleis 1.
Bis zur Abfahrt von Ernst und Stuck, die zuerst auf die Strecke gehen, bleiben noch fünfundzwanzig Minuten.
Dies ist der Moment, in dem die Abläufe ineinanderzugreifen beginnen. Keiner weiß es, die Katastrophe ist noch nicht sichtbar. Aber für einen Moment sind alle, die daran teilhaben werden, am selben Ort versammelt.
*
Der Potsdamer Bahnhof ist der älteste der Stadt. Gelegen am Endpunkt der Strecke nach Potsdam, die 1838 eröffnet und 1846 bis nach Magdeburg weitergeführt wurde, war es zunächst ein beinahe ländlich anmutendes Gebäude von den bescheidenen Ausmaßen eines märkischen Gutshauses, an dessen Stelle zwischen 1868 und 1872 ein neues errichtet wurde. Ein Prachtbau, der mit seinen klassizistischen Säulen, Bögen und Ornamenten von außen eher an ein Museum oder Theater erinnerte als an einen Bahnhof. Und doch war er genau das. Ein Kopfbahnhof mit zwei Mittelgleisen und acht Zugängen in der Bahnsteigmitte und an beiden Seiten, über dem sich ein Glasdach wölbte.
Die drei Schalterhallen befinden sich im Zwischengeschoss. Die Wände sind weiß gefliest, und das Abschlussgesims besteht aus roten und schwarzen Keramiksteinen. Die Treppenwände sind aus poliertem Muschelkalk. Die trichterförmigen Lampen hängen an langen Kabeln von den quer durch die Halle gespannten Stahlverstrebungen. Die Wartebänke stehen mit der Rückenlehne zu den Absperrgittern. In den Rundbögen über dem Ausgang hängen Reklametafeln für Boenicke-Zigarren, an einer Säule das lachende Gesicht des Sarottimohren. Ein Mann schiebt einen mit Milchkannen beladenen Karren vorbei.
Betrachtet man die Fotos lange genug, kann man das Stimmengewirr hören, die gellenden Pfiffe, das Knacken der Lautsprecher, bei dem die Leute in der Halle wie auf Befehl den Kopf heben, um ihn beim Ausbleiben der Durchsage wieder sinken zu lassen.
Am späten Abend kommen zwei Leute die Saarlandstraße herauf, eine junge Frau und ein etwas älterer Mann, der einen breitkrempigen Hut trägt, weshalb das ihm nachgesagte südländische Aussehen noch nicht zu erkennen ist. Erst im Abteil, nach Ablegen der Sachen, wird man das schwarze, straff nach hinten gekämmte Haar bemerken, den etwas dunkleren Teint, der in dem funzligen Abteillicht noch dunkler wirkt und neben dem die helle Haut der jungen Frau noch heller, fast weiß erscheint.
Jetzt aber sind sie nur zwei, die mit hochgeschlagenem Kragen und zusammengezogenen Schultern der Kälte zu entrinnen versuchen. Sie eilen am Haus Vaterland vorbei (in dem an diesem Abend die Kapelle Rudi Paetzold spielt) und steigen die Bahnhofstreppe mit den weiß gestrichenen, in der Dunkelheit leuchtenden Stufenkanten hinauf.
In der Linken trägt die junge Frau einen kleinen braunen Pappkoffer, über ihrer Schulter hängt eine rotbraunlederne Handtasche. Es sind die beiden in der Akte Nr. 779 erwähnten Gepäckstücke. Trotz des darin gefundenen Ausweises und der auf den Namen Carla Finck lautende Reichskleiderkarte wird es dem Beamten der Ermittlungs- und Fundsachenstelle, zu dem sie am nächsten Tag gebracht werden, nicht gelingen, sie jemandem zuzuordnen. Er wird Koffer und Tasche auf eine Liste setzen, aber nicht wissen, wie sie in den Zug gelangt sind. Eine Weile wird es aussehen, als hätten sie die Reise allein angetreten. Während es mit dem Gepäck ihres Begleiters kein Problem geben wird. Sein Name, Giuseppe Buonomo, wird schon auf der ersten in der Volksstimme abgedruckten Opferliste stehen und mir sofort ins Auge springen.
Zehn Minuten nachdem die beiden die Bahnhofshalle betreten haben, verlassen Wernicke und Krollmann ihre Unterkunft.
Sie schrauben die Thermosflaschen zu, drücken den Deckel auf die Brotdosen und stellen sie in die Tasche, nehmen ihre Joppen vom Haken neben der Tür und machen sich auf den Weg. Obwohl es verboten ist, gehen sie quer über die Gleise. Wernicke vorweg, Krollmann hinterher. Als er nach oben schaut, merkt er, dass es zu schneien begonnen hat, nicht viel, aber doch so, dass er spürt, wie sich die Schneekristalle auf seiner Haut niederlassen. Da er weiß, dass der Ruß mit dem Schmelzwasser einen schmierigen Schmutzfilm bildet, der sich in die Poren frisst, wischt er mit dem Ärmel über die Stirn, die Augen.
Daran wird er sich im Krankenhaus erinnern. Das meiste hat er vergessen oder behauptet es zumindest, aber an diese für den Unfall unwichtige Armbewegung wird er sich erinnern.
Die Gleise, die Schwellen, auf die sie die Füße zu setzen versuchen, der tanzende Schnee, die zum Schutz vor den englischen Fliegern oben mit Blenden versehenen Signale, vom Bahnhof her das Hallen der Lautsprecherdurchsagen. Dann der dunkle Umriss des Schuppens, in dem sie dreißig Minuten zuvor ihre Lok abgestellt haben.
Der 21. Dezember ist der erste Ferientag, von Nachmittag an gelten die um fünfzig Prozent verbilligten Weihnachtsrückfahrkarten, was der Grund für den Andrang sein mag, der an diesem Tag herrscht.
Der D 10 besteht aus neun Wagen, wobei es sich bei dem letzten um den kurz vor der Jahrhundertwende gebauten Packwagen handelt, dessen Wände aus Holz sind; für Reisende nach Düsseldorf und Köln führt er einen Schlafwagen der 1. und 2. Klasse, das Abteil des Zugführers befindet sich in der Wagenmitte.
Der Zug, dessen Plätze an diesem Abend zur Gänze besetzt sind, hat eine Länge von 203,7 Metern, was für die Berechnung des Bremswegs eine Rolle spielen wird. Besonders die Wagen der 3. Klasse sind so überfüllt, dass sich die Leute noch in den Gängen und Vorräumen drängen. Und irgendwo dort werden sich die beiden aufgehalten haben, die junge Frau und der südländisch aussehende Mann, in einem Wagen der 3. Klasse.
Pünktlich um 23 Uhr 15 ruckt der Zug an. Er quält sich regelrecht aus dem Bahnhof.
Zur selben Zeit fahren Wernicke und Krollmann mit ihrer Lok vom Schuppen ab, um sie vor den Zug zu spannen.
Der Zug, der die Bezeichnung D 180 führt, besteht aus zwölf Wagen. An der Spitze fährt der Bahnpostwagen, dann folgen zwei Schlaf- und acht Reisezugwagen, den Schluss bildet, wie beim D 10, der Packwagen. Um den Zug in den Bahnhof zu bugsieren, brauchen sie ungefähr eine Viertelstunde.
Pünktlich um 23 Uhr 45 fahren sie auch ab.
Die Route: Potsdam, Magdeburg, Halberstadt, Goslar, Kreiensen, Kassel, Gießen, Frankfurt am Main, Mainz, Bad Kreuznach, Neunkirchen/Saarland. Wobei es so ist, dass Wernicke und Krollmann nur bis Magdeburg fahren. Mit der Ankunft dort endet ihr Dienst, dort sollen sie abgelöst werden, während Ernst und Stuck, die im Führerhaus des D 10 stehen, bis Köln durchfahren. Durchfahren sollen.
Der D 10 hält in Potsdam. Dann in Brandenburg, Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim, Hannover, Hamm, Dortmund, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln.
So steht es im Fahrplan. In jeder dieser Städte hält er. Oder sollte er halten. Aber als er in Potsdam ankommt, hat er fünf Minuten Verspätung. Und in Brandenburg sind es schon zwölf. Schon da ist er, wie die Eisenbahner sagen, aus dem Plan gefallen.
Gründe: die vielen über die Festtage zu Verwandtenbesuchen aufgebrochenen Reisenden, die Dienstmädchen und Hausangestellten, die in der Fremde beschäftigt sind und Weihnachten zu Hause verbringen wollen, die fern von ihrem Heimatort arbeitenden und für ein paar Tage zu ihren Familien zurückkehrenden Handwerker und Arbeiter, dazu die in den Heimaturlaub entlassenen Soldaten, alle mit ihrem Gepäck und den eingepackten Geschenken. Der Zug ist so überladen, dass er sich, einmal zum Stehen gekommen, nur schwer wieder anfahren lässt. Was noch? Die Verdunklung. Aus Furcht vor Fliegerangriffen sind die Bahnhöfe verdunkelt, weshalb das Ein- und Aussteigen länger dauert als im Fahrplan vorgesehen.
Und der andere Zug? Der D 180?
Er kam mit ein paar Minuten Verspätung in Potsdam an, weil er eine Baustelle passieren musste. Bis Magdeburg hätte er jetzt keinen Halt mehr gehabt. Normalerweise.
Nun sind beide Züge auf der Strecke, mit immer geringer werdendem Abstand voneinander. Es ist eine Art Wettrennen, das jetzt beginnt. Eine Aufholjagd, von der die Beteiligten nicht wissen, dass sie daran teilnehmen, weder das Zugpersonal noch die Fahrgäste, die in den Schlafwagenkojen liegen, in den Abteilen sitzen oder in den Gängen und Vorräumen dicht gedrängt beieinander stehen. Unter der Decke glimmt ein blaues Licht, die Notbeleuchtung, von der die Züge als einzige erhellt sind. An den Fenstern ziehen die Dörfer, Wälder, Äcker und Seen vorbei. Es ist Neumond. Bei Brandenburg setzt Nebel ein. Sogenannter Höhennebel, der von oben kommt. Er reicht bis zum Hauptsignal, lässt die Strecke aber frei. Eine Art Nebeldach, kann man sagen. Aber die Signale sind gut zu erkennen.
Und Schnee. Den Schnee nicht vergessen, der die Dunkelheit draußen ein wenig erhellt. 15 Grad minus.
»Wir hatten stets freie Fahrt«, wird Wernicke später sagen. Die ganze Zeit über freie Fahrt. Und lügen.
*
Die letzten 25 Kilometer:
Brandenburg
Kirchmöser
Wusterwitz
Kade
Blockstelle Belicke
Bude 89
Genthin-Ost.
Die Zeit: 22. Dezember, 30 Minuten nach Mitternacht.
Das Wetter: Teilweise Nebel, vor allem zwischen Kade und Genthin.
Ernst, der Lokführer des D 10, sagt dazu: »Es war der sogenannte Höhennebel. Er kam von oben und reichte bis zum Licht des Hauptsignals, ließ die Strecke aber frei. Es war eine Art Nebelmauer, kann man wohl sagen. Aber die Lichter des Vor- und Hauptsignals konnte ich deutlich erkennen. Der Bahnhof Genthin selbst war nebelfrei. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass mittelmäßige Sicht herrschte. Ich bezeichne den Zustand als diesig.«
Was er nicht erwähnt: die Kälte, den leichten Schneefall. Das interessiert ihn nicht. Das braucht ihn nicht zu interessieren. Das ist nicht wichtig. Wichtig für ihn ist die Sicht. Und die war mittelmäßig. Also auch nicht erwähnenswert. Erwähnen muss er sie nur, weil er danach gefragt wird.
In dieser Nacht fährt er den langsamen Zug, den umständehalber schwerfälligen.
Fünf Minuten Verspätung in Potsdam, aus denen nach dem Halt in Brandenburg zwölf Minuten werden. Dann Kade und Belicke. In Kade Halt vor einer Ausfahrt, in Belicke vor der Einfahrt in die Blockstrecke. Warum er halten muss, weiß er nicht. Jedenfalls tut er so. Tatsächlich muss er es, als er sich dazu äußert, bereits gewusst haben, stellt sich aber ahnungslos wie in der Verdunklungsfrage. Er muss halten, weil unmittelbar vor ihm der M 176 fährt. M ist die Abkürzung für Militärzug. Es empfiehlt sich nicht, das eine oder andere (oder beides) in die Nähe der Unglücksursache zu rücken.
Das Einzige, was Ernst weiß, ist, dass er nach dem Halt vor Belicke mit 27 Minuten Verspätung auf der Strecke liegt. Ackermann, der in der Blockstelle Dienst tut, sieht ihn durch sein Fenster. Ihn? Nein, die in eine Dampfwolke gehüllte Lok, aus der Ernst die Signale beobachtet. Und dahinter die von der Dampfwolke verdeckte, in der Dunkelheit nur zu ahnende Reihe der Wagen.
Noch sechs Kilometer.
»Der Dienst verlief völlig normal«, wird Ackermann am nächsten Tag sagen und nach einer kleinen Pause hinzufügen: »Bis der M 176 kam.«
Der Militärzug. Während die Blockstrecke noch mit ihm belegt war, kam der D 10 und hielt. Um 0 Uhr 46 konnte er weiterfahren. Kurz danach tauchten die Lichter des D 180 auf. Da die Strecke jetzt mit dem D 10 belegt war, stand das Signal für ihn auf Rot. Normalerweise hätte er halten müssen. Doch nun war nichts mehr normal. Denn er hielt nicht, sondern fuhr einfach durch.
Als Ackermann das sah, fiel ihm vor Schreck die Tasse aus der Hand. Er riss das Fenster auf und blies, so kräftig er konnte, in das Signalhorn, kurz, lang, kurz, kurz. Aber der Zug reagierte nicht. Also rief er Wustermark an, den Schrankenwärter von der Bude 89, die er als Nächstes passieren würde, und sagte, er solle um Gotteswillen den D 180 zurückhalten, der habe das Hauptsignal A überfahren, und danach auch noch Lebrecht vom Stellwerk GO, um ihm dasselbe zu sagen.
Damit endete seine Aussage. Aber da er das Gefühl hatte, es würde noch etwas von ihm erwartet, setzte er, wie entschuldigend, hinzu:
»Nun gab es für mich nichts mehr zu tun.«
Und stützte die Hände auf die Knie.
Als der Anruf kam, ließ Wustermark gerade die Schranken für den D 10 herunter. Wann genau, vermochte er nicht zu sagen, aber er schätzte, dass es gegen 0 Uhr 50 war. Er nahm den Hörer ab und hörte Ackermanns Stimme:
»Der D 180!«
Die Schranken waren erst halb geschlossen, nun beeilte er sich, nahm das Signalhorn, die Knallkapseln, die Handlaterne und rannte in die Nacht hinaus, an den Schienen entlang. Der D 10 stampfte mit mäßigem Tempo heran. Damit der Lokführer sah, dass er auf seinem Posten war, gab er ihm, wie vorgeschrieben, ein weißes Lichtsignal, nur ganz kurz, und klappte dann gleich die rote Blende herunter. Er ließ den Zug passieren, und als der letzte Wagen vorbeirollte, sah er schon den anderen, den D 180, den Verfolger, und sprang auf die Gleise. Der Zug war höchsten zwei-, dreihundert Meter entfernt, er hörte ihn heranstampfen und fauchen … so schnell kam er auf ihn zu, dass keine Zeit mehr blieb, die Knallkapseln an die Schienen zu drücken. Deshalb schwenkte er bloß die rote Lampe wie wild im Kreise. Und zwar so lange, bis er wegspringen musste, runter von den Schienen. Weil er sonst überfahren worden wäre.
Danach rannte er neben dem vorbeiziehenden Zug zu seiner Bude zurück und rief das Stellwerk GO an, erhielt aber keinen Anschluss. Vermutlich war besetzt, weil Lebrecht gerade mit Ackermann telefonierte, der diesen ebenfalls angerufen hatte, um ihn zu alarmieren.
Noch achthundert Meter, vielleicht neunhundert.
Noch einmal zurück.
Nachdem Lebrecht auf Anweisung seiner Befehlsstelle das Signal A 1 für den D 10 auf Freie Fahrt gestellt hatte, trat er in den Erker und bemerkte, wie sich der Zug dem Stellwerk näherte. Er hörte das Klappen der Streckentastensperre, die von der letzten Achse des Zugs ausgelöst wurde, und sah, beim Blick zur Seite, dass sich die Scheibe von Schwarz auf Weiß umgelegt hatte. Der D 10 fuhr unter seinem Erker vorbei. Die Zugschlussstelle lag gleich hinter dem Übergang Mützelstraße. Danach legte er das Signal A 1 zurück auf Halt. Und nun kam der Anruf. Er hörte das Läuten des Telefons, nahm den Hörer ab und vernahm Ackermanns sich vor Aufregung überschlagende Stimme:
»Den D 180 stoppen!«
Im selben Moment kam Zeuner herein, zurück von seinem Kontrollgang zu den Weichen, und hörte, wie Lebrecht rief:
»Wat? Zug is durch?«
Ja, Zeuner war sein Zeuge. Er war dabei. Er sah, wie Lebrecht den Hörer hinwarf, die rote Lampe nahm, das Fenster aufriss und fortgesetzt in Richtung Berlin winkte. Beide starrten dem heranrasenden Zug entgegen, dem D 180, aber Lebrecht tutete auch noch in sein Signalhorn und winkte mit der roten Lampe. Und als er sich umdrehte, sah er, dass der D 10 siebzig, achtzig Meter hinterm Stellwerk stehen geblieben war. Sofort war ihm klar, was passieren würde. Er tutete weiter in das Signalhorn, winkte weiter mit der Laterne, konnte aber nicht feststellen, dass der D 180 seine Geschwindigkeit auch nur ein wenig verringert hätte.
Und als er am Stellwerk vorbei war, schlug Lebrecht, weil er wusste, dass jetzt der Aufprall erfolgen würde, und er es nicht sehen und hören wollte, die Hände vors Gesicht.
So seine erste, von Zeuner gestützte Aussage.
Normalerweise hätte der D 10 beim Durchfahren des Bahnhofs Genthin eine Geschwindigkeit von 105 km/h gehabt. Aber nach dem Halt in Belicke brauchte er eine Weile, um wieder seine normale Geschwindigkeit zu erreichen. Ernst, der Lokführer, schätzte, dass sie mit höchstens 80 km/h in den Bahnhof einfuhren.
Eine Frau, die am Schwarzen Weg wohnte, einer Straße, die parallel zu den Schienen verläuft, erzählte später, sie sei von einem Geräusch geweckt worden. Da sie meinte, das Geräusch sei von draußen gekommen, habe sie das Fenster geöffnet und einen herannahenden Zug bemerkt, der plötzlich, völlig unerwartet für sie, mit kreischenden Rädern stoppte. Das war der D 10. Was sie nicht wusste, war, dass Ernst die Schnellbremse gezogen und zur Erhöhung der Bremswirkung den Sandstreuer ausgelöst hatte. Der Zug bremste jäh ab, lief noch ein Stück und kam zum Stehen.
Das ist der Moment, den man einfrieren möchte, der Moment davor. Der Zug steht eingangs des Bahnhofs. Die Leute in den Abteilen dösen vor sich hin. Unter der Decke glimmt das blaue Licht. Die Stadt draußen liegt im Dunkeln. Noch ist alles in Ordnung, und im nächsten Moment ist es das nicht mehr.