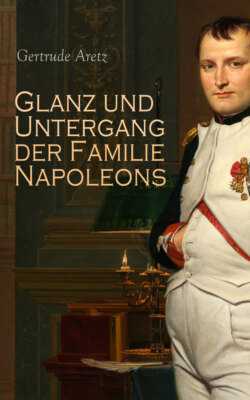Читать книгу Glanz und Untergang der Familie Napoleons - Gertrude Aretz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеErst die politischen Ereignisse in Frankreich sollten die Brüder wieder zusammenführen. Eben war der Kaiser im Begriff, sich an die Spitze seiner letzten Phalangen zu stellen, um sein Reich zu verteidigen. Jetzt zeigte Joseph sich als edler Bruder. Aller Groll, alle Zwistigkeiten waren vergessen; der bei allen Bonaparte so ausgeprägte Sinn der Zusammengehörigkeit, wenn die Interessen der Familie auf dem Spiele standen, verleugnete sich auch in diesem Augenblick bei Joseph nicht. »Sire, die Verletzung des Schweizer Gebietes hat dem Feinde Frankreich geöffnet«, schrieb er Napoleon am 29. Dezember 1813; »mögen Eure Majestät überzeugt sein, daß in solchen Lagen mein Herz ganz französisch ist. Die Ereignisse haben mich nach Frankreich zurückgeführt, und ich würde glücklich sein, wenn ich Ihnen in irgend etwas von Nutzen sein könnte. Ich bin bereit, alles zu tun, um Frankreich meine Ergebenheit zu beweisen.
Ich weiß auch, Sire, was ich Spanien schuldig bin. Ich kenne meine Pflichten und wünsche sie alle zu erfüllen. Rechte kenne ich nur, um sie dem allgemeinen Wohle der Menschheit zu opfern, und ich werde glücklich sein, wenn ich durch ihr Opfer zur Ruhe Europas beitragen kann. Es wäre mein Wunsch, daß Eure Majestät einen Ihrer Minister beauftragten, um sich über diesen Gegenstand mit dem Herzoge von Santa Fé, meinem Minister des Äußern, zu verständigen.«
Napoleon antwortete auf diesen Brief am 7. Januar 1814 ziemlich sarkastisch: »Ich habe Ihren Brief erhalten. In der Lage, in der ich mich befinde, ist er viel zu geistreich. Hier haben Sie in wenigen Worten die ganze Sachlage. Frankreich ist vom Feinde überfallen. Ganz Europa hat die Waffen gegen mich erhoben. Sie sind nicht mehr König von Spanien. Ich brauche Ihre Verzichtleistung als solcher nicht, weil ich Spanien weder für mich haben noch darüber verfügen will. Aber ich will mich auch nur in die Angelegenheiten dieses Landes mischen, um dort Frieden zu haben und über meine Armee verfügen zu können.
Was gedenken Sie zu tun? Wollen Sie sich als französischer Prinz dem Throne nähern? Dann sind Sie meiner Freundschaft gewiß. Sie werden Ihr Jahrgeld haben und mein Untertan als Prinz von Geblüt sein. Dann müssen Sie jedoch so wie ich handeln. Sie müssen Ihre Rolle bekennen, mir einen einfachen, zur Bekanntmachung geeigneten Brief schreiben, alle Befehle annehmen, sich eifrig für mich und den König von Rom bemühen sowie sich der Regentschaft der Kaiserin geneigt zeigen.
Ist Ihnen das nicht möglich? Haben Sie hiefür nicht das richtige Verständnis? Dann müssen Sie sich auf 40 Meilen von Paris in ein Schloß der Provinz in die Vergessenheit zurückziehen. Lebe ich, so werden auch Sie ruhig dort leben. Sterbe ich, so werden Sie dort getötet oder verhaftet werden. Sie werden mir, der Familie und Ihren Töchtern sowie Frankreich von keinem Nutzen sein, aber Sie werden mir auch nicht schaden oder hinderlich sein. Wählen Sie rasch und fassen Sie Ihren Entschluß. Jedes Gefühl des Herzens, sei es nun freundlich oder feindlich, ist unnütz und nicht am Platze.«
Der Brief war rauh, fast hart, aber den Umständen angemessen. Napoleon hatte keine Zeit mit Sentimentalitäten zu verlieren. Und Joseph beugte sich. Er eilte nach Paris und ward von Napoleon aufs herzlichste empfangen. Er sowie Julie führten von nun an den Titel König und Königin, jedoch ohne Benennung des Landes. Der Kaiser ernannte seinen Bruder zu seinem Generalleutnant und übergab ihm den Oberbefehl über die Truppen, die Paris verteidigen und die Kaiserin und den Thronerben schützen sollten. Zum zweitenmal bezog Joseph das Luxembourgpalais.
Unter seinen Befehlen standen der Marschall Moncey und die Generale Hulin und Caffarelli. Als Rat bei der Kaiserin-Regentin stand ihm der Erzkanzler Cambacérès zur Seite. Im übrigen waren es immer des Kaisers Befehle, die entschieden. Im Fall die Möglichkeit eintrete, daß jede Verbindung mit dem Hauptquartier und der Hauptstadt unterbrochen würde und der Feind sich den Toren nähere, sollte Joseph die Kaiserin und den König von Rom nach der Loire abreisen lassen, mit ihnen die Minister, Großwürdenträger, die Mitglieder des Senats, der Gesetzgebenden Körperschaft und des Staatsrats. Er selbst sollte versuchen, Paris bis zum letzten Augenblick zu halten. So hatte der Kaiser seinem Bruder mündlich und etwas später auch schriftlich befohlen, denn er wollte, wie er schrieb, seinen Sohn lieber tot in der Seine als in den Händen der Feinde wissen.
Joseph war nicht für die Entfernung der Kaiserin von Paris. Er sah darin verhängnisvolle Folgen für die Hauptstadt. Aber der Wille Napoleons gestattete keine Widerrede. Noch einmal hatte der Kaiser ihm geschrieben: »Die Kaiserin in Paris lassen, hieße Verrat.« Und somit war jede Unterhandlung von Seiten Josephs unnütz. Er konnte nur gehorchen. Seine Aufgabe war überdies keine leichte. Hätte er sie so ausgeführt, wie er sie hätte ausführen sollen, so müßte er ein Napoleon gewesen sein, denn nur dieser wäre ihr gewachsen gewesen. »Man gibt sich die größte Mühe, recht zu tun, aber man findet die Arbeit schwer«, schrieb zu jener Zeit der Polizeiminister Savary an den Kaiser. Mit dem »man« war Joseph gemeint. Er versagte in der Tat, als er die Dinge sich zum Schlechten wenden sah, und versuchte verschiedene Male, Napoleon zum Frieden mit den früheren Grenzen zu bewegen. Noch am 9. März riet er ihm: »Nach dem neuen Siege, den Sie soeben davongetragen haben (bei Craonne), können Sie einen ruhmvollen Frieden mit den früheren Grenzen schließen. Dieser Frieden wird Frankreich nach dem seit 1792 währenden langen Kampfe sich selbst wieder geben. Er wird nichts Entehrendes an sich haben, da Frankreich nichts von seinem Boden verliert und in seinem Innern die gewünschten Veränderungen vollbracht hat.« Napoleon aber hatte darüber seine eigene Meinung.
Unglücklicherweise sollte der von Napoleon vorhergesehene Fall, daß sich der Feind der Hauptstadt näherte, früher eintreten, als man vermutete. Joseph glaubte im Sinne seines Bruders zu handeln, wenn er Marie Luise und ihren Sohn so schnell wie möglich in Sicherheit brächte. Er hielt es für um so nötiger, da ihm der Kriegsminister Herzog von Feltre erklärt hatte, es seien keine Waffen zur Verteidigung in den Arsenalen, weil man sie täglich an die Truppen verteile. Joseph machte daher die Kaiserin und den Erzkanzler mit den Wünschen des Kaisers bekannt und berief einen Rat von 24 Männern, Ministern, Großwürdenträgern und Präsidenten der Sektionen zusammen. In diesem Rate wurde die Abreise Marie Luises am 29. März einstimmig beschlossen. Die Regierung jedoch sollte so lange in Paris bleiben, bis es ihr unmöglich sei, länger standzuhalten. Nur im äußersten Falle sollte sie der Regentin folgen. In diesem Sinne verfaßte Joseph jene berühmte Proklamation, die noch am selben Abend in ganz Paris bekannt wurde.
Man hat es Joseph bitter vorgeworfen, daß er die Hauptstadt preisgab. Aber sollte er in Paris bleiben und persönlich an der Absetzung seines Bruders teilnehmen? Seine Abreise und die Vereinigung der Behörden und Truppen an der Loire hätten Napoleon, wenn er dorthin gekommen wäre, vielleicht von Nutzen sein können. Sie hätten ihn vielleicht in den Stand gesetzt, sich mit den vorhandenen Hilfsmitteln zu verteidigen und sein Glück nochmals zu versuchen. Der größte Vorwurf, den man Joseph machen muß, ist, daß er erstens zu übereilt handelte, und vor allem, daß er Talleyrand noch in Paris ließ, nachdem die Kaiserin bereits vierundzwanzig Stunden unterwegs war. Das hieß allen Intrigen Vorschub leisten, um so mehr, da ihn Napoleon vor dem Minister gewarnt hatte. »Mißtrauen Sie diesem Manne«, schrieb er in einem seiner Briefe vom 8. Februar 1814; »ich verwende ihn seit 16 Jahren. Ich habe ihm bisweilen sogar meine Gunst geschenkt. Aber er ist sicher der größte Feind unseres Hauses, seitdem es seit einiger Zeit vom Glück verlassen ist.« Gerade Talleyrand aus Paris zu entfernen, wäre Josephs erste Pflicht gewesen. Auch hätte er alles versuchen müssen, die Pariser Bevölkerung zu den Waffen zu vereinigen. Statt dessen blieb er acht Tage lang untätig. Nicht eine einzige Maßnahme wurde getroffen, kein einziger militärischer Befehl zur Verteidigung der Stadt erteilt. Sie mußte ihrem Schicksal entgegengehen!
Nach der Abdankung seines Bruders zog sich Joseph in die Schweiz zurück. Dort kaufte er am Genfer See, in der Nähe von Nyon, das schöne Schloß Prangins und nahm den Namen Graf von Survilliers an. Er lebte ganz seinen literarischen Interessen und Arbeiten, die ab und zu durch einen Besuch in dem nahen Coppet bei Frau von Staël und Julie Récamier unterbrochen wurden.
Als Privatmann stand Joseph über jeden Tadel erhaben da. Freund wie Feind sind sich darüber einig, daß er ein sehr angenehmer und liebenswürdiger Mensch war. Schon seine äußere, vornehme Erscheinung verschaffte ihm überall Sympathie. Talleyrand sagte einmal zu Stanislas Girardin: »Joseph Bonaparte hat die Gabe, sich beliebt zu machen. Damit kommt man überall durch.« Sogar der Pamphletist Goldsmith, der an den Bonapartes sonst kein gutes Haar läßt, erkennt an, daß Joseph, »der älteste der heiligen Familie, ein sehr sanfter und friedlicher Charakter sei«.
Sein Aufenthalt in Prangins war jedoch keineswegs ungestört. Der Exkönig und seine Familie wurden sowohl von der Berner als auch von der Pariser Polizei mit allen möglichen Scherereien belästigt. Man verfolgte die Bonaparte, wo sie sich auch befanden, auf Schritt und Tritt. Die Beauharnais hingegen ließ man sogar in Frankreich in Frieden. Die einen sowohl wie die andern indes waren nach der ersten Abdankung weit entfernt, eine Revolution zugunsten der Napoleoniden herbeizuführen.
Als Joseph die Ankunft Napoleons von Elba in Grenoble erfuhr, machte er sich sofort in der Nacht des 19. März mit seinen beiden Töchtern Zenaïde und Charlotte nach Frankreich auf.7 Wie man sagt, war er auf seines Bruders Rückkehr vorbereitet, denn er hatte schon einige Tage zuvor durch den waadtländischen Gendarmerieoffizier Cauderay Nachricht erhalten und einige Wertsachen und Papiere in Sicherheit gebracht. Er selbst war den Beobachtungen der Polizei über eine geheime Treppe, die noch heute den Besuchern des Schlosses gezeigt wird, entkommen. Am 22. März traf er in Paris ein.
Das Wiedersehen der beiden Brüder war ein sehr freudiges. Joseph ist immer der einzige gewesen, mit dem sich Napoleon als Bruder gefühlt hat. Die ersten Eindrücke der Kindheit verwischten sich nie ganz im Gedächtnis des Kaisers. Nie hat er Joseph für lange Zeit sein Vertrauen entzogen. Weder die Beziehungen zu seinen Feinden noch die fortwährenden unberechtigten Ansprüche Josephs auf den französischen Thron haben jemals ernstlich das gute Einvernehmen beider gefährdet. Als einst in Sankt Helena das Gespräch auf die schlechten Dienste kam, die seine Brüder ihm geleistet hätten, gedachte Napoleon Josephs mit den Worten: »Er war ein sehr guter Mensch und liebte mich aufrichtig.« Auch Joseph hat Napoleon im Unglück nicht vergessen. »Wie auch die Streitigkeiten beschaffen sein mögen«, schrieb er einmal an Julie, »die zwischen mir und dem Kaiser bestanden haben, er ist doch immer der Mensch, den ich am meisten auf der Welt liebe.«
Joseph bezog nun wieder in Paris das Luxembourgpalais und führte von neuem den Titel »Kaiserlicher Prinz«. Aber sein Leben war jetzt höchst einfach. Er war der Prachtentfaltung müde. Er hätte es gern gesehen, wenn Napoleon sich mit der konstitutionellen Partei verständigt haben würde, der auch Frau von Staël, Lafayette und Benjamin Constant angehörten. Es gelang ihm, wenigstens des Kaisers Abneigung gegen die Einberufung der Kammern zu besiegen, und sie kam für Ende Mai zustande. Joseph wurde Mitglied der Pairskammer. Leider konnte er auch jetzt noch nicht ganz die bonapartische Eitelkeit und Ehrsucht unterdrücken, denn er verlangte, daß man ihn zum Pair von Geburt und Rang und nicht durch Ernennung mache.
Im Juni ertönte wiederum die Kriegstrompete. Ehe Napoleon seinen letzten Feldzug antrat, ernannte er Joseph zum Präsidenten des Regierungsrates und übergab ihm die Abschriften aller Briefe, die Europas Fürsten an ihn geschrieben hatten. Später, von Sankt Helena aus, forderte er seinen Bruder auf, diese Briefe zu veröffentlichen, denn er meinte, das sei die beste Rechtfertigung aller Anschuldigungen gegen ihn. Als aber Joseph, der damals in Amerika weilte, seine Frau und seinen Sekretär Presle bat, ihm diese wichtigen Dokumente napoleonischer Geschichte zu senden, konnte man sie nicht mehr auffinden. Sie waren gestohlen worden. Im Jahre 1822 wurden die Originale in London versteigert, und Rußland erwarb die des Kaisers Alexander für 10.000 Pfund.
Waterloo machte allen Hoffnungen der Bonaparte ein Ende. Auf Befehl seines Bruders berief Joseph die Minister zusammen, um die nötigen Maßnahmen zu treffen. Er riet Napoleon dringend, nicht bedingungslos abzudanken, sondern nur im Sinne seines Sohnes. Aber die Kammern erkannten das nicht an. Joseph hatte die Absicht, sich mit seinem Bruder nach Amerika einzuschiffen und dort mit ihm in der Zurückgezogenheit zu leben. Er war bereits entschlossen, ein amerikanisches Schiff, die Brigg »The Commerce«, zu mieten, die unter dem Kapitän Misserrey Branntwein in die Charente geliefert hatte. Doch vergebens versuchte er Napoleon zu bestimmen, diese günstige Gelegenheit wahrzunehmen. War es Niedergeschlagenheit, oder Ungewißheit, oder gar die Hoffnung auf einen unvorhergesehenen Glücksfall, kurz, der Kaiser schlug seines Bruders Anerbieten aus. Er hoffte, auf offene und rechtliche Weise nach den Vereinigten Staaten zu kommen.
Das Geschick und die Verbündeten jedoch bestimmten es anders. Joseph verließ indes nicht früher Frankreich, als bis er wußte, daß auch der Kaiser sich an Bord seines Schiffes befände. Napoleon bestieg den Bellerophon am 15. Juli. Erst jetzt, da er den Bruder in Sicherheit wußte, verließ auch Joseph am 25. Juli auf dem vorher erwähnten Schiff den französischen Boden, in der festen Überzeugung, daß sie sich in Amerika wiedersehen würden.
Die Überfahrt Josephs war lang und stürmisch. Erst am 28. August landete er in New-York. Aber er war glücklich dem Geschick entronnen; alles, Leid und Sorgen, aber auch aller Glanz und Ruhm lagen hinter ihm. Wäre er aufgegriffen worden, so hätte man ihn nach Rußland in die Verbannung geschickt.
Zunächst wohnte der ehemalige König von Spanien bei einer Frau Powel. Mit Hilfe Fouchés hatte er sich einen Paß verschafft, der auf den Namen Bouchard ausgestellt war. Man hielt ihn anfangs in New-York für Carnot und wollte ihn als solchen begrüßen. Als aber sein Inkognito gelüftet war, hießen die Amerikaner den Bruder des gestürzten Titanen aufs herzlichste willkommen und boten ihm einen angenehmen Zufluchtsort an, wo er von niemand belästigt wurde. Zuerst ließ Joseph sich im Staate New Jersey nieder. Dort gestattete man ihm im Jahre 1816, sich Grundbesitz zu kaufen, ohne daß er Amerikaner wurde. Er erwarb die schöne Besitzung Point Breeze an den Ufern des Delaware, eine der reichsten Niederlassungen der Gegend. Leider war Josephs Gattin Julie gezwungen, wieder nach Europa zurückzukehren, da sie das Klima nicht vertragen konnte. Seine Töchter trafen erst später bei ihm in Amerika ein.
Es ist kaum anzunehmen, daß Joseph der Anstifter jener Verschwörung war, die sich im Jahre 1816 zur Wiederherstellung des Kaiserreichs Mexiko unter den Anhängern Napoleons in Amerika anzettelte. Wie Montholon behauptet, soll der ehemalige König von Spanien die ihm angebotene mexikanische Krone sogar ausgeschlagen haben. Weit begreiflicher scheint hingegen Josephs Mitwirkung an dem Plane der Befreiung des Gefangenen von Sankt-Helena. Englischen Nachrichten zufolge soll Joseph dem Befreier seines Bruders 8 Millionen versprochen haben. Er besoldete in den englischen Häfen Leute, die den Auftrag hatten, einen Kapitän zu gewinnen. Dieser sollte dann unter dem Vorwande, in Sankt-Helena Anker werfen zu müssen, in Jamestown einlaufen und den Kaiser der Franzosen durch List befreien. Aber England hatte ein wachsames Auge auf die einmal errungene Beute. Alle diese Versuche trugen nur dazu bei, die Gefangenschaft Napoleons zu verschärfen.
Im Jahre 1825 erlangte Joseph auch die Erlaubnis, sich im Staate New York niederzulassen, ohne daß er auf seinen Titel als französischer Prinz verzichten mußte. Hier, wie in der Schweiz, lebte er unter dem Namen eines Grafen de Survilliers. Jetzt endlich hatte er das ersehnte Privatleben gefunden. Sein Haus war der Sammelpunkt der amerikanischen Geistes- und Finanzwelt und stand jedem Freunde offen. Der Graf beschäftigte sich viel mit literarischen Arbeiten, besonders mit der Abfassung der Memoiren seines an Ereignissen so reichen Lebens. Da er außerordentlich stolz auf seine Regierung in Italien war, wollte er jetzt den längst beschlossenen Plan zur Ausführung bringen, besonders diesen Teil seines Lebens der Nachwelt zu überliefern. Und so schrieb er nach dem Beispiel des großen Gefangenen auf Sankt-Helena in seinen Mußestunden seine Lebenserinnerungen.
Der Tod Napoleons erschütterte ihn gewaltig. Er hätte seinem mächtigen Bruder einen ruhmvolleren Abschluß seines tatenreichen Lebens gewünscht, besonders ein würdigeres Menschendasein in den letzten Jahren. Aber was vermochten Wünsche gegen die Vorsehung des Geschicks!
Von da an betrachtete Joseph sich wieder als Oberhaupt der Familie. Als die Julirevolution ausbrach, glaubte er sich als Vormund Napoleons II. verpflichtet, einige Vertrauenspersonen nach Wien zu schicken, um für die Sache seines Neffen einzutreten. Es fiel ihm nicht schwer, solche Leute zu finden, denn er war mit fast allen seinen Freunden, wie Roederer, Miot de Mélito, Belliard, Méneval, Lamarque, Mathieu Dumas, Girardin, Jourdan u. a. in Beziehung geblieben. Gleichzeitig wandte er sich aus demselben Grunde mit einer Protestschrift an die Abgeordnetenkammer, denn er hatte die naive Hoffnung, daß man das Volk um das Geschick des Volkes befragen würde. Er schrieb auch an Metternich, den er ganz für das Wohl des kaiserlichen Enkels bedacht glaubte, sowie an Marie Luise in Parma. Vergebens. Alle diese Schritte Josephs beweisen, wie bonapartistisch zuversichtlich er auch jetzt die Lage der Dinge betrachtete. Besonders der Brief an Marie Luise zeigt ein unerschütterliches Vertrauen zu dieser Frau, die sich noch zu Lebzeiten Napoleons mit dem General Neipperg verbunden hatte. Er beweist ferner, daß Joseph sehr ungenau über die Lage und Gesinnung der Herzogin von Parma unterrichtet war. Der Graf von Survilliers schien gar nicht zu wissen, daß sich Marie Luise von allem, was mit Napoleon zusammenhing, losgesagt hatte. Sie erließ sogar ein Dekret, das jedem Franzosen den Aufenthalt in ihrem Herzogtum untersagte. Joseph schrieb ihr:
New York, 10. September 1830.
Gnädige Frau Schwester und Schwägerin! Die Ereignisse, die in Paris Ende Juli stattgefunden haben, und von denen wir hier durch englische Zeitungen nur bis zum 1. August unterrichtet sind, räumen die Hauptschwierigkeiten aus dem Wege, die bis jetzt der Rückkehr Napoleons II. auf den Thron seines Vaters entgegenstanden. Wenn der Kaiser, sein Großvater, mich nur ein wenig unterstützen und ihm erlauben wollte, daß er sich unter meiner Führung den Franzosen zeige, so würde schon seine Gegenwart genügen, um ihn wieder als Herrscher einzusetzen. Der Herzog von Orléans kann nur infolge der Abwesenheit des Sohnes Eurer Majestät einige Anhänger sammeln ...
Wenn es mir möglich wäre, Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät, Ihrem Vater, die Gründe darzulegen, welche diesen Schritt Napoleons II. bedingen, so würde er keinen Augenblick mehr an seiner Notwendigkeit zweifeln. Sein Ministerium würde begreifen, daß das Glück seines Enkels, das Wohl Frankreichs, die Ruhe Italiens, ja vielleicht ganz Europas von der Wiedereinsetzung Napoleons II. in Frankreich abhängen. Er ist der einzige, den das Volk begehrt. Nur er allein wird eine neue Revolution verhindern, deren Folgen kein Mensch auf Erden voraussehen kann.
Joseph Fouché, Polizeiminister Napoleons. Zeitgenössischer Stich. Porträtsammlung der Nationalbibliothek, Wien
Ich hoffe, daß das lange Mißgeschick, das uns betroffen hat, im Herzen Eurer Majestät nicht die Zuneigung verwischt hat, welche Sie mir so oft erwiesen.«
Joseph sollte eine neue Enttäuschung erleben. Der Brief blieb unbeantwortet. Ihm ward das gleiche Schicksal zuteil wie vielen andern Schreiben der Familie Bonaparte: er wurde verbrannt. Aber die Hoffnung verlor Joseph doch nicht. Zwei Jahre später machte er sich selbst auf, um zu dem Jüngling zu eilen, den man in Schönbrunn von allen politischen Bewegungen fern hielt, dem man die Geschichte seines Vaters aufs ängstlichste verschwieg. Joseph kam zu spät. An demselben Tage, an dem er seine Reise nach England antrat, um sich in London mit Pässen nach Österreich zu versehen, hauchte der »Sohn des Mannes« sein junges Leben aus.
Madame de Staël
Joseph erhielt nicht die Erlaubnis, nach Frankreich oder nach Italien zurückzukehren, wo ihn die alte Mutter sehnsüchtig an ihre Seite wünschte. Noch ehe er sich nach England einschiffte, drückte er Letizia sein Bedauern aus, daß er sie nicht besuchen könne. Sein Brief ist eine bittere Anklage gegen die verbündeten Fürsten. »Es ist schmerzlich für einen Sohn und einen Gatten«, schrieb er, »sich von allen, die ihm lieb und teuer sind, getrennt zu sehen. Aber was ist zu machen? Ich bin ein grausamer Schuldiger: ich heiße Bonaparte! ... Ah! meine Herren Fürsten! die Nachwelt wird euch richten! Ihr seid sehr grausam.«
Er mußte sich zufrieden geben und harrte in London, der zweiten Etappe seiner Verbannung, auf eine günstigere Gelegenheit. Sie bot sich nicht oder kam zu spät. Denn erst im Jahre 1841 erhielt der Graf von Survilliers vom König von Sardinien die Erlaubnis, in Genua zu wohnen. Kurz darauf gestattete ihm auch der Großherzog von Toskana, sich in Florenz niederzulassen. Dort starb Joseph am 28. Juli 1844, umgeben von seiner Familie, von der er so lange Jahre getrennt gewesen war.
2 Unrichtigerweise gibt der »Almanach Impérial de 1806 à 1808« den 24. September 1794 als Datum der Heirat Josephs an.
3 Die Assignaten standen um diese Zeit so tief, daß sie nur noch 1 Prozent des Nominalwertes hatten.
4 Das erste Kind Josephs starb jedoch wenige Tage nach der Geburt.
5 Napoleon hatte durch Junot die Untreue Josephines erfahren.
6 Das Manifest wurde jedoch erst einen Monat später veröffentlicht. Am 25. Dezember 1805 erschien aber auch das berühmte 27. Bulletin, das vorläufig nur gegen die Königin Marie Karoline gerichtet war, und in dem es hieß: »Und sollten auch die Feindseligkeiten wieder beginnen und das Volk einen dreißigjährigen Krieg erleiden, eine so grausame Treulosigkeit kann nicht verziehen werden. Die Königin von Neapel hat aufgehört, zu regieren. Dieses letzte Vergehen hat ihr Schicksal bestimmt usw.«
7 Julie weilte bereits in Paris bei ihrer Schwester. Es war ihr gestattet worden, dort ihrer alten Mutter die Augen zuzudrücken.