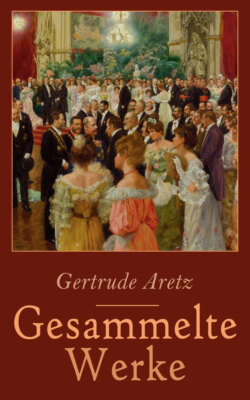Читать книгу Gesammelte Werke - Gertrude Aretz - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kaiserin Elisabeth von Österreich
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Die Frau, deren Leben durch tragische Unglücksfälle verdunkelt wurde, die selbst dem Mordstahl eines Anarchisten zum Opfer fiel, hat wenigstens eine überaus glückliche Kindheit gehabt. Sie kam am Weihnachtsabend des Jahres 1837 als drittes Kind des Herzogs Max in Bayern zur Welt. Man nannte sie Sissy, der passendste Name für die kleine, etwas knabenhafte Prinzessin, die wild wie ein Junge war. Gleichzeitig aber ist etwas Scheues, Schüchternes in ihr. Sie verlebte ihre Jugend in dem entzückend gelegenen Possenhofen am Starnbergersee. Die Liebe zur Natur, zu Blumen, Pflanzen und Tieren ist ihr angeboren. Auf dem Rücken eines Pferdes dahinzujagen, lernt sie schon früh, denn Herzog Max liebt es, mit seiner Lieblingstochter durch Feld und Wald zu streifen, manchmal zu Fuss, manchmal zu Pferd. Sissy lernt durch ihren Vater das Reiten und das Wandern – das Gehen, auf das sie später ebenso stolz ist als auf ihre Reitkunst. Sie meint, sie habe ihren charakteristischen federnden Gang nur daher, dass sie durch ihren Vater daran gewöhnt wurde, ihre Füsse durch lange Wanderungen zu trainieren. Sissy lernt noch vieles andere von ihrem Vater. Sie haben vieles miteinander gemeinsam, und Sissy steht ihm wohl von allen seinen Kindern seelisch und geistig am nächsten.
Als Kind schon bezwingt sie durch ihr Wesen alle Herzen. Man hat sie überall gern. In Possenhofen kennt sie einen jeden. Wie der Vater unterhält sie sich gern mit den einfachen Dorfleuten. Gelegentlich sitzt sie auch mit dem Herzog an den Tischen der Bauern, hört den Vater Zither spielen und zu selbst gemachten Knüttelreimen singen, zur grossen Freude der Zuhörerschaft. Da ihre Familie einer Nebenlinie der bayrischen Königsfamilie angehört, ist sie vom höfischen Zeremoniell und auch von politischem Zwang befreit. Natürlich gehen der Herzog und die Herzogin ab und zu in München an den Königshof, denn die Herzogin Ludowika ist eine Tochter des Königs Maximilian I. Doch im grossen und ganzen kümmert man sich wenig um ihn. Herzog Max ist darüber nicht böse, denn er macht sich gar nichts aus dem Hofleben. So werden auch Sissys Kinderjahre und die mit der Zeit auf sieben angewachsenen Geschwister in keiner Weise durch höfischen Zwang belastet. Die Kinder des Herzogs leben genau so ungebunden und frei wie die Kinder anderer adeliger Familien, höchstens noch um vieles freier; denn der Vater selbst ist ein ausgesprochen zwangloser Mensch. Er kümmert sich weder um Tradition noch um Klassenunterschiede, und um die Politik schon gar nicht. Robust nach aussen, romantisch im Innern, liebt er es weit mehr, sich mit Kunst und Literatur, mit Musik und mit Wissenschaften zu beschäftigen, als sich auf dem Exerzierplatz mit Paraden hervorzutun.
Herzog Max ist wohlhabend. Er und seine Familie brauchen sich nichts zu versagen, trotz der vielen Kinder. Wahrscheinlich ist er sogar reicher als der König von Preussen, den Herzogin Ludowikas Schwester Elisabeth geheiratet hat. Doch auch zwei andere Schwestern der Herzogin sind Königinnen und teilen hintereinander mit Friedrich August II. und Johann den sächsischen Thron. Die älteste aber, Karoline, war Kaiserin von Oesterreich mit Franz I. Es ist daher für Ludowika in Bayern eine gewisse Genugtuung, dass ihre einflussreiche Schwester an dem jungen Wiener Hof, Erzherzogin Sophie, die älteste Tochter des Herzogs Max, Helene, dazu ausersehen hat, eine der reichsten und mächtigsten Herrscherinnen in Europa zu werden. Sophie ist die Mutter des Kaisers Franz Joseph, der 1848 den österreichischen Thron bestiegen hat. Er ist jetzt dreiundzwanzig Jahre alt, und es ist höchste Zeit, dass er heiratet. Längst war es für die Erzherzogin Sophie beschlossene Sache, dass er seine Münchener Kusine Helene, Sissys Schwester, zur Frau nimmt. Die Prinzessin ist fünf Jahre jünger als Franz Joseph, schön gewachsen, gross und schlank. Doch es fehlt ihr jener Charme, den die um drei Jahre jüngere Sissy in so hohem Masse besitzt.
Bei der Zusammenkunft, die die Erzherzogin mit der herzoglichen Familie vereinbart hat, damit Kaiser Franz Joseph seine zukünftige Gattin näher kennenlerne, ist auch Sissy zugegen. Der Kaiser verliebt sich auf den ersten Blick in sie und entscheidet sich, sie zu heiraten, nachdem die junge Prinzessin ihre Zustimmung gegeben hat. Erzherzogin Sophie ist gegen diese Ehe, denn Sissy erscheint ihr für eine Kaiserin als zu jung. Aber Franz Joseph, der es sonst nie wagte, den Anordnungen seiner Mutter entgegenzuhandeln, besteht in diesem Fall auf seinem Willen.
Am 23. April 1854 zieht Sissy als kaiserliche Braut in Wien ein. In der Kaiserstadt fliegen ihr die Herzen aller zu. Das österreichische Volk, das Frauenschönheit so sehr schätzt, ist von dem Charme und der Anmut der liebenswürdigen zukünftigen Kaiserin entzückt. In der Augustinerkirche nimmt Fürsterzbischof Rauscher die Trauung des jungen Kaiserpaares vor. Am dritten Tag nach der Hochzeit ist Kaiserin Elisabeth von den vielen Zeremonien so erschöpft, dass sie sich weigert, weiter zu erscheinen. Es ist nicht nur körperliche Müdigkeit. Ihre empfindsame Seele leidet darunter, dass das Intimste derart an die Oeffentlichkeit gezerrt wird. Wieviel lieber wäre sie mit ihrem Gatten in irgendeinen kleinen Ort an einen der schönen österreichischen Seen gegangen, wo sie unerkannt mit ihm ihr erstes Glück hätte geniessen können. So hat es sich Sissy wohl einmal vorgestellt, wenn sie sich verheiratete. Nun aber ist sie eine Kaiserin. Kein Schritt in ihrem Leben wird mehr unbeobachtet bleiben. Sie fühlt, in diesen drei Tagen hat sich ihr Leben von Grund auf geändert. Sie gehört jetzt nicht mehr sich selbst oder etwa ihrem Gatten, sie gehört dem Lande. Und noch etwas wird ihr gleich in den ersten Tagen ihrer Ehe klar. Die formenstrenge Mutter des Kaisers übt ihre Macht in einer Weise aus, die Elisabeth bis ins Innerste verletzt. Sie fühlt, hier ist sie in einen goldenen Käfig geraten, aus dem es kein Entrinnen gibt. Sophie, ganz mit den Traditionen des Hofes verwachsen, hat das Feingefühl für gewisse Dinge des Takts verloren. Sie ist gewöhnt, mit ihren Söhnen über alles zu sprechen, auch über ihre Angelegenheiten mit Frauen. Am Wiener Hofe behandelt man diese Dinge mit einer gewissen Derbheit. Man ist nicht prüde in den Ausdrücken. Man redet offen über alles.
Am Morgen nach dem Hochzeitstag verlangt Sophie von der jungen Sissy, dass sie mit dem Kaiser am gemeinsamen Frühstückstisch erscheint. Elisabeth versetzt diese Aufforderung der Mutter in die peinlichste Verlegenheit, aber auch in Erstaunen, dass Franz Joseph scheinbar gar nichts dabei findet oder wenigstens nicht wagt, dieses erste gemeinsame Frühstück zu verhindern. Sissy ist sehr blass und kann vor Verlegenheit keinen Bissen essen. Dazu kommt, dass die Erzherzogin ganz ungeniert ihren Sohn über Einzelheiten ausfragt, die die junge Frau bis in die Haarwurzeln erröten lassen. Sie hält es schliesslich nicht mehr aus und läuft weinend in ihr Zimmer. Franz Joseph schneiden wohl diese ersten Tränen seiner geliebten Sissy ins Herz, doch er hat nicht den Mut, ihre Stellung als Kaiserin seiner Mutter gegenüber gleich von Anfang an in das richtige Verhältnis zu bringen.
Auf den jungen Kaiser wirken der grosse Liebreiz seiner jungen Frau, ihre Eigenart, ihre graziöse Anmut, ja sogar ihr nicht immer leicht zu lenkender Wille von Tag zu Tag berauschender. Er ist verliebt wie ein Leutnant und glücklich wie ein Gott, schreibt er an seinen Vetter, den Prinzen Albert von Sachsen. Und es ist wahr, Elisabeth wird immer schöner und anmutiger. Die Bilder aus dieser Zeit beweisen es. Trotzdem fehlt der jungen Kaiserin vieles zum vollkommenen Glück. Sie sieht ihren Gatten sehr wenig; sie ist in Laxenburg, das der junge Hof zur Residenz gewählt hat, wie allein. Die Staatsgeschäfte rufen den Kaiser oft tagelang nach Wien, und auch sonst sieht sie ihn nur morgens und abends.
Dem Alleinsein in Laxenburg und der Langeweile hilft sie durch Lesen vieler Bücher ab. Mit der Zeit aber merkt sie, dass der Kaiser, wenn er sie beim Lesen trifft, nicht besonders erfreut zu sein scheint. Von nun an liest Elisabeth heimlich und versteckt ihre Bücher. Wie gern hätte sie mit ihm über das Gelesene gesprochen. So hat sie eigentlich nur ihre Hofdamen zur Unterhaltung. Und die stehen alle im Bann der Erzherzogin Sophie. Als Kaiserin muss Elisabeth ihnen auch immer erst ein Thema geben. Sie muss sie immer fragen. Nie dürfen sie selbst ein interessantes Gespräch über etwas Neues, das Elisabeth nicht kennt, beginnen. So bleibt diese Unterhaltung sehr einseitig, und ein richtiger Gedankenaustausch kommt für Elisabeth, deren rege Phantasie immer beschäftigt sein möchte, nicht zustande. Noch viel weniger aber kann sie sich mit ihrem Schwiegervater unterhalten, der sie immer wie ein kleines Schulmädchen behandelt. Es ist daher um so verständlicher, dass Elisabeth sich später so gut und unbefangen mit ihren verschiedenen Sprachlehrern unterhält. Mit ihnen hat sie immer ein Thema, das den Kontakt sofort herstellt.
Elisabeth sucht ferner das eintönige Leben am Hofe durch Reitausflüge zu beleben. Die herrlichen Tiere in den kaiserlichen Ställen sind ihre grösste Freude. Sie kann halbe Tage, ohne zu ermüden, auf dem Pferde sitzen oder stundenlang spazierengehen. Schon kennt man die junge kühne Reiterin in der ganzen Umgebung von Laxenburg. Elisabeth möchte auch gern Wien einmal von einer anderen Seite kennenlernen als nur durch offizielles Ausfahren mit Sophie und dem Kaiser. In München ist sie mit ihrer Schwester Helene oft einkaufen gegangen. So fährt sie eines Tages mit einer Hofdame nach Wien. Den Wagen lässt sie unweit der Hofburg halten, und beide Damen begeben sich auf den damals beliebten Kohlmarktbummel und spazieren den Graben entlang. Die geschmackvollen Auslagen der eleganten Geschäfte interessieren die junge Kaiserin lebhaft. Sie bleibt hier und da stehen, kauft auch in manchen Geschäften eine Kleinigkeit. Natürlich haben die Wiener sofort ihre Kaiserin erkannt, und am nächsten Tag steht es in der Zeitung, dass Ihre Majestät ganz zwanglos in der Stadt eingekauft habe. Erzherzogin Sophie ist aufs höchste entrüstet. Elisabeth wird «befohlen», solche Gewohnheiten in Zukunft zu unterlassen. Die Gründe zum Tadel häufen sich. Als der Park von Laxenburg wieder dem Publikum offen steht, erfreut die jugendliche Kaiserin sich an den vielen hübschen Kindern, denen sie auf ihren Spaziergängen begegnet. Es sind meist Kinder aus dem Volke. Manchmal nimmt sie sie mit zu sich ins Schloss und lässt ihnen Schokolade oder Milch servieren und kleine Geschenke verabreichen. Die Kinder sind selig, Erzherzogin Sophie aber findet es für eine Kaiserin unpassend, sich unter das Volk zu mischen. Die Besuche der Kinder sind Elisabeth von nun an untersagt. So weht von vornherein eine fremde Luft um die junge Kaiserin; sie fühlt sich isoliert, sobald der Kaiser fern ist. Daher ist sie überglücklich, wenn sie mit ihm verreisen kann.
Die ersten Reisen, die Elisabeth mit Franz Joseph unternimmt, haben wohl hauptsächlich den Zweck, die Kaiserin den Völkern ihres Reiches zu zeigen. Ihr einfaches, natürliches Wesen, ihre liebenswürdige Art der Anteilnahme an allem, ihre entzückende, noch ganz mädchenhafte Erscheinung erwecken überall, wo sie hinkommt, Sympathie und warme Begeisterung. Dazu ist sie wundervoll angezogen, trotz aller Einfachheit. Sie hat viel Geschmack in der Kleidung und ist sehr elegant.
Als Elisabeth aus Mähren zurückkehrt, fühlt sie sich Mutter. Erzherzogin Sophie hat es aus den untrüglichen Anzeichen festgestellt und sofort ihrem Sohne geschrieben, der seine Reise in Böhmen ohne die Kaiserin noch weiter ausgedehnt hat. Wahrscheinlich hätte Elisabeth es ihrem Manne lieber selbst gesagt, wenn er zurückkehrte. Sophie wollte aber, dass es das Publikum erfährt. Elisabeth soll sich auch während der Schwangerschaft täglich im Laxenburger Park zeigen. So wollen es der Hofbrauch und die Tradition, aber gerade das ist für die feinempfindende Frau schrecklich. Sie findet es furchtbar, dass jedermann von ihrem Zustand weiss und genau die Zeit berechnen kann, wann das Kind, mit dessen Werden sie die süssesten und geheimsten Gedanken verknüpft, zur Welt kommen wird. Und zum grossen Verdruss der Erzherzogin geht sie überhaupt nicht mehr in den Garten. Sie kann sich mit all diesen widersinnigen Dingen, die von einer Herrscherin gefordert werden, nicht einverstanden erklären. Ihr ausgeprägtes Takt- und Persönlichkeitsgefühl sträubt sich dagegen. Und dieser Widerspruch der beiden so verschiedenen Welten ist die Veranlassung zu unaufhörlichem Tadel von seiten Sophies und zu vielen bitteren Stunden für Elisabeth.
Sie hat sich ihre Macht und hohe Stellung ganz anders vorgestellt. Da sie nie etwas recht machen, sich nie einer gleichgestimmten Seele eröffnen kann – auch dem Kaiser mag sie nicht immer ihr Leid klagen – wird Elisabeth an sich selbst irre. Sie ist keine Kampfnatur, sie zieht sich zurück. Sie wird scheu und schüchtern. Sie weint viel um ihre verlorene Freiheit und schreibt traurige Verse. Mit einem gefangenen Vogel vergleicht sich Elisabeth, der vor Heimwehschmerz in seinem Käfig fast vergeht. Oder sie klagt in bitterer Reue über die Eitelkeit, die sie verführte, die «breite Strasse der Freiheit zu verlassen und dafür einen goldenen Kerker einzutauschen».
In Ischl findet sie nach der Geburt ihres ersten Kindes, das im März 1855 zur Welt gekommen ist, ihre frohe Stimmung wieder. Es ist zwar eine Enttäuschung, dass es nicht ein Thronfolger, sondern ein kleines Töchterchen ist. Dennoch ist Elisabeth sehr glücklich. Das Kind erhält den Namen der Mutter des Kaisers. Das ist unter diesen Umständen selbstverständlich. Elisabeth hat man darüber gar nicht befragt. Ebensowenig fragt man die junge Mutter, als das Kleine fortgetragen und in die «Kindskammer» gebracht wird, die neben den Gemächern der Erzherzogin Sophie gelegen ist. Die Pflege des Säuglings geschieht nur nach Sophies Anordnungen, nicht nach denen der Mutter. Wenn Elisabeth ihr Töchterchen sehen will, muss sie einen Stock höher steigen, und nur nach vorheriger Anmeldung bei ihrer Schwiegermutter lässt man die Kaiserin das Kinderzimmer betreten. Ist es ein Wunder, dass Elisabeth die Lust verliert, sich weiter um die Erziehung der kleinen Prinzessin zu kümmern? Da man ihr das Kind entzieht, geht sie zu ihren geliebten Pferden. Sie darf wieder reiten und sitzt nun stundenlang im Sattel. Sie turnt und trainiert ihren schlanken Körper, sie lässt sich massieren, damit ihr Leib nicht schlaff wird. Das alles ist für Erzherzogin Sophie Grund genug, der ihrer Meinung nach extravaganten und überspannten jungen Frau die Erziehung ihrer Kinder auch fernerhin zu entziehen.
Die Hoffnung auf einen Thronfolger wird auch im nächsten Jahr zunichte. Elisabeth gibt im Juli 1856 ihrer zweiten Tochter Gisela das Leben. Die Enttäuschung ist allgemein. Erzherzogin Sophie besonders verbirgt ihren Unwillen nicht. Sie schreibt der unregelmässigen und «unsinnigen» Lebensweise der Kaiserin die Schuld zu, dass sie nur Mädchen zur Welt bringt. Jetzt aber hält die Kaiserin nicht mehr mit ihrer Empörung zurück. Sie fordert energisch von Franz Joseph, dass er ihre Rechte bei seiner Mutter verteidige. Sie will ihre beiden Kleinen in ihrer Nähe haben und zu ihnen gehen können, wenn sie will. Der Kaiser lässt sich endlich dazu bestimmen. Es ist der erste Sieg, den Elisabeth über die Erzherzogin erfochten hat. Natürlich verscherzt sie sich dadurch den letzten Rest von Sympathie von Seiten Sophies, und die offene Feindschaft beginnt.
Im gleichen Jahr reist das Kaiserpaar nach Italien, das damals noch teilweise österreichisch war. In Mailand werden Elisabeth und Franz Joseph mit fast beleidigender Kälte empfangen, und auch hier ist es wieder die Erscheinung der Kaiserin, die Wunder wirkt. Sie benutzt jeden Augenblick des Alleinseins mit dem Kaiser, ihn zu milderen Massnahmen für das Land zu gewinnen, und schliesslich ist es besonders ihr zu danken, dass Franz Joseph eine allgemeine Amnestie erlässt. Man spricht nur noch von der edlen Herrscherin, die trotz ihrer Jugend bereits so viel menschliches Empfinden besitzt und so einsichtsvoll zu handeln versteht.
Das Frühjahr 1857 ist für eine Reise nach Ungarn vorgesehen. Diesmal will Elisabeth die beiden Kinder mitnehmen. Erzherzogin Sophie ist dagegen. Die älteste Prinzessin ist nicht besonders kräftig, sie kann sich auf der Reise erkälten. Aber Elisabeth setzt ihren Willen durch, und die Kinder gehen mit nach Ungarn. Bereits als junges Mädchen hat sich Elisabeth einige Kenntnisse der ungarischen Sprache angeeignet. Graf Majláth, ein in Wien aufgewachsener Ungar, war ihr Lehrer. Er liebt sein Land leidenschaftlich und schildert Elisabeth den Charakter der Ungarn in den blendendsten Farben. Nun ist sie gespannt, ob alles stimmt, und sie erlebt keine Enttäuschung.
Anders als in Italien ist der Erfolg der schönen Kaiserin in Budapest ein ungeteilter. Sie selbst fühlt sich bei dem ritterlichen und lebensfrohen Volk, das ihr seine Sympathien so spontan zuwendet, sehr wohl. Kaum kann sie den Hass begreifen, den die Erzherzogin Sophie gegen alles, was ungarisch ist, zur Schau trägt. Nie hat man Sophie bewegen können, ungarischen Boden zu betreten. Nun feiert Elisabeths Schönheit Triumphe in Budapest, wie sie nur Maria Theresia erlebte. Franz Joseph ist überglücklich über diesen Erfolg. Alles ist für die Reise nach den kleinen ungarischen Städten bereits vorbereitet, da erkrankt die kleine Gisela und später auch Sophie. Während Gisela rasch gesundet, stirbt Sophie in den Armen der Kaiserin. Es ist ein furchtbarer Schlag für Elisabeth.
Die ungarische Reise wird sofort unterbrochen. Die Melancholie Elisabeths seit dem Tode des Kindes ist beängstigend. Sie sucht jetzt die Einsamkeit noch mehr auf als früher. Sie lacht kaum mehr. Ihre strahlenden Augen, in denen einst soviel Schalk steckte, bekommen jenen traurigen Ausdruck der Unglücklichen, die schweres inneres Leid niederdrückt. Das schmale blasse Gesicht mit dem schmerzlichen Zug um den Mund hat indes eher gewonnen. Es ist eine aus der Tiefe der Seele kommende Schönheit, die die Züge edler und reiner macht.
Mit Bangen sieht die Kaiserin dem Tag entgegen, an dem sie erneut einem Kinde das Leben schenken wird. Sie weiss ja, man verlangt jetzt unbedingt von ihr einen Sohn. Auch der Kaiser ist besorgt, es könne auch diesmal wieder ein Mädchen sein. Als es aber dann doch ein Sohn ist, da rinnen dem sonst gegen Gefühlsausbrüche verschlossenen Mann unaufhörlich Tränen des Glücks über die Wangen. Der Thronfolger erhält den Namen Rudolf. Nie war Elisabeth so glücklich, nie so von Dank gegen das Schicksal erfüllt. Ihr Lächeln kehrt wieder, aber die Augen behalten den tiefen Blick der Seele, die Trauriges erlebte.
Neues Unglück steht bevor. Oesterreich führt Krieg in Oberitalien. Die grosse Niederlage bei Solferino, durch die die Monarchie die Lombardei verliert, beendet den unglücklichen Feldzug. Elisabeth macht sich grosse Sorgen wegen der Zukunft. Die seelischen Aufregungen und alles, was sie bereits durchgemacht hat, zerren an ihren Nerven. Sie fühlt sich krank. Die Diagnose der Aerzte stellt eine beginnende Lungenaffektion fest. Man rät ihr, ein sonnigeres Klima aufzusuchen. Sie will fort aus Wien, so weit wie möglich weg, um eine andere Umgebung, andere Menschen zu sehen. Eine Zeitlang hält sie sich auf Madeira, dann auf Korfu auf. Vor allem von Korfu ist sie begeistert. Bei ihrer Rückkehr sieht sie wieder blendend aus, aber ihr Frohsinn ist endgültig dahin. Während ihrer Abwesenheit hat sie über vieles in ihrem Leben nachgedacht. Manches hätte auch von ihr aus vermieden werden können, denn sie ist oft starrköpfig und unversöhnlich gewesen. Aber das Wiener Klima bekommt ihr wieder nicht. Die Aerzte schicken sie erneut in wärmere Gegenden, und sie entscheidet sich für Korfu, das sie so liebt.
Der Kaiser leidet unter der fluchtartigen Abreise seiner Gattin. Er weiss sehr wohl, dass es tiefere Gründe sind, die sie von Wien fernhalten. Erst 1862 kehrt sie nach Wien zurück. Ihre lange Abwesenheit hat dem Volke viel zu denken gegeben. Niemand spricht mehr von ihrer Hysterie, ihrem exzentrischen Wesen. Vielmehr reden die Leute von dem Martyrium, das die junge Mutter zu erdulden hat. Der Jubel steigert sich beim Empfang der Kaiserin in Wien zu frenetischer Begeisterung. Viele Frauen weinen, und Elisabeth ist ergriffen von dieser warmen Begrüssung.
1866! Bei Ausbruch des Krieges mit Preussen weilt Elisabeth mit ihren Kindern in Ischl. Sie eilt sofort an des Kaisers Seite nach Wien und lässt die Kinder in Tirol. Die Katastrophe, die unvermeidlich war, drückt Elisabeth nieder. Am meisten befürchtet sie einen schmachvollen Frieden. Lieber in Ehren zugrunde gehen, als einen solchen abschliessen, ist ihre Ansicht nach der Schlacht bei Königgrätz. Das Unglück klärt den Kaiser schliesslich doch über die verderbliche Politik seiner Mutter auf. Nach zwölfjähriger Ehe beginnt Franz Joseph, Vertrauen zu seiner Frau als Ratgeberin auch in manchen Fragen der Politik zu gewinnen. Er ist überzeugt, Elisabeth werde sein bester Minister in Ungarn sein. Er täuscht sich nicht. Was weder ihm noch den Staatsmännern des Wiener Kabinetts bisher gelungen ist, die unversöhnlichen Ungarn von den aufrichtigen Absichten der Regierung zu überzeugen, das bringt Elisabeth mit dem Liebreiz ihrer Erscheinung und ihrem menschlich empfindenden Herzen fertig. Die Ungarn haben vom ersten Augenblick an das Gefühl: diese Frau hat Verständnis für uns, sie liebt uns. Sie kommen ihr deshalb mit der Leidenschaft ihrer eigenen Empfindungen entgegen, zumal sie wissen, dass Elisabeth mit dem grössten Eifer ihre Sprache lernt. Und diese zarte, in der Politik sonst unerfahrene, in der Oeffentlichkeit schüchterne und zaghafte Frau ist in Ungarn eine ganz andere als in Wien, weil sie sich hier freier bewegen kann. Männer, wie der schon an Jahren reife Deák und der noch verhältnismässig junge Andrassy müssen ihrer Meinung nach wieder in der ungarischen Frage zu Einfluss kommen. Es ist indes ein hartes Stück Arbeit für Elisabeth, ehe sie den Kaiser dazu bewegen kann, den Mann der Revolution von 1848, den er einst zum Tode verurteilte, zu empfangen. Im Februar 1867 aber wird das selbständige Ministerium in Ungarn gebildet, mit Andrassy als Ministerpräsidenten. Es ist Elisabeths Verdienst. Sie und jeder weiss das. Diesen Sieg beschliesst einige Monate später die Krönung Elisabeths. Sie wird gleichzeitig mit der des Königs vorgenommen, was bis jetzt noch nie geschah. Als ihr die wirklich aus ehrlichem Herzen kommenden Rufe «Eljen Erzsébeth» ans Ohr dringen, da ist sie überglücklich über die Freude «ihrer Ungarn». Das ritterliche Volk aber gedenkt seiner jungen schönen Herrscherin noch eine ganz besondere Freude zu machen. Man weiss, wie sehr Elisabeth bei einem früheren Aufenthalt das einsam und idyllisch gelegene Schloss Gödöllö gefallen hat. Jetzt schenken es die Ungarn ihr und dem König als Sommerresidenz. Es wird bald zum Lieblingsaufenthalt Elisabeths, besonders wegen der schönen Jagdgelände. In diesem Schlosse bringt sie 1868, zehn Jahre nach der Geburt des Kronprinzen, wieder ein Mädchen zur Welt, das sie Marie-Valerie nennt. Erst jetzt kommt ihre Mütterlichkeit zur vollen Entfaltung und Reife. Hätte sie diese Erfüllung gleich anfangs gekannt, vielleicht wäre sie nie die rastlose Weltwanderin geworden.
Der heranwachsende Rudolf macht Elisabeth mit seiner physischen und geistigen Frühreife nicht geringe Sorge. Er ist schon als Zehnjähriger äusserst nervös, reizbar, und seine Lehrer beklagen sich ein paar Jahre später über die bei einem Vierzehnjährigen ganz abnormen Ansichten über Religion, die Zweifelsucht und die erstaunliche Freigeistigkeit des über seine Jahre weit entwickelten Knaben. Man schiebt alles auf den Einfluss Elisabeths, die in den letzten Jahren ihre älteren Kinder etwas mehr für sich gewonnen hat. Doch sie hat keinen Anteil an der Entwicklung solchen Denkens ihres Sohnes. Der Jüngling geht in allem seine eigenen Wege.
Seit Valeries Geburt wird die Umgebung der Kaiserin von Jahr zu Jahr ungarischer. Die kleine Prinzessin erhält nur ungarische Ammen und Pflegerinnen, und die Kaiserin selbst verabschiedet eine österreichische Dame nach der anderen aus ihrem Hofdienst, um sie durch Ungarinnen zu ersetzen. Auch der alte Obersthofmeister Königsegg-Bellegarde muss gehen, um dem Baron Franz Nopsca Platz zu machen, der fortan Elisabeths Hofhaltung leiten wird.
Nach Rudolfs Heirat ist Elisabeth nicht oft in Wien. Sie kümmert sich so wenig wie möglich um den jungen Hausstand, denn sie weiss aus Erfahrung, wie unwillkommen Schwiegermütter im allgemeinen sind. Jedes Jahr geht Elisabeth ein paar Monate nach England. Die übrige Zeit verbringt sie in Ischl, in München, in Meran, Gödöllö und manchmal, aber noch selten, an der französischen Riviera. In England wird ihre Reit- und Jagdleidenschaft immer grösser, obwohl sie ein paarmal sehr gefährliche Stürze erlebt und einmal sogar eine kleine Gehirnerschütterung davonträgt. Dann erwacht die alte Weltsehnsucht wieder in ihr, die Sehnsucht nach dem Süden, dem stillen Meer. Plötzlich denkt sie an Korfu. In dieser Zeit entsteht das berühmte Schloss, das sie auf der griechischen Insel errichten liess: das Achilleion. Es wird 1891 fertig.
Im Achilleion hofft sie, ihre Tage in seelenberuhigender Stille, unbehelligt von der Tortur lästiger Gemeinsamkeit zu verbringen. Doch ihr Geist strebt nach Vollendung. Wenn sie in Griechenland lebt, will sie auch die griechische Sprache beherrschen. Sie will die griechischen Klassiker lesen und verstehen und sich mit den Bewohnern des Landes unterhalten können. Wie sie Ungarisch gelernt hat, so lernt sie jetzt Griechisch. Schon ehe sie in Korfu baut, beschäftigen sie griechische Sprachstudien. Sie sucht sich Lehrer dazu aus. Der bemerkenswerteste unter ihnen ist ein armer verwachsener griechischer Student, ein Verwandter Baron Nopscas. Er heisst Constantin Christomanos. Auf ihren Spaziergängen muss er ihr die griechischen Dramen vorlesen. Sie hält lange Gespräche mit ihm über die Kunst und Literatur der Hellenen. Immer wird die Unterhaltung griechisch geführt.
Die Jahre vergehen. Elisabeths Menschenscheu und Einsamkeitsbedürfnis werden immer grösser. In Wien sieht man die Kaiserin nur noch selten. Das Jahr 1886 bringt ihr besonders grosse Aufregungen. Ihr Vetter, König Ludwig von Bayern, gibt seinen Aerzten ernstliche Veranlassung, ihn für unheilbar geisteskrank zu erklären. Am 13. Juni findet man den König mit seinem Arzt, Dr. Gudden, tot im Starnbergersee. Elisabeth ist von dieser Nachricht tief erschüttert. Von nun an wird sie den Gedanken nicht mehr los, auch sie könne einmal dem Wahnsinn verfallen, denn in vielen Veranlagungen fühlt sie sich dem Vetter verwandt und die Blutsverwandtschaft macht ihr Sorgen. «Der Gedanke an den Tod», meint sie, «reinigt die Seele wie der Gärtner das Beet, der das Unkraut jätet. Man muss mit ihm allein sein.»
Eine neue Katastrophe bereitet sich vor. Kronprinz Rudolf, der in seiner Ehe kein wahres Glück gefunden hat, gibt sowohl dem Kaiser als auch Elisabeth, die ihn immer besser verstanden hat, Anlass zur Besorgnis. Er ist inzwischen dreissig Jahre alt geworden, aber zerfallen mit sich und der Welt. An seinem Geburtstag schreibt er an einen Freund: «Dreissig Jahre ist ein grosser Abschnitt, kein eben zu erfreulicher; viel Zeit ist vorüber, mehr oder weniger nützlich zugebracht, doch leer an wahren Taten und Erfolgen. Wir leben in einer schleppenden versumpften Zeit ... Sollen die Hoffnungen in Erfüllung gehen und die Erwartungen, die Sie auf mich setzen, dann muss bald eine grosse, für uns glückliche, kriegerische Zeit kommen.» Rudolf beklagt sich ferner, dass ihn der Kaiser in den Dingen des Staates genau so wenig ernst nimmt wie einst seine Frau. Bis jetzt hat er auch tatsächlich noch nicht den geringsten Einblick in den Staat nehmen dürfen, den er einst regieren soll.
Allen am Wiener Hof ist es trotz grösster Geheimhaltung von seiten Rudolfs nicht entgangen, dass er für die bildschöne, erst sechzehnjährige Baronesse Mary Vetsera ein grosses Interesse gefasst hat. Das junge Mädchen, das von ihrer Mutter bei Hofe eingeführt wurde, ist ungemein reif, sehr klug und ausserordentlich temperamentvoll, sehr lebenslustig und heiter. Ihre Schönheit und Jugend zieht aller Blicke auf sich. Rudolf und Mary brauchen nicht lange, um sich zu verstehen. Sie liebt ihn vom ersten Augenblick an mit der ganzen Leidenschaft ihres jungen Herzens. Man flüstert am Hofe über dieses neue Verhältnis, das nicht platonisch sein soll, trotz der Jugend der Baronesse.
Es ist der 30. Januar 1889. Die Kaiserin hat die Absicht, am 31. mit Franz Joseph nach Budapest zu reisen. Ihr Sohn ist ein wenig unpässlich, d. h. er hat sich am Abend vorher entschuldigen lassen, nicht zu dem stattfindenden grossen Diner erscheinen zu können, da er sich nicht wohlfühle. Alle Vorbereitungen zur Abreise des Kaiserpaares sind bereits getroffen. Da trifft aus Mayerling unerwartet und in grösster Eile Graf Hoyos in der Hofburg ein. Er verlangt sofort den Generaladjutanten des Kaisers zu sprechen und teilt ihm in höchster Erregung mit, der Kronprinz sei tot und mit ihm die Baronesse Vetsera. Graf Paar kann zuerst kaum fassen, was geschehen ist. Wie soll er diese furchtbare Nachricht dem Kaiser überbringen? Es kommt ihm plötzlich der Gedanke: nur die Kaiserin vermag das. Wenige Minuten später weiss Elisabeth alles. Es ist wie ein Schlag, den man ihr versetzt. Sie empfindet ihn auch physisch, wie sie später sagt. Unter diesem Härtesten, was ihr das Schicksal antut, bricht sie zusammen. Aber sie muss sich fassen, der Kaiser ist bereits auf dem Wege zu ihr. Als er erfährt, was geschehen ist, bricht auch er in Tränen aus. Valerie und Stephanie werden geholt. Mit Elisabeths Fassung ist es zu Ende. Die Tochter und sie hängen schluchzend am Halse des Vaters, während Stephanie, die Gattin des Toten, in Tränen aufgelöst daneben steht. Sie hat ihn bis zuletzt geliebt, und nun ist er – wie sie glaubt – von der Hand eines jungen Mädchens, das ihn auch liebte, an Gift gestorben. In der Hofburg weiss man ja noch nicht alles, auch nichts über die Motive der Tat. Alle stehen vor einem unlösbaren Rätsel. In den Briefen, die Rudolf zum Abschied an die Kaiserin, an seine Schwester und an seine Frau schrieb – für den Kaiser ist keiner dabei – spricht er sich über den Grund seines Freitodes nicht aus. Nur eines ist sicher: er kann nicht mehr weiterleben. Seine Ehre gebietet ihm, zu sterben; er ist nicht wert, der Sohn Franz Josephs zu sein. Als der Kaiser nach dem Befund der Aerztekommission in Mayerling durch Dr. Widerhofer schliesslich erfährt, dass Rudolf sich und das Mädchen erschossen hat, da will er es nicht glauben. «Das ist unmöglich. Er hat sich nicht erschossen!» schreit er fast, und tränenüberströmt verbirgt er sein nun schon graues Haupt in den über dem Schreibtisch verschränkten Armen. Es ist herzzerbrechend, wie den Sechzigjährigen diese Nachricht erschüttert.
Ueber das Ereignis von Mayerling wird ein dichter Schleier gezogen. Er darf nicht gelüftet, nie darf der Name Rudolf genannt werden. Zwar gibt der Hof schliesslich vor der Oeffentlichkeit zu, dass der Kronprinz sich erschossen hat. Man sagt: in einem Anfall überreizter Nerven, einer Art Geistesverwirrung. Alle anderen Kommentare unterbleiben. Und erst der neueren Forschung ist es gelungen, einiges Licht in das Dunkel zu bringen. Für Elisabeth ist es indes keine Beruhigung gewesen, dass ihr Sohn aus pathologischen Gründen aus dem Leben geschieden sein soll. Sie erkennt nur den Fluch der Vererbung in einer solchen Annahme. Sie sieht das Unglück ihres Hauses fortschreiten und immer schlimmer werden. Um so mehr, als auch König Otto von Bayern in Wahnsinn verfallen ist. Ihr eigener leidender Zustand verschlimmert sich. In Ischl, Wiesbaden und Meran sieht man die bleiche, tiefschwarz gekleidete Frau Heilung suchen. Anfangs wird der Bevölkerung durch ein Dekret des Kaisers bedeutet, die Kaiserin in den Kurorten auf ihren Spaziergängen unbehelligt zu lassen. Das bestärkt das Publikum in dem Glauben, dass Elisabeth dem Wahnsinn verfallen sei. Doch dem ist nicht so. Wohl ist ihr Gemüt krank, doch ihr Geist ist so klar wie immer. Sie beschäftigt sich wieder mit ihren griechischen Studien, sie dichtet und schreibt viel, um zu vergessen. Aber es gelingt ihr nicht. Von Unruhe getrieben, strebt sie hinaus. Zunächst flüchtet sie nach Griechenland, dann nach Tunis, dann wieder ins Gebirge. Sie ist wie aufgepeitscht von dem Drang, nur nicht allein mit sich und ihren Gedanken zu sein.
Als die Kaiserin Ende des Jahres 1889 wieder nach Wien kommt, ist es ein trauriges Wiedersehen mit allem. Im nächsten Jahre verliert Elisabeth wieder zwei Menschen durch den Tod, die ihr lieb sind. Ihre Schwester Helene stirbt in Regensburg, und ihr Freund Andrassy, der zu Elisabeths grossem Bedauern schon im Jahre 1879 seine Amtsgeschäfte niedergelegt hatte, erliegt im gleichen Jahre qualvollen Leiden. Doch es ist, als walteten böse Mächte über der Gequälten. Das Mass des Traurigen, das sie erlitten, ist noch nicht erfüllt.
Am 5. Mai 1897 ereignet sich in Paris das damals die ganze Welt mit Entsetzen erfüllende grosse Brandunglück des Pariser Basars. Elisabeths Schwester Sophie, Prinzessin Ferdinand von Orléans, Herzogin von Alençon, ist eine der eifrigsten Komiteedamen, die sich in den Dienst der Wohltätigkeit gestellt haben. Es ist ein glänzendes, gesellschaftliches Ereignis, zu dem der höchste Adel, die Fürstlichkeiten und der Reichtum der Welt zusammenströmen. Mit einem Male steht das Zelt, in dem die Herzogin von Alençon sich mit über tausend Personen aufhält, in Flammen. Die Panik ist so gross unter den von Todesangst fast wahnsinnigen Menschen, dass sich nur wenige retten können. Unter den Haufen verkohlter Leichen sucht man vergebens nach Elisabeths Schwester. Der Herzog von Alençon sucht wie ein Irrsinniger fast die ganze Nacht in den Spitälern seine Frau. Dann unternimmt er es, mit dem Zahnarzt der Herzogin, unter den Leichen zu suchen. Mit Hilfe der Mundkarte entdeckt man endlich den furchtbar verstümmelten und verkohlten Leichnam. Als diese schauerlichen Einzelheiten nach Wien gelangen, fürchtet man, dass die Aufregung Elisabeths geschwächten Körper und die Nerven ganz zermalmen werden. Und es ist so. Sie geht sehr krank nach Kissingen.
Dann zieht es sie in die Schweiz, nach Caux, von wo aus sie sich vornimmt, die wunderbarsten Gebirgstouren und Ausflüge nach Bex, den Rochers de Naye, nach Evian, Thonon, nach Genf und zu den Rothschilds, die die herrlichsten Gewächshäuser der Welt besitzen, zu machen. Elisabeth fühlt sich wie neugeboren, als sie in Caux Ende 1898 anlangt. Gegen einen Aufenthalt in Genf bestehen zwar gewisse Bedenken. Es ist in diesen Jahren der Treffpunkt vieler Anarchisten und daher sehr gefährlich. Elisabeth aber wehrt ab. «Was kann mir denn in Genf passieren?» Als man in sie dringt, wenigstens eine männliche Begleitung mitzunehmen, willigte sie ein und sagte: «Nun gut, dann will ich Sekretär Kromar mitnehmen, obschon ich nicht weiss, was er mir nützen könnte, wenn er, während ich spazieren gehe, im Hotel ruht.» Sie nimmt darauf die Einladung der Baronin Rothschild nach Pregny an und lässt im Hotel Beau Rivage in Genf Zimmer für sich und drei Frauen und einen Lakaien bestellen. Die Jacht, die ihr Baronin Rothschild anbietet, schlägt Elisabeth aus, weil sie erfahren hat, dass die Schiffsmannschaft, wie alle Diener der Rothschilds, kein Trinkgeld annehmen darf. Es ist ihr unangenehm, Dienste der Leute in Anspruch zu nehmen und sich in keiner Weise erkenntlich zeigen zu können. Sie fährt also mit dem fahrplanmässigen Dampfer um 9 Uhr früh von Territet ab und trifft mittags in Genf ein. Es ist ein wundervoller Septembertag.
Die Vorgänge, die sich am nächsten Tag, dem 10. September 1898, in dem Genfer Hotel bis zum Betreten des Schiffs zur Rückreise nach Territet abspielen, lassen wir am besten von der einzigen Begleiterin Elisabeths, der Gräfin Irma Sztáray, erzählen:
«Mit dem Schlage 9 Uhr», schreibt diese in ihrem Tagebuch, «meldete ich mich bei der Kaiserin. Sie liess sich eben frisieren. Aus ihrer guten Laune und dem frischen Aussehen schloss ich, dass sie eine bessere Nacht gehabt hatte als ich. Nachdem sie mir noch einige kleine Aufträge für die Stadt gegeben hatte, fragte ich, ob es dabei bliebe, dass wir mit dem Schiff nach Territet zurückkehren würden.
«Jawohl, um 1 Uhr 40 Minuten fahren wir. Das Personal kann mit dem 12-Uhr-Zug reisen, denn ich liebe die grossen Aufzüge nicht ...»
Es war genau 1 Uhr 35 Minuten, als wir zum Tor (des Hotels) hinaustraten ... Wir schritten das Seeufer entlang. Wir gingen eben an dem Braunschweiger-Denkmal vorbei, als die Kaiserin, heiter wie ein sorgloses Kind, auf zwei Bäume hinwies: «Sehen Sie, Irma, die Kastanien blühen. Auch in Schönbrunn gibt es solche zweimal blühende, und der Kaiser schreibt, dass auch sie in voller Blüte sind.»
«Majestät, das Schiffssignal», sagte ich und zählte unwillkürlich die auf das Läuten folgenden dumpfen Schläge ... eins ... zwei.
In diesem Moment erblicke ich in ziemlicher Entfernung einen Menschen, der, wie von jemand gejagt, hinter einem Baume am Wegrande hervorspringt und zum nächststehenden anderen läuft, von da zu dem eisernen Geländer am See hinübersetzt, sodann abermals zu einem Baum und so, kreuz und quer über das Trottoir huschend, sich uns naht. «Dass der uns noch aufhalten muss», denke ich, ihm mit den Blicken folgend, als er aufs neue das Geländer erreicht, und, von da wegspringend, schräg auf uns losstürmt.
Unwillkürlich tat ich einen Schritt vorwärts, wodurch ich die Kaiserin vor ihm deckte, allein der Mann stellt sich nun wie einer, der arg strauchelt, dringt vor und fährt im selben Augenblick mit der Faust gegen die Kaiserin.
Als ob der Blitz sie getroffen hätte, sank die Kaiserin lautlos zurück, und ich, meiner Sinne nicht mächtig, beugte mich mit einem einzigen verzweiflungsvollen Aufschrei über sie ... Und dann war mir, als tue sich der Himmel vor mir auf. Die Kaiserin sah um sich. Ihre Blicke verrieten, dass sie bei vollem Bewusstsein war, dann erhob sie sich, von mir gestützt, langsam vom Boden. Ein Kutscher half mir ... Wie ein Wunder erschien es mir, als sie jetzt, gerade aufgerichtet, vor mir stand. Ihre Augen glänzten, ihr Gesicht war gerötet, ihre herrlichen Haarflechten hingen, vom Falle gelockert, wie ein langer Kranz um ihr Haupt ... Mit erstickter Stimme, da die Freude den Schrecken überwand, fragte ich sie: «Wie fühlen Sie sich, Majestät? Ist Ihnen nichts geschehen?»
«Nein», antwortete sie lächelnd, «es ist mir nichts geschehen!»
Dass in jener gottverfluchten Hand sich ein Dolch befunden, ahnten in diesem Augenblick weder sie noch ich.
Inzwischen waren von allen Seiten Leute herbeigeströmt, die sich über den brutalen Angriff entsetzten und mit Teilnahme die Kaiserin fragten, ob sie keinen Schaden genommen. Und sie, mit der herzlichsten Freundlichkeit, dankte jedem für die Teilnahme, bestätigte, dass ihr nichts fehle, und gestattete, dass der Kutscher ihr bestaubtes Seidenkleid abbürstete.
Währenddessen war auch der Portier des Beau Rivage zur Stelle gelangt, er hatte vom Tore aus die schreckliche Szene mit angesehen und bat dringendst, ins Hotel zurückzukehren.
«Warum?» fragte die Kaiserin, während sie ihr Haar in Ordnung zu bringen versuchte, «es ist mir ja nichts geschehen, eilen wir lieber aufs Schiff.»
Sie setzte unterdessen den Hut auf, nahm Fächer und Schirm, grüsste freundlich das Publikum, und wir gingen.
«Sagen Sie, was wollte denn eigentlich dieser Mensch?» fragte sie unterwegs.
«Welcher Mensch, Majestät? Der Portier?»
«Nein, jener andere, jener furchtbare Mensch?»
«Ich weiss es nicht, Majestät. Aber er ist gewiss ein verworfener Bösewicht.»
«Vielleicht wollte er mir meine Uhr wegnehmen», sagte sie nach einer Weile.
Wir gelangten an den Hafen. Auf der Schiffsbrücke ging sie noch leichten Schrittes vor mir her, doch kaum hatte sie das Schiff betreten, als ihr plötzlich schwindelte. «Jetzt Ihren Arm», stammelte sie plötzlich mit erstickender Stimme. Ich umfing sie, konnte sie aber nicht halten und, ihren Kopf an meine Brust pressend, sank ich ins Knie. «Einen Arzt, einen Arzt!» schrie ich dem zu Hilfe eilenden Lakai entgegen.
Die Kaiserin lag totenbleich mit geschlossenen Augen in meinen Armen ... Als ich ihr Antlitz und Schläfe besprengte, öffneten sich ihre Augenlider, und mit Entsetzen erblickte ich hinter ihnen den Tod. Ich habe ihn öfters gesehen, und jetzt erkannte ich ihn in den verglasten Augen. Ich dachte an Herzschlag. Ein Herr machte mich darauf aufmerksam, dass wir uns in der Nähe der Maschine befänden und es besser wäre, die Dame aufs Verdeck zu bringen, wo sie rascher zu sich kommen würde. Mit Hilfe zweier Herren trugen wir sie also aufs Verdeck und legten sie auf eine Bank ... Ein Herr trat herzu und bot mir die Hilfe seiner Gattin an, die halb und halb Aerztin sei und sich auf Krankenpflege verstehe.
Madame Dardelle liess Wasser und Eau de Cologne bringen und machte sich sogleich an die Wiederbelebung der Kaiserin. Sie ordnete an. Ich schnitt ihre Miederschnüre auf, während eine barmherzige Schwester ihre Stirn mit Eau de Cologne rieb.
Inzwischen war das Schiff abgefahren, aber trotz seiner Bewegung nahm ich wahr, wie die Kaiserin bemüht war, sich zu erheben, damit ich das Mieder unter ihr hervorziehen könnte. Dann schob ich ein in Aether getauchtes Stückchen Zucker zwischen ihre Zähne, und ein Hoffnungsstrahl durchzuckte mich, als ich hörte, dass sie ein- oder zweimal darauf biss.
Auf dem in Bewegung befindlichen Schiffe wehte kühle Seeluft. Die Kaiserin öffnete langsam ihre Augen und lag einige Minuten mit umherirrenden Blicken da, als wollte sie sich orientieren, wo sie sei und was mit ihr geschehen war. Dann erhob sie sich langsam und setzte sich auf. Wir halfen ihr dabei, und sie hauchte, gegen die fremde Dame gewendet: «Merci.»
Obgleich die Kaiserin sich aus eigener Kraft sitzend erhielt, sah sie doch sehr gebrochen aus. Ihre Augen waren verschleiert und unsicher, schwankend strich ihr unsicherer Blick umher. Die Passagiere des Schiffes, die uns bisher umstanden hatten, zogen sich zurück, und nur wir blieben um die Kaiserin: Madame Dardelle, die Klosterfrau und der Lakai, dem ich meine Aufträge ungarisch erteilen konnte.
«Was ist denn jetzt mit mir geschehen?» Das waren ihre letzten Worte, dann sank sie bewusstlos zurück.
Ich wusste, dass sie dem Tode nahe war. Madame Dardelle labte sie mit Aether. Die Kaiserin trug ein kleines schwarzes Seidenfigaro, das ich, um ihr auch diese Erleichterung zu verschaffen, über der Brust öffnen wollte. Als ich die Bänder auseinanderriss, bemerkte ich auf dem darunter befindlichen Batisthemd, in der Nähe des Herzens, einen dunklen Fleck in der Grösse eines Silberguldens. Was war das? Im nächsten Augenblick stand die lähmende Wahrheit vor mir. Das Hemd beiseite schiebend, entdeckte ich in der Herzgegend eine kleine dreieckige Wunde, an der ein Tropfen gestockten Blutes klebte. – Luccheni hatte die Kaiserin erdolcht!»
Gräfin Sztáray eilte sofort, angesichts dieser furchtbaren Wirklichkeit, zu dem Kapitän des Schiffes und bat ihn, sofort umzukehren, denn die Dame, die da liege, sei die tödlich verwundete Kaiserin Elisabeth. Stumm gehorchte er und liess das Schiff beikehren, das nun wieder in dem Hafen von Genf landete. Es wird in Eile eine improvisierte Tragbahre gemacht und die sterbende Kaiserin daraufgelegt. Ihr grosser schwarzer Mantel deckt die schmale Gestalt mit dem totenbleichen Gesicht. Ein fremder Herr hält den weissen Schirm Elisabeths sorgsam über sie offen. So kommt dieser traurige Zug mit der Kaiserin ins Hotel zurück, das sie vor kaum einer Stunde ganz froh verlassen hat.
Die Gräfin erzählt weiter: «In ihr Zimmer gelangt, legten wir sie auf ihr Bett. Doktor Golay (ein Genfer Arzt) war schon zur Stelle, bald darauf kam der zweite Arzt. Ich zeigte Doktor Golay die Wunde. Er konnte mit seiner Sonde nicht mehr eindringen, weil die Wundöffnung nach der Entfernung des Mieders sich verschoben hatte. «Es ist gar keine Hoffnung», sprach der Arzt nach einer Weile. «Gar keine Hoffnung!» Sie lebte noch, doch atmete sie kaum mehr.
Jetzt kam der Priester und gab ihr die Generalabsolution. War da noch Leben in ihr? ... Um 2 Uhr 40 Minuten sprach der Arzt das furchtbare Wort aus. Die edelste Seele, die am schwersten geprüfte von allen, hatte die Erde verlassen, und ihr Entschwinden bezeichnete man mit dem einzigen kurzen Wort: tot.»
Im Hotel Beau Rivage wird die Kaiserin, so feierlich es geht, aufgebahrt. Es kommen die Klosterfrauen und die katholische Geistlichkeit, geführt vom Bischof von Fribourg, um an der Leiche zu beten. Gräfin Sztáray, General von Berzeviczy, der sofort aus Caux herbeigeeilt ist, und der österreichische Gesandte in Bern, Graf Kuefstein, halten die Totenwacht. Man hat das Inkognito bis zuletzt gewahrt. Elisabeth wird im Hotel auch im Tode nicht als Kaiserin gehuldigt.
Und doch ist am nächsten Tag der Leichenzug ein überaus feierlicher, der die sterbliche Hülle Elisabeths zum Bahnhof führt. Es ist für die ganze Stadt ein Tag der Trauer. Die Glocken der Genfer Kathedrale läuten und bringen Elisabeth den letzten Gruss, ehe ihr Sarg die Stadt verlässt, die sie so sehr geliebt und die ihr doch zum Verhängnis wurde. Die Trauerkundgebung der Schweiz ist ergreifend und würdevoll. Mit gesenkten Waffen ziehen die Schweizer Soldaten, die Polizeigarde in ihren charakteristischen Uniformen, die Mitglieder der Stadtbehörden, die Abgesandten der Kantone, die Gesandten vieler Länder und der endlose Zug trauernder Bürger am Hotel Beau Rivage vorüber und geben dem von sechs Pferden gezogenen Trauerwagen, in dem der Sarg ruht, das letzte Geleit. Zwei Tage später hält die tote Kaiserin ihren Einzug in Wien.
Als Graf Paar dem Kaiser die furchtbare Nachricht, zuerst von einer Verletzung, bald darauf vom Tode Elisabeths überbrachte, da ist Franz Joseph so erschüttert gewesen, dass er sich am Schreibtisch festhalten musste, um nicht umzusinken. Dann lässt er sich schluchzend in seinen Sessel fallen und, den Kopf auf den Schreibtisch gelegt, weint der Kaiser lange fassungslos. Nun empfängt er am 15. September mit Aufbietung aller seiner Kräfte seine tote Gattin in der Hofburgkapelle. Als der Sarg zum Altar hinaufgetragen wird, geht er ihm entgegen und faltet im stillen Gebet seine Hände. Und als der Geistliche den Namen Elisabeths nennt, da bricht Franz Joseph tränenüberströmt am Sarge zusammen.
Die Beisetzung der Kaiserin in der Kapuzinergruft ist die imposanteste Trauerkundgebung, die Wien je gesehen. Achtzig Bischöfe stehen vor dem Altar, und die Kirche kann die Menschenmenge, die gekommen ist, um Elisabeth die letzte Ehre zu erweisen, kaum fassen. Noch ein letztes Mal kniet Franz Joseph am Sarge der Toten nieder. Er hat Abschied von ihr genommen, für immer.