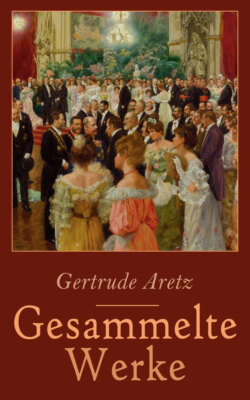Читать книгу Gesammelte Werke - Gertrude Aretz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Intrigen
ОглавлениеAllmählich wird Liselotte sehender. Ihre offene, ehrliche Natur und die nicht immer gewählten Ausdrücke beginnen bereits Missfallen in der Hofgesellschaft zu erregen. Unter dem Glanze und dem Reichtum an Ludwigs Hofe sieht sie viel Schmutz und Widriges, vorläufig nur äusserlich, aber sie hält mit ihrer Kritik nicht zurück. Paris besonders missfällt ihr, weil es schmutzig und unordentlich ist. In den Schlössern des Königs widert sie die Ungeniertheit an, mit der sich die Herren auf den Gängen und Treppen des Louvre und des Palais-Royal benehmen. Liselotte schildert diese Zustände in ihrer realistischen Weise, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt.
Oft bedient sich Liselotte so kraftvoller Ausdrücke, dass sogar der gütige König, der gern aus ihrem Munde einen derben Scherz entgegennimmt, betroffen ist und es sie fühlen lässt, wie wenig hoffähig sie sich benommen habe; denn Ludwig XIV. hält streng auf Formen. Aber auch er, der Sonnenkönig, vermag unserer Liselotte in dieser Beziehung nicht zu imponieren und sie nicht zu «polieren», wie sie selbst zugesteht. Oft lässt sie sich in ihren Reden sogar in den Gemächern des Königs so gehen, dass der fromme Dauphin bei seinem Vater Beschwerde einreicht, die Herzogin von Orléans bediene sich mit Vorliebe in ihren Unterhaltungen unanständiger Ausdrücke, wie sie nur das gemeine Volk auf der Strasse gebrauche. Dafür wird ihr offiziell vom König bisweilen ein «derber Filz» erteilt. Er schickt dann ihren Beichtvater zu ihr und lässt der massiven Liselotte ins Gewissen reden. Dann bewahrt sie wohl einige Tage Stillschweigen oder hält ihre lockere Zunge etwas mehr im Zaume, aber es dauert nicht lange und sie ergeht sich von neuem in so kräftigen Ausdrücken, die selbst im Heidelberger Schloss bei Karl Ludwig nicht hoffähig gewesen wären.
Das galante Treiben am Hofe berührt sie zu dieser Zeit eigentlich wenig. Sowohl einer La Vallière als einer Montespan und allen kleineren Mätressen lässt sie die Herrschaft, eben als unvermeidliche Beigabe eines grossen Hofes, der von einem sinnlichen und prachtliebenden König geleitet wird. Ihrer Meinung nach haben Fürsten das Recht, sich Mätressen zu halten. Merkwürdigerweise kommt auch eigentlich nie ein direktes Bedauern mit der Königin über ihre Lippen. Halb vergessen fristet diese stille Frau in ihren Gemächern von Versailles ihr Dasein, um das sie keine Bürgersfrau beneidet. Aber Liselotte sieht in all diesem nur Selbstverständliches, solange ihr eigenes Blut nicht mit dem «Mausdreck» vermischt zu werden droht. Denn auf das Ansehen ihrer Abkunft und ihrer Würde hält sie streng.
Vom französischen Adel hält sie nicht viel, weil alle die Herzöge, Fürsten, Grafen und Barone erst vom König dazu gemacht werden, während bei ihr, in ihrer Heimat, die Herzöge «von Gottes Gnaden» seien und sie ihren Adel ihrem Vater und ihrer Mutter verdanken! Insofern wären die französischen Herzöge nicht mit den deutschen zu vergleichen, meint sie. Ueberaus stolz aber ist sie auf ihres Vaters Pfalzgrafentum. «So ein lumpener Duc will einem Pfalzgrafen den Rang streitig machen?», ruft sie einmal im Innersten empört aus. «Wirkliche Grösse haben nur die deutschen Fürsten; denn sie haben keine Bürger zu Verwandten und dienen nicht.»
So nahm sie also auch an den französischen Hof ihren deutschen Adelsstolz mit und hat es sich nicht einfallen lassen, zu denken, dass sie etwa aus geringerem Geschlechte gewesen wäre wie die Bourbon und Orléans. So wie sie selbst ist, erzieht sie auch ihre Kinder. Die erste Gattin «Monsieurs», Henriette von Orléans, hat zwei Töchter hinterlassen, denen Liselotte eine zweite Mutter sein muss. Die älteste, Marie-Louise, ist neun Jahre alt, die zweite, Anna-Maria, ein Baby von zwei Jahren. Für beide sorgt die junge Liselotte mit Liebe, als wären es ihre eigenen Kinder.
Im Jahre 1673 wird sie selbst Mutter. Es ist ein Knabe, Alexander Ludwig, der jedoch, kaum dreijährig, wieder stirbt. Da sie nicht das geringste Vertrauen zu der französischen medizinischen Wissenschaft hat, ist sie natürlich fest überzeugt, ihr Söhnchen sei das Opfer unwissender Pariser Aerzte geworden, die ebensowenig verständen, wie die Erzieher und Gouvernanten der Franzosen. Als dieses Kind stirbt, ist sie untröstlich. Sie meint, vor Traurigkeit selbst sterben zu müssen. Glücklicherweise hat sie noch einen Sohn, den kleinen Herzog von Chartres. Er kam am 4. August 1674 in Saint-Cloud zur Welt und wurde der spätere, allzu berühmte und berüchtigte «Regent» von Frankreich.
Zwei Jahre später kann Liselotte ihren alten Freunden und der Tante Sophie noch die Geburt eines Töchterchens melden, dem sie ihren eigenen Namen Elisabeth Charlotte gibt. Zwar erfüllt sie gerade die Ankunft dieses Kindes mit grosser Freude, aber das Kinderkriegen im allgemeinen ist eigentlich nicht nach ihrem Geschmack. Es kommt ihr, dem «rauschenplattenen Knecht», sehr «spanisch» vor, dass sie während der Zeit ihrer Schwangerschaft nicht laufen und springen kann, wie sie es gewohnt ist. Nicht einmal in «der Kutschen» darf sie fahren, sondern muss immer in einer Chaise getragen werden. Das gefällt Liselotte durchaus nicht, die gern zwei Stunden am Tage marschiert. «Ja, wenn es wenigstens bald getan wäre», meint sie, «so wäre es noch eine Sach'; aber dass es so neun Monate fortwähren muss, das ist ein trübseliger Zustand.» Und so ist sie recht froh, dass nach diesem dritten Kinde keines mehr kommen wird; denn «Monsieur» hat gleich nach dieser Geburt getrennte Schlafzimmer angeordnet.
Und doch ist sie damals, als sie ihre Tochter gebar, durchaus nicht unglücklich mit dem Herzog gewesen. Denn sie meldet der Frau von Harling die Geburt des Kindes mit den Worten: «Nun ist eine Liselotte mehr auf der Welt. Gott gäbe, dass sie nicht unglücklicher als ich sein möge, so wird sie sich wenig zu beklagen haben.»
Trotz aller Gegensätze, die Liselotte von ihrem Manne trennen, entdeckt sie doch auch an ihm gute Seiten. Er «ist der beste Mensch», aber leider geht er in der wüsten Gesellschaft seiner Günstlinge unter, die nichts als Gelage und hohes Spiel kennen. Liselotte weiss es und möchte wenigstens ihre beiden Kinder vor diesem verderblichen Einfluss bewahren. Dieser Kampf ist der schwerste in ihrem Leben. Aber er soll erst beginnen. Vorläufig sind die Kinder noch klein und noch nicht in den Händen der Erzieher, die der Herzog von Orléans aus der Mitte seiner Günstlinge wählt.
Eine eitle Mutter ist Liselotte überdies nicht. Von dem kleinen Prinzesschen schreibt sie an Sophie: «Sie hat eine hübsche Haut, aber alle Traits sein hässlich, eine hässliche Nas, ein gross Maul, die Augen gezogen und ein platt Gesicht ...» Und als die kleine Liselotte älter wird, erkennt sie in ihr sich selbst wieder. «Ist wohl eine dolle Hummel als ich vor diesem war ... Ich darf mich nicht so sehr mit ihr familiarisieren; denn sie fürcht keinen Seelenmenschen auf der Welt als mich, und ohne mich kann man nicht mit ihr zurecht kommen. Sie fragt gar nichts nach Monsieur. Wenn er sie ausfilzen will und ich nicht dabei bin, lacht sie ihm ins Gesicht ...» Am stolzesten aber ist die Mutter, dass auch diese zweite Liselotte «das Maul auf dem rechten Fleck» hat und jederzeit Rede und Antwort stehen kann.
Ueber ihren Sohn spricht Liselotte mit der grössten Offenheit und Ehrlichkeit. Leider geriet er in der Folge nicht nach ihrem Geschmack. Sie hatte geglaubt, dass er bei all seinen herrlichen Anlagen und Talenten nicht so sehr dem verdorbenen Leben des Versailler Hofes verfallen werde, wie es später tatsächlich geschah. Trotz allem lässt sie ihm in jeder Beziehung Gerechtigkeit widerfahren und erkennt vor allem seinen guten Charakter und die ausserordentlichen Fähigkeiten an, mit denen er in der Tat begabt ist. Aeusserlich gefällt ihr der kleine Herzog von Chartres, der, wie sein Vater, Philipp getauft wurde, besser als die Tochter, aber sie findet, dass er weder dem Vater noch der Mutter ähnlich sieht. Auch bei ihm schätzt sie besonders die Schlagfertigkeit und Geschicklichkeit in der Rede, und sein grosser Eifer, alles zu lernen und zu wissen, gefällt ihr. Beide Kinder liebt Liselotte zärtlich. Sie beschäftigt sich mit ihnen wie eine bürgerliche Mutter. Sie schont auch die Rute nicht; denn ihr Grundsatz ist jederzeit: Liebe gepaart mit Strenge! «Als mein Sohn klein war», schreibt sie noch im Jahre 1710 an die Raugräfin Luise, «habe ich ihn niemals gemaulschellt, aber ich habe ihn so derb mit der Rute geschlagen, dass er sich noch heute daran erinnert. Die Maulschellen sind gefährlich, sie können Verwirrungen im Kopfe hervorrufen ...»
Sowohl der Sohn als die Tochter fürchteten die strenge Hand der Mutter. Liselotte fackelte nicht lange. Wenn sich die Kinder nicht fügen wollten, gab es, wie im kleinsten Bürgerhaus, Schläge. Aber sie verstand es ebensogut, sich ihre Zuneigung zu erwerben; denn beide blieben ihr stets in grosser Liebe zugetan.
Heftig ist der Kampf um die Erziehung dieser Kinder, und es ist ein schönes Kapitel in dem Leben der Herzogin von Orléans, mit welcher Energie und Ausdauer sie diesen Kampf durchführte, um aus ihnen rechte und brauchbare Menschen zu machen. Wie eine Löwin ihre Jungen verteidigt sie sie gegen den verderblichen Einfluss der Günstlinge Monsieurs. Weder Drohungen noch Anklagen beim König vermögen sie davon abzuhalten, sich die Rechte der Mutter zu wahren. Besonders haben es die Günstlinge auf den Sohn abgesehen. Man versucht es auf die denkbar verworfenste Weise, ihn ins Lager seines Vaters zu ziehen. Der Herzog von Orléans ist selbst am meisten darauf bedacht, seinen Sohn so früh wie möglich in die Neigungen einzuweihen, denen er selbst frönt. Und da hat Liselotte harte Kämpfe zu bestehen, besonders im Jahre 1689, als der Erzieher des jungen Prinzen, der Marquis de Sillery, seinen Abschied nimmt. Monsieur will ihn sofort durch eine seiner Kreaturen ersetzt wissen. Da aber stellt sich die Mutter energisch entgegen. Ihren Sohn diesem ausschweifenden, aller Moral entbehrenden Manne übergeben, hiesse ihn dem Verderben weihen! Hier zeigt Liselotte ihren harten Willen. Es hilft Monsieur nichts, zu toben und zu drohen; sie gibt nicht nach. Und so verfliessen sechs Monate im heftigsten Widerstreit der Meinungen, bis die besorgte Mutter ihre Zuflucht zum König selbst nimmt. Sie weiss, dass Ludwig, wenn er erst ihre Bedenken hört und prüft, ihr auch in dieser Beziehung beistehen wird. Und in der Tat: er verspricht seiner Schwägerin, selbst die Wahl eines Erziehers für seinen Neffen treffen zu wollen. Wenige Tage später erhält der junge Herzog von Chartres den Marquis d'Arcy als Gouverneur, einen Mann voll Ernst und Würde und fleckenlosem Rufe. Liselotte kann nun ruhig sein: Die Erziehung ihres Sohnes liegt in guten Händen.
Um so unverständlicher ist es, dass sie bei der Wahl des zweiten Lehrers nicht hellblickender war und vollkommen mit den Ansichten der beiden Günstlinge ihres Mannes übereinstimmte. Denn sie lässt es geschehen, dass der Abbé Dubois, der allerdings zu jener Zeit noch eine recht unbedeutende Persönlichkeit ist, die Unterrichtsstunden ihres Sohnes leitet.
So grossen Einfluss die Günstlinge auf Monsieur haben, so wenig lässt er sich von seiner Frau beraten. Liselotte versagt man jeden Einfluss, selbst in der eigenen Familie. Aber trotz allem gelingt es ihr, sich wenigstens die Liebe ihrer Kinder zu erhalten. Ihr Sohn bewies ihr stets die grösste Achtung und Ehrerbietung, und es gelang weder herrschsüchtigen Frauen, die ihn später in grosser Anzahl umgaben, noch intriganten Männern, ihn mit seiner Mutter zu entzweien.
Man sieht gar bald ein, dass es vergebene Liebesmühe sei, Mutter und Kinder auseinanderzubringen, und so versucht man es mit den beiden Gatten, deren Band nicht so fest geknüpft ist. Zu diesem Zwecke muss der Herzog von Orléans überzeugt werden, dass seine Frau ihn hintergeht! Aber es ist schwer, gegen die gar nicht kokette Liselotte irgend etwas in dieser Hinsicht vorzubringen. Man kann ihr nicht die kleinste Heimlichkeit, nicht den leisesten Augenaufschlag gegen einen Mann vorwerfen. Schliesslich gelingt es aber doch der würdigen Clique des Chevaliers de Lorraine, des Marquis d'Effiat und der Madame de Grancey, die Herzogin von Orléans in den Augen Monsieurs als leichtsinnige Frau zu verdächtigen. Diese Anklage ist jedoch so absurd, dass kein Mensch und am allerwenigsten Monsieur daran glaubt. Niemand hält die derbe, wahrheitsliebende, grundehrliche und etwas massive Liselotte einer Untreue für fähig. Man war ihr entweder sehr zugetan, wegen ihrer grossen Herzensgüte und ihres unverwüstlichen Humors, oder man fürchtete sie wegen der unumwundenen Wahrheiten, die sie in Versailles oder Saint-Germain jedem sagte, an dem sie etwas auszusetzen hatte. Aber einer Niederträchtigkeit oder Schlechtigkeit hielt man sie für unfähig. Ausserdem war sie nicht der Typ der leichtsinnigen Frau. Ludwig XIV. war von Liselottes Unschuld vollkommen überzeugt. Zu jener Zeit sah er nur die anziehenden Eigenschaften seiner jungen Schwägerin. Er, als guter Frauenkenner, wusste am besten, dass ein solches Gerücht vollkommen aus der Luft gegriffen war. Frauen wie Liselotte eigneten sich nicht zur Geliebten. Sie konnte nur Frau und Mutter sein. Jeden Tag bewies ihr der König mehr seine Achtung, gleichsam, als wollte er damit der Welt zeigen, wie unantastbar sie in jeder Beziehung sei. Nie ging er vorüber, ohne das Wort an sie zu richten, und jeden Sonnabend liess er sie rufen, damit sie an dem berühmten Mitternachtsmahl der Madame de Montespan teilnähme. Das war eine Auszeichnung, die nur wenigen zuteil wurde, und Liselotte wusste sie zu schätzen. Vor ihr verschwand der Monarch, und nur der ritterliche Mann trat in Erscheinung. Es schmeichelte sie, wenn es hiess: «Der König begibt sich nach Fontainebleau, weil Madame es wünscht.» Und dieses «Madame wünscht es», erstaunt bald niemand mehr. Man findet die Herzogin charmant, trotz ihrer ungeheuren Perücke, die ihr meist schief auf dem Kopfe sitzt, trotz ihres von der Jagd und von Spazierritten dunkelgebräunten Gesichts und trotz ihrer beinahe männlichen Kleidung.
Der Herzog von Orléans liess sich gleichfalls durch die Verleumdungen, die man über seine Frau ausstreute, nicht beeinflussen. Er fuhr fort, sich als angenehmer Lebensgefährte zu erweisen, soweit es sich eben nicht um die Erziehung der Kinder handelte. Im Juli 1678, nach siebenjähriger Ehe noch, schreibt Liselotte an die Tante Sophie: «Was Euer Liebden Idee anlangt, dass, wenn ich Monsieur habe, ich nichts weiter auf Erden verlange, so ist es wahr, dass ich sehr gern mit ihm bin.» – Sie langweilt sich ohne ihn und weiss nichts anzufangen, besonders wenn auch noch der König abwesend ist. «Die Zeit wird mir so lang», seufzt sie und ist über die Massen vergnügt, wenn beide wieder da sind.
Diese Aussprüche zeugen allerdings nicht davon, dass die Herzogin von Orléans eine unglückliche Frau an der Seite eines Mannes war, der so wenig wie Philipp geeignet schien, eine Frau glücklich zu machen. Aber für Liselotte hat er eben doch manche Eigenschaften, die ihr angenehm sind und ganz ihrem Sinn entsprechen. Jeder anderen Frau wären gerade die weiblichen Neigungen an dem Herzog unangenehm gewesen; Liselotte findet hingegen in ihrem Gatten Talente ergänzt, die sie nicht im geringsten besitzt. So liebt sie es gar nicht, sich mit ihren Kleidern zu beschäftigen. Es ist für sie geradezu eine Qual, stundenlang mit den Schneiderinnen und Modistinnen beschäftigt zu sein und vor dem Spiegel Hüte und Kleider zu probieren. Monsieur hingegen bereiten diese Dinge um so mehr Vergnügen. Er kann sich ganze Tage lang mit der Wahl eines Kleides, eines Schmuckes, eines Bandes beschäftigen und behandelt die Modefragen als die wichtigsten seines Lebens, eingehender wie Staatsangelegenheiten. Da Liselotte nichts von all dem versteht und auch nichts verstehen will, sucht Monsieur ihre Kleider aus.
Auch als Krankenpfleger ist Philipp unermüdlich. Das hat er ihr bereits im Jahre 1672 bei einem vorübergehenden Unwohlsein bewiesen. Als aber die Herzogin im Jahre 1675 ernstlich an einem heftigen Fieber erkrankte und wirklich zwischen Leben und Tod schwebte, da zeigte sich Monsieur über alle Begriffe besorgt. Er wich nicht von ihrer Seite, reichte ihr selbst die vorgeschriebene Medizin, rückte ihr die Kissen zurecht und wachte über ihren Fieberschlaf. Die Kurfürstin von Hannover liess sich täglich aus Paris über den Zustand ihrer geliebten Nichte berichten, und Monsieur entledigte sich auch dieser Aufgabe aufs genaueste.
Die Zeit rückte indes näher, da aus der fröhlichen Pfälzer Liselotte eine misstrauische, verbitterte, traurige und einsame Frau wurde. Es waren jedoch nicht nur die Intrigen und Kabalen der Umgebung ihres Mannes, die dazu beitrugen, ihr das Leben unerträglich und unerfreulich zu machen. In ihrem Innern gab es schwere Konflikte zwischen der wahrhaft verehrenden Freundschaft, die sie dem König entgegenbrachte, und der kindlichen Anhänglichkeit an ihren geliebten Vater und an die Pfalz. Obwohl Liselotte weit entfernt war, sich jemals in Politik zu mischen, so sah sie doch mit Schmerzen, wie wenig ihre Heirat, die doch nur aus Staatsgründen geschlossen worden war, dazu beigetragen hatte, das Schicksal ihres Landes und des Kurfürsten, ihres Vaters, zu verbessern. Es geschah nichts, aber auch gar nichts, was diese Hoffnungen nur im geringsten bestätigt hätte. Am meisten betrübte es Liselotte, dass ihr Vater glaubte, es läge allein an ihr, und sie wolle sich in dieser Hinsicht keinerlei Einfluss auf den König verschaffen. Die Herzogin von Orléans war aber weder dazu geschaffen, eine politische Rolle zu spielen, noch hätte Ludwig XIV. sich von ihr beeinflussen lassen, trotz aller seiner Freundschaft. Es ist bekannt, wie rücksichtslos der französische König in politischen Dingen vorging. Und verwandtschaftliche Rücksichten und Privilegien kannte er erst recht nicht. Der Kurfürst von der Pfalz wurde, obwohl er der Schwiegervater Monsieurs war, doch nicht anders in den Räten von Saint-Germain behandelt, als ein anderer beliebiger deutscher Fürst, und der Frieden von Nimwegen im Jahre 1678/1679 hatte geradezu traurige Folgen für die deutschen Grenzländer, die Pfalz nicht ausgeschlossen. Karl Ludwig wurde das beklagenswerte Opfer der «Chambres de Réunion» (Metzer Reunionskammern) des französischen Königs. Ludwig XIV. bemächtigte sich seiner Staaten, die ehemals als «Dependenzen» des Bistums Metz figuriert hatten, ohne irgendwelche Bedenken. Französische Truppen besetzten die Pfalz, die zerstückelt und zerrissen wurde wie ein Stück Papier. Die französischen Agenten befreiten ohne Recht die Pfälzer von dem Eide, den sie ihrem Landesherrn geleistet hatten, und liessen sie einen neuen auf den fremden Gebieter schwören. Es wurden hohe Kontributionen auferlegt, die das an sich nicht reiche Volk bezahlen musste. Zwei der Kommissare Ludwigs XIV. liessen sich im Schloss Heidelberg nieder und benahmen sich dort als unerträgliche Gäste. Sie betranken sich mit dem Weine des Kurfürsten und wurden schliesslich so unverschämt, dass Karl Ludwig, den Schicksalsschläge, Alter und der Tod der Raugräfin griesgrämig und verbittert gemacht hatte, froh war, wenn er infolge seiner angegriffenen Gesundheit einen Vorwand fand, einmal allein in seinem Zimmer zu speisen. Er und seine Schwester, die Kurfürstin von Hannover, waren ausser sich, dass Liselotte in Paris beim König gar nichts vermochte, das Schicksal des Kurfürsten zu erleichtern.
Liselotte hatte indes doch ihr möglichstes getan, um ihrem Vater ein besseres Los zu verschaffen. Immerhin war es herzlich wenig, was sie beim König erreichte. Und dieses Wenige wurde meist am nächsten Tage durch eine neue freche Forderung aufgehoben. Karl Ludwig war ohnmächtig, sich zu widersetzen. Er vermochte weiter nichts zu tun, als die bittersten Klageschriften zu schreiben. Allmählich zog Reue in sein Herz ein, dass er Liselotte zum Opfer gebracht hatte, ohne dass diese Heirat ihm Nutzen und Vorteile bot. Kummer und Sorge darüber füllten sein Leben aus. Am 26. August 1680 trafen ihn drei Schlaganfälle, die ihn für kurze Zeit der Sprache beraubten. Einige Tage später starb er.
Liselottes Schmerz über diesen Verlust war gross und echt. Sie hatte ihren Vater in kindlicher Verehrung geliebt und ausser ihrer Tante Sophie niemand auf der Welt, dem sie ein so felsenfestes Vertrauen entgegenbrachte wie ihm. Dass sie vielleicht die indirekte Ursache des Todes ihres Vaters sein könnte, stimmte sie unendlich traurig. Mit feinem Taktgefühl hatte sie zu seinen Lebzeiten alles in ihren Briefen vermieden, was ihn hätte auf den Gedanken bringen können, sie fühle sich unglücklich in Frankreich. Ihr war es indes klar, dass der Kummer, den Ludwig XIV. und seine Minister ihrem Vater verursachten, viel zu seinem raschen Ende beigetragen hatte. Nun er nicht mehr lebte, benutzte sie gleich die ersten Stunden, um der Tante Sophie ihr übervolles Herz auszuschütten.
Es ist das erstemal, seitdem Liselotte in Frankreich weilte, dass eine solche Verlassenheit und Bitterkeit aus ihren Briefen spricht. Sie will und kann ihre Umgebung von der Schuld am Tode ihres Vaters nicht freisprechen. Sie fühlt sich dadurch einsam und elend. Glücklicherweise wurde ihr der Trost, von der Tante zu erfahren, dass Karl Ludwig in seinen letzten Lebensjahren keinen Groll gegen sie hegte, weil sie so wenig Einfluss hinsichtlich seiner Angelegenheiten bei Ludwig XIV. gehabt hatte.
Es waren bittere und traurige Erfahrungen, die Liselotte aus ihrer politischen Heirat zog, die ihr aber eigentlich erst nach des Vaters Ende richtig zum Bewusstsein kamen. Und doch erholte sie sich nach einiger Zeit wieder von ihrem Kummer, wenigstens äusserlich. Ihre Fröhlichkeit kehrte wieder; sie konnte wieder lachen. Aber zwei Monate lang war sie von einer tiefen Traurigkeit befangen gewesen, dass sie alle Lebensfreude verloren hatte und sich wegwünschte von dieser Welt, die ihr nur Leid bescherte. Sie ist so froh, den König wenigstens etwas von seiner grossen Schuld entlasten zu können.
Sie erkannte indes schon damals, was heute die gerechte Geschichtsforschung bestätigt: Der Hauptschuldige an diesem furchtbaren Morden und Brennen in der Pfalz war Louvois. Liselottes Schmerz über die Zerstörung ihrer geliebten Pfalz ist unbeschreiblich. Am traurigsten für sie war der Gedanke, dass alles in ihrem Namen geschah, und dass ihre Landsleute glauben mussten, sie, die Tochter Karl Ludwigs, sei mit diesen Greueltaten einverstanden! Die Vorstellung der entsetzlichen Mordbrennereien in der Heimat verscheucht den Schlaf von ihrem Lager. Angst, Aufregung, Zorn, Trauer und Schmerz wühlen in ihrem Innern. Wenn sie einschlummern wollte, sah sie ihr geliebtes Heidelberg, die Stätte ihrer jugendlichen Freuden, in Flammen aufgehen. Und sie, die ihren Heidelbergern so gerne geholfen hätte, konnte zur Milderung ihrer Leiden nicht das geringste beitragen. Tränen und Bitten hatten weder den König noch Louvois erweichen können. In ihrer grossen Bedrängnis schickte die Heidelberger Bürgerschaft einen der Ihrigen mit einer Bittschrift an die Pfälzer Liselotte, die im Schlosse von Versailles selber in heller Verzweiflung über all das Elend die Hände rang. Sie vermochte nichts. In der Nacht vom 4. Dezember 1688 hatte sie eine lange Unterredung mit diesem Abgesandten, der sie schon als Kind gekannt hatte. Aber es nützte nichts, dass sie Johann Weingarts herzerschütternde Vorstellungen dem König unterbreitete. Es wurde weiter geraubt und gemordet in Heidelberg. Louvois entschuldigte sein grausames Vorgehen zynisch damit, dass die Soldaten und die Völker leben müssten, worauf Liselotte mit ihm in heftigen Wortwechsel geriet und ihm ohne ein Wort des Abschiedes in grenzenloser Verachtung den Rücken kehrte. Auch der Dauphin musste ohne ein Abschiedswort von ihr ins Feld ziehen.
An sich selbst denkt Liselotte nicht. Ihre Rechte an die Pfalz sind für sie in den Hintergrund getreten. Nur reine Menschlichkeit spricht aus ihren leidvollen Briefen. Am liebsten möchte sie sterben, nur um nicht länger die Schande und die Greueltaten mit zu erleben, die ihrem Vaterlande angetan werden. Und dazu verlangte man in Paris von ihr, dass sie nicht als Pfälzerin, sondern als Französin dachte und empfand, dass sie mit den Franzosen patriotisch fühlte. Der Schmerz darüber brach ihr bald das Herz. Er wurzelte in ihrer tiefen Liebe zur Heimat. Von jedem politischen Empfinden war sie frei, denn sie verstand nichts oder nur sehr wenig von Politik. Das Vorgehen des Königs gegen die arme Pfalz betrachtet sie als eine persönliche Beleidigung, weil sie Pfälzerin und die Tochter des Kurfürsten von der Pfalz ist. Ihre Tränen sind persönlicher, nicht politischer Art. «Halte es vor ein grosses Lob, wenn man sagt, dass ich ein teutsch Herz habe und mein Vaterland liebe. Dieses Lob werde ich ob Gott will suchen bis an mein Ende!»
Die Verwüstung der Heimat blieb nicht der einzige Schmerz Liselottes. Es kam anderes Leid in ihr Leben, unverschuldetes und selbstverschuldetes. Ihre Tränen sollten von nun an nie mehr ganz versiegen. Es gab Ränke und Intrigen, denen sie nicht mehr gewachsen war, denen sogar ihre Tugend zur Beute wurde. Als man nichts an ihr finden konnte, das des Klatsches und der Verleumdung wert gewesen wäre, stellte man ernstlich ihre Freundschaft zum König in ein zweifelhaftes Licht. Die meisten indes lächelten darüber, dass Madame mit der immer schiefen Perücke, dem kupferroten Gesicht und ihren mehr männlichen als weiblichen Gewohnheiten zärtliche Gefühle für ihren schönen und ritterlichen Schwager hegen könne. Und doch war Liselottes Freundschaft zu Ludwig XIV. nicht ganz frei von einem mit Liebe verwandten Gefühl, nur war sie es sich selbst nicht bewusst. Sie litt entsetzlich darunter, wenn er einmal nicht ganz so freundlich zu ihr war wie sonst. Ist er krank, so geht sie mit bekümmerter und sorgenvoller Miene umher, und das Leben erscheint ihr freudlos. Sobald er sich aber wieder wohler fühlt und vielleicht gar seine erste Besuchsstunde ihr widmet, strahlt Madames Gesicht in heller Freude. Ihre Briefe sind voll des Lobes, ehe er die Pfalz mit seinen Truppen aufsuchte, und auch noch nachher versucht sie, trotz ihres unendlichen Schmerzes, immer wieder einen Grund zu finden, ihn von den Verbrechen freizusprechen, deren er sich schuldig gemacht hat. Wenn er sie wegen ihrer oft gar zu freien Reden «ausfilzt», ist sie traurig und fühlt sich in den Schatten gestellt, besonders seit Madame de Maintenon des Königs Herz gewonnen. Ihr grenzenloser Hass gegen diese Frau, in der sie die Quelle alles ihres späteren Unglücks erblickt, die furchtbare Erbitterung, die sie gegen sie hegt, sind der beste Beweis für die Gefühle, die Liselotte dem König entgegenbrachte.
Inzwischen arbeiteten die Günstlinge des Herzogs von Orléans eifrig an Liselottes Sturz. Sie gewahrten wohl, dass die Schicksalsschläge der letzten Jahre Madames starken Charakter erschüttert hatten, dass sie nicht mehr gegen alle Niederträchtigkeit so gefeit war wie ehedem, dass auch langsam die Gunst des Königs zu verblassen schien. Diese Umstände benutzten der Chevalier de Lorraine und seine Sippe, um Nutzen daraus zu ziehen. Bisher hatten sie sich begnügen müssen, Liselottes Dienerschaft gegen sie aufzuhetzen, die Personen, denen sie am meisten vertraute, von ihr zu entfernen oder ihr dieses und jenes Vergnügen zu entziehen, das sie besonders liebte. Das alles war von Madame kaltblütig hingenommen worden, und die Günstlinge hatten nicht die Freude gehabt, zu merken, dass sie sich darüber ärgerte. Als sie jedoch sahen, dass die vernünftige Liselotte ihr kaltes Blut verloren hatte, nahmen sie von neuem die Intrigen der früheren Jahre auf. Mit einer unglaublichen Zähigkeit verbreiteten sie das Gerücht, Madame habe eine geheime Liebschaft. Und diesmal nannten sie sogar laut den Namen des Geliebten. Es hiess, die Herzogin betrüge Monsieur mit dem jungen Gardeoffizier Saint-Saëns.
Von alledem ahnte Liselotte anfangs nichts. Aber das alberne Gerücht kam zu Ohren des Königs. Er hielt es für geboten, seine Schwägerin, deren leidenschaftliches Temperament er kannte, selbst davon in Kenntnis zu setzen und ihr Ruhe und Kaltblütigkeit zu empfehlen. Er riet Liselotte, auf das Geschwätz gar nicht zu achten, damit ihre Feinde nicht noch mehr durch eine Anklage bei Monsieur gereizt würden. Liselotte hingegen wollte davon nichts wissen. Sie war im höchsten Grade aufgebracht und wünschte die Angelegenheit durch den König selbst sowohl bei ihrem Gatten als auch vor dem ganzen Hofe klargestellt. Sie, die Schuldlose und Ehrbare, fühlte sich in ihrer Frauenehre tief verletzt.
«Je mehr ich darüber nachdenke», entgegnete der König weise, «desto weniger halte ich es für nötig, davon zu sprechen. Denn mein Bruder kennt Sie gut, und jedermann sieht seit zehn Jahren niemand, der weniger kokett ist als Sie.»
Das war ein kluger Rat, aber Liselotte blieb traurig und im Innern aufgewühlt, und sie verbarg ihre Empörung über eine solche Niedrigkeit nicht vor Monsieur. Eines Tages kam es schliesslich zwischen beiden zur Aussprache. Madame sagte ihm alles. Monsieur war nicht wenig erstaunt über ihre Entrüstung und meinte, wenn sie keinen anderen Grund habe, sich mit traurigen Gedanken zu quälen, so solle sie sich nur beruhigen, er wisse, dass sie einer Leichtfertigkeit unfähig sei. Er wisse auch, dass er demjenigen antworten werde, der sie bei ihm verklage. Eine vernünftigere Antwort als diese konnte eine Frau von ihrem Mann kaum erwarten, und Liselotte hätte gut getan, die ganze Geschichte als erledigt zu betrachten. Statt dessen kam sie täglich hundertmal darauf zurück, sprach mit ihrer Vertrauten, Fräulein von Théobon, einem ehemaligen Ehrenfräulein der Königin, im langen und breiten darüber und liess sich von ihr, der Gutunterrichteten, alle Einzelheiten des Klatsches berichten, der sich um ihre Person drehte. Auch Monsieur hielt nicht reinen Mund. Er erzählte seinen Günstlingen, dass Madame sich bei ihm wegen dieser Sache beklagt habe. Darüber gerieten sie in ungeheure Wut und spielten der Herzogin von Orléans die niederträchtigsten Streiche.
Inzwischen versuchte Fräulein von Théobon Madame gegen Monsieur zu verhetzen. Sie weihte sie in alle Einzelheiten der Ausschweifungen ein, die der Herzog mit seinen Freunden beging. Obwohl Liselotte schon vorher gewusst hatte, welches Leben ihr Gatte führte, so kam es ihr doch jetzt, da sie an sich durch alle möglichen Schicksalsschläge deprimiert war, doppelt abscheulich vor. Ein Bruch mit Monsieur stand bevor.
Philipp war anfangs vorsichtig gewesen und hatte alles getan, um sie zu besänftigen. Denn er wollte nicht noch einmal in den Verdacht kommen, seine Frau zum Tode getrieben oder vielleicht vergiftet zu haben. Schliesslich aber, als Liselotte nicht aufhörte, durch ihre fortwährenden Reden und Klagen einen öffentlichen Skandal herbeizuführen, riss ihm die Geduld, und nun war er es, der sich bei seinem Bruder beschwerte. Er bat Ludwig, die Herzogin durch eine ernste Strafrede zur Vernunft zu bringen. Doch siehe da, der König weigerte sich und verteidigte seine Schwägerin aufs heftigste.
Als Liselotte sah, dass sie die Freundschaft des Königs noch nicht verloren hatte, triumphierte sie. Ludwig empfahl ihr nochmals Schweigen. Aber die Herzogin von Orléans hatte einen harten Kopf. Immer wieder hinterbrachte sie dem König die skandalösesten Geschichten, die ihr die Théobon von Monsieur berichtete, und hörte nicht auf, zu klagen und zu jammern. Schliesslich wurde es dem König langweilig. Es kam eine Zeit, da er kaum mehr seiner Schwägerin zuhörte, und eines Tages verabschiedete er sie mit einem hoheitsvollen Kopfnicken. Liselotte war traurig bis zur Lebensmüdigkeit, doch nie ist ihr die Einsicht gekommen, dass sie selbst auch einen Teil der Schuld trug an diesem unerfreulichen Leben. Sie wusste sich keinen anderen Rat, als den König zu bitten, ihre Tage im Kloster von Maubuisson beschliessen zu dürfen. Ein ungeheurer Entschluss für die lebensfrohe Frau.
Inzwischen hatte sich aber auch Monsieur an den König gewandt, um ihn zu bitten, den Vermittler zwischen ihm und seiner Gattin zu spielen. Ludwig grollte nie wirklich seiner eigenwilligen Schwägerin; denn er wusste, sie war gut. Liselotte aber wollte ihren Willen durchsetzen. Von neuem bat sie: «Lassen Sie mich nach Maubuisson gehen, Sire.»
Darauf der König: «Aber, Madame, bedenken Sie, welches Leben Sie dort erwartet. Sie sind noch jung, können noch viele Jahre leben, und ein solcher Entschluss ist hart.»
Da legte die Herzogin von Orléans ihm mit grosser Beredsamkeit dar, dass sie gegen die zahlreichen Feinde, die sie umgäben, machtlos sei. Es wäre ihnen bereits gelungen, ihr den Gatten zu entziehen, und eines Tages würden sie es wahrscheinlich auch so weit bringen, dass er, der König, sich ganz von ihr abwände.
«Nein, nein, Madame», unterbrach sie Ludwig, «ich bin von Ihrer Unschuld und Ehrenhaftigkeit vollkommen überzeugt. Ich kenne Sie. In dieser Hinsicht kann Ihnen niemand bei mir schaden, seien Sie beruhigt. Und wie Sie sehen, glaubt mein Bruder auch nicht an das dumme Geschwätz; denn er möchte sich wieder mit Ihnen versöhnen.»
Liselotte war indes noch immer geneigt, ihr Leben im Kloster zu beschliessen. Jetzt wurde der König sehr ernst und sagte fest und bestimmt: «Madame, da ich sehe, dass es Ihr aufrichtiger Wunsch ist, sich nach Maubuisson zurückzuziehen, muss ich Sie bitten, sich diesen Gedanken vollkommen aus dem Kopf zu schlagen. Denn solange ich lebe, werde ich niemals meine Zustimmung dazu geben. Ja, ich werde mich sogar mit aller Gewalt dagegen widersetzen. Sie sind, Madame, meine Schwägerin, und es ist Ihre Pflicht, sich diese Stellung zu bewahren. Die Freundschaft, die ich Ihnen entgegenbringe, gestattet mir nicht, Sie auf immer von mir gehen zu lassen. Sie sind die Frau meines Bruders, und ich dulde nicht, dass Sie ihm einen solchen Skandal bereiten, der für ihn vor der Welt sehr schlecht ausgelegt würde.»
Von so viel Freundschaft gerührt und mit Stolz erfüllt, schien die Herzogin endlich besänftigt. «Sie sind mein König», sagte sie einfach, «und infolgedessen auch mein Gebieter.»
Der Friede war geschlossen, wenigstens äusserlich. Noch am selben Abend führte Ludwig seinen Bruder in das Zimmer Madames. Sie mussten sich küssen, und der König empfahl beiden, die ganze Angelegenheit zu vergessen.
Von diesem Augenblick an aber war Liselotte eine andere. Das Vertrauen, das sie in alle, die sie umgaben, gesetzt hatte, war verschwunden. Sie glaubte sich von lauter Feinden und Spionen umgeben, die beständig darauf bedacht seien, ihr Leben zu verbittern, ihre Freundschaft zum König zu zerstören und sie aus ihrer Stellung zu verdrängen.
Mit dem Heranwachsen ihrer beiden Kinder entstanden für die Herzogin neue Sorgen und neue Kämpfe. Es ist bekannt, welchen Ehrgeiz Ludwig XIV. darein setzte, seine illegitimen Kinder zu den gleichen Rechten zu erheben wie die auf dem Throne geborenen. Liselotte war furchtbar empört, dass sie, die einem alten angesehenen Hause entsprossen ist, ihr eigenes Geschlecht mit dem «Bastardenblut aus doppeltem Ehebruch verderben sehen muss». Das sah sie als das grausamste Opfer an, das sie ihren Feinden bringen sollte. Glücklicherweise für sie brauchte sie wenigstens nicht für ihre Tochter zu fürchten. War es ihr Widerstand oder war es Zufall, kurz, der Herzog von Maine, der Sohn der Montespan, heiratete in der Folge eine Tochter des Herzogs von Condé.
Aber die nahe Verwandtschaft mit Mademoiselle de Blois blieb ihr nicht erspart. Vier Jahre später, als Philipp von Chartres, der Sohn Liselottes, das heiratsfähige Alter des Prinzen erreicht hatte, glaubten Madame de Maintenon und der König den Augenblick für gekommen, um den lange vorbereiteten Plan zur Ausführung zu bringen. Sie bestachen den Gouverneur des jungen Prinzen, den berüchtigten Abbé Dubois, in den Liselotte all ihr Vertrauen gesetzt hatte. Dubois sollte seinen ehemaligen Zögling zur Heirat mit der Tochter der Marquise de Montespan überreden, was ihm bei seinem ungeheuren Einfluss auf Philipp und bei dessen jugendlichen Alter natürlich nicht schwer fallen konnte.
Am 9. Januar 1692 eröffnete Monsieur seiner Gemahlin die Nachricht von der Vermählung seines Sohnes mit Mademoiselle de Blois. Liselotte konnte kein grösserer Schlag treffen als dieser. Sie weinte die ganze Nacht, nachdem sie beim König gewesen war und ihm ihre erzwungene Zustimmung gebracht hatte. Was blieb ihr anderes übrig als zu gehorchen, wenn der König befahl? Aber ihren Sohn jagte sie empört aus dem Zimmer, als er sie um Verzeihung bitten wollte. Auch Monsieur erhielt seinen Teil, als er bei ihr eintrat, so dass er kein Wort zu seiner Rechtfertigung hervorbringen konnte und vollkommen verwirrt wieder hinausging.
Man wagte in der folgenden Zeit nicht, mit der Herzogin über diese Heirat zu sprechen oder sie gar dazu zu beglückwünschen. An der Tafel des Königs musste Liselotte aber doch Platz nehmen. Sie tat sich auch hier keinen Zwang an, ihre Gefühle zu verbergen. Sie weinte unaufhörlich. Auch ihr Sohn sah verweint aus, und beide assen nichts von den aufgetragenen Speisen. Die ganze Tischgesellschaft kam in die peinlichste Verlegenheit. Nur der König liess sich nicht aus der Fassung bringen. Er bemühte sich sichtlich um seine beleidigte Schwägerin. Aber Liselotte beachtete ihn überhaupt nicht. Zum ersten Mal schien es, als wäre er für sie nicht da. Als die Tafel aufgehoben wurde und alle sich verabschiedeten, verbeugte sich Ludwig ausserordentlich tief vor der Herzogin. Aber wie erstaunt war er, als er den Kopf wieder hob und eben noch den breiten Rücken Liselottes gewahrte, die sich eiligst entfernte, ohne des Königs tiefe Verbeugung zu beachten.
Das war Liselotte im Zorn. Man sollte sie indes noch ganz anders kennenlernen. Am nächsten Morgen begab sich der Hof in die Messe. Wie gewöhnlich erwartete man den König in der grossen Galerie. Aber noch ehe er kam, erschien Madame. Sogleich näherte sich ihr ihr Sohn, um ihr, wie alle Tage, die Hand zum Morgengruss zu küssen. In diesem Augenblick gab sie ihm eine so schallende Ohrfeige vor dem ganzen Hof, dass man es einige Schritte weit hörte. Das Recht der Züchtigung als Mutter wollte sie sich wenigstens nicht nehmen lassen.
Und doch musste Liselotte sich in das Unvermeidliche fügen. Am 11. Januar wurde die Verlobung öffentlich verkündet, und am 18. Februar fanden die Hochzeitsfeierlichkeiten statt.
In allen diesen Antipathien war Liselotte höchst unvorsichtig. Sie konnte ihre Gedanken und Gefühle nicht verbergen. Sie will sich nicht ärgern und die ihr verhassten Personen mit Kälte und Gleichgültigkeit behandeln, dabei aber steigt ihr Zornesröte in den Kopf, und man sieht deutlich, was in ihr vorgeht. Die bitteren Worte sprudeln über, und sie geht in ihren Ausdrücken so weit, dass man vor ihrem Hasse und ihrer Derbheit erschrickt. Dem König war das Benehmen Liselottes bei der Heirat ihres Sohnes äusserst unangenehm. Er konnte es am wenigsten vertragen, wenn man die intimen Seiten seines Lebens mit Missachtung berührte. Weltklugheit ging der Herzogin von Orléans durchaus ab. Und deshalb verscherzte sie sich jetzt wieder die Gunst Ludwigs XIV.
In dem Masse, wie sich Liselottes Innere mehr und mehr am Hofe Frankreichs verbitterte, verlor auch ihre äussere Gestalt. Die Jugendfrische, die sie einst zu einem ganz hübschen, appetitlichen Mädchen gemacht hatte, war dahin. Ihre Haut wurde welk und runzlig, und die Spuren der Blattern, die sie im Jahre 1693 hatte, entstellten sie noch mehr. Liselotte war zu dieser Zeit erst vierzig Jahre alt, aber bereits so unförmig dick und grauhaarig, dass sie einer Matrone glich. Dass sie aber betrübt über dieses vor der Zeit Altwerden gewesen wäre, davon lesen wir nichts in ihren Briefen. In ihrer gewohnten Weise macht sie sich auch darüber lustig. «Ich bin immer hässlich gewesen, und bin's noch weit mehr seit der ‹petite vérole›. Ich habe eine dicke, monstruöse Taille, bin viereckig wie ein Würfel. Meine Haut ist rot mit gelben Flecken, ich werde grau, und meine Haare sind Pfeffer und Salz. Meine Stirn und meine Augen sind voller Falten, und meine Nase ist noch immer so schief und obendrein mit Blatternnarben besetzt, ebenso meine beiden hängenden Backen. Ich habe ein Doppelkinn, schlechte Zähne, und das Maul beschädigt und noch grösser und faltiger wie früher.»
Als Liselotte jung war, hatte man an dem verfeinerten Hofe Ludwigs über die derbe Urwüchsigkeit dieses Naturkindes und den vollkommenen Mangel an Gefallsucht gelacht. Man hatte ihren biederen, geraden Sinn, die Derbheit ihrer Wesensart, die Unüberlegtheit in ihren Worten originell, neu und interessant gefunden. Bei der älteren Liselotte aber, die trotz ihres langen Aufenthaltes in Frankreich nie französische Manieren hatte annehmen wollen, fand man das alles geschmacklos, grob und unerzogen. Sie wieder, die mehr und mehr die Augen öffnete vor dem Leben, das sie umgab, konnte ihre Unzufriedenheit mit den verdorbenen Sitten nicht verbergen. Bei ihren reinen moralischen Grundsätzen und dem richtigen Gefühl für alles, was Ehrlichkeit und Offenheit des Charakters betraf, konnte ihr die Denkungs- und Lebensart der Menschen nicht zusagen, die in übertriebenen Genüssen, Extravaganzen, Intrigen und Heucheleien schwammen. Und besonders ärgerte sie sich über die deutschen Landsleute, «die alles perfekt halten, was nur aus Frankreich kommt». Sie bedauert es unendlich, dass auch «die bösen Conduiten» an den deutschen Fürstenhöfen Anklang und Eingang fanden. Sie dachte wohl nicht daran, oder wusste es vielleicht nicht, dass Deutschland des französischen Vorbildes gar nicht bedurfte; denn es hatte bereits an dem mehr als galanten Hofe Sachsens unter August dem Starken ein genügendes Vorbild gehabt. Gräfin Cosel und Aurora von Königsmark hatten der Welt dasselbe Schauspiel geboten wie die Mätressen Ludwigs XIV. Das aber kam Liselotte gar nicht in den Sinn.
Je mehr sie sah, wie fad, öde und verdorben diese glanzvolle Welt um sie herum im Grunde genommen war, desto tiefer verschloss sie sich in sich selbst. Obwohl sie an einem geräuschvollen Hofe lebte, an dem es an Abwechslungen nicht fehlte, geschah es doch oft, dass sie stundenlang allein in ihrem Zimmer sass. Aber sie langweilte sich nicht. Wir wissen, dass sie eine eifrige Briefschreiberin war. Mit ihrem ausgedehnten Verwandtenkreise in Deutschland, England, Frankreich, Spanien unterhielt sie einen lebhaften Briefaustausch. Sie las auch gern. Jeder ihrer Briefe lässt uns einen tiefen Einblick in ihr Leben tun, und je mehr Liselotte Einblick in die Welt gewinnt, die sie umgibt, desto mehr schwindet der Humor, mit dem sie andere und sich zum besten hält.
Liselottes Leben war mit der Zeit monoton geworden. Ein Tag glich dem andern. Immer dieselben Gesichter, dieselbe Etikette, dieselben lästigen Pflichten. Am furchtbarsten empfand sie die endlosen Mahlzeiten, wo sie fast eine Stunde lang allein mit ihren Damen an der Tafel sitzen musste und, der damaligen Sitte gemäss, von einer Menge Neugieriger umringt war, die ihr beim Essen zusahen. «In den 43 Jahren, die ich hier bin», klagt sie, «habe ich mich noch nicht an diese unseligen Mahlzeiten gewöhnen können.» Und doch war es ein Los, das sie mit vielen teilte.
Immer bitterer werden ihre Klagen. Immer mehr spürt sie die Kälte der Verlassenheit. Sie kennt niemand am grossen Hofe des Sonnenkönigs. Sie hat keine wahren Freunde. Sie selbst ist mit jedermann freundlich, aber die Kluft zwischen ihrem Charakter und dem französischen ist zu gross. Man fühlt, dass sie anders ist und kommt ihr nicht näher. Man macht ihr tiefe, ehrfurchtsvolle Verbeugungen, richtet hier und da ein respektvolles Wort an sie, aber das ist alles. Liselotte litt viel darunter und vermochte doch keine Aenderung zu schaffen. «Meine Verdriesslichkeiten», gesteht sie, «sind wie die Köpfe der Hydra von Lerna, wenn einer abgeschlagen, kommt ein anderer wieder.»
Und dann verlor sie auch ihre besten Freunde in der Heimat. Einer starb nach dem andern. Zuerst die gute, liebe Frau von Harling. Dann ihre Tante, die Aebtissin von Maubuisson, zu der sie bisweilen in ihrer Einsamkeit geflüchtet war, und auch ihre liebste Halbschwester Annelise, mit der sie beständig im Briefwechsel gestanden hatte.
Der grösste Schlag für Liselotte aber war der Tod der Kurfürstin Sophie von Hannover, die im Jahre 1714 aus dem Leben schied. Die Verwandten in Hannover wagten es nicht einmal, ihr die Todesnachricht direkt mitzuteilen; denn sie wussten, wie tief ergriffen sie davon sein würde. Man bat den Beichtvater, es der Herzogin von Orléans so schonend wie möglich beizubringen, dass ihre «herzliebe» Tante nicht mehr unter den Lebenden weile. Liselotte war 62 Jahre alt, aber immer noch hing sie wie ein Kind an dieser Tante, die ihr soviel im Leben bedeutet hatte. Ihr Einfluss war trotz der langen Trennung und trotz der Entfernung ein so starker, dass Liselotte nicht nur in ihrer Denkungsweise, sondern auch in ihren Ausdrücken und Urteilen immer das wandelnde Ebenbild der hannoverschen Kurfürstin zu sein schien. Und nun war sie nicht mehr, die ihr in allem als nachahmenswertes Beispiel voranging!
Als Liselotte die Nachricht von ihrem Tod erfuhr, erbleichte sie und war einer Ohnmacht nahe. Ihr ganzer Körper begann wie von Fieberfrost geschüttelt zu werden. Eine Viertelstunde vermochte sie weder ein Wort hervorzubringen noch zu weinen, aber ihre Brust keuchte, und es war ihr, als sollte sie ersticken. Dann kamen die Tränen in Strömen. Unaufhaltsam weinte sie Tag und Nacht um dieses so sehr geliebte Wesen. Nichts hält sie mehr auf Erden zurück. Sie möchte am liebsten auch sterben. Es ist indes nicht der Gedanke eines Wiedersehens mit der Tante oder den lieben verstorbenen Freunden. An ein Leben im Jenseits glaubte Liselotte ebensowenig wie an Geistererscheinungen. Sie ist auch nicht eine von denen, die durch irdische Leiden Sehnsucht nach einem besseren Leben im Himmel bekommen. «Die Störche wissen, in welch Land sie ziehen», meinte sie, «aber wir armen Menschen wissen nur, wo wir sein, also gar kein Wunder, dass wir nicht so gross Empressement und Eil haben, wegzuziehen, als die Störche ... Es ist nicht die geringste Apparentz, um alle wieder zu sehen, so man verloren hat.» Dennoch wäre es ihr ganz lieb, wenn auch sie von der Welt verschwinden würde. Was blieb ihr schliesslich von diesem Leben an einem Hofe, wo der Tod ebenfalls mehrmals Einkehr gehalten hatte? Der König war ernst und traurig gestimmt; man konnte sich ihm kaum noch nähern. Ueber Liselottes Sohn streute man die absurdesten Gerüchte in Verbindung mit dem plötzlichen Hinsterben der Familie des Dauphins aus, und diese furchtbaren Anklagen drückten die Mutter fast zu Boden.
Noch hatte sie freilich den König auf ihrer Seite, der diese Gerüchte zum Schweigen brachte und Liselotte so gut es ging zu trösten suchte. Aber auch Ludwigs Stunde hatte geschlagen. Im August 1715 erkrankte er ernstlich. Liselotte war vollkommen fassungslos bei dem Gedanken, dass sie nun vielleicht bald auch ihren besten und einzigen Freund am Hofe verlieren sollte. Immer hatte sie ihn geliebt, mehr als sie sich zugestehen wollte. Um so schmerzlicher berührte es sie, dass der von ihr vergötterte Mann in den letzten Jahren seines Lebens nicht mehr auf der geistigen und körperlichen Höhe wie früher stand. Sie vermochte es kaum zu ertragen, wenn jemand etwas über die abnehmende Gesundheit des Königs oder gar über seine sich vermindernden Geistesfähigkeiten sagte. Nicht selten geriet sie darüber in den hellsten Zorn und sagte, es sei eine abscheuliche Verleumdung, zu behaupten, Ludwig XIV. werde kindisch. Er habe immer noch einen guten Kopf, das wisse sie. Sie hingegen werde alt und schwach und habe gar kein Gedächtnis mehr.
Damit wollte sie sich selbst täuschen. Sie wollte nicht daran denken, dass auch er ihr genommen werden könnte. Als sie aber schliesslich einsehen musste, dass auch ein Mann wie Ludwig XIV. sterblich sei, da war sie ganz verzweifelt. Der König, der sich seinem Ende nahe fühlte, hatte sich auf den Tod vorbereitet und nach dem Abendmahl den kleinen Dauphin, den zukünftigen Ludwig XV., an sein Sterbebett gerufen. Nachdem er ihm seinen Segen gegeben, liess er die Herzogin von Berry, Liselotte und alle seine Töchter und Enkel zu sich kommen, um Abschied zu nehmen. Besonders an Liselotte richtete er so gütige, liebe Worte, dass sie sich wunderte, vor Rührung nicht ohnmächtig geworden zu sein. Er versicherte ihr, dass er sie immer lieb gehabt, ja mehr als sie selbst geglaubt hatte, und er bedaure, dass er ihr bisweilen Kummer bereitet habe. «Madame», sagte er, «man hat alles getan, um Sie mir hassenswert zu machen, aber es ist ihnen nicht geglückt.» Dabei verwandte er keinen Blick von der demütig an seinem Bett stehenden Frau von Maintenon. Das berichtet Liselotte mit besonderer Genugtuung. Und während sie noch vor ihm auf den Knien lag, sprach er zu den anderen Prinzessinnen seines Hauses und ermahnte sie, sie möchten immer in Eintracht miteinander leben. Liselotte glaubte, diese Worte seien auch an sie gerichtet. Unter Schluchzen antwortete sie, sie würde seinen Rat jederzeit beherzigen. Da lächelte Ludwig gütig und meinte: «Ich sage das nicht zu Ihnen; denn ich weiss, Sie sind vernünftig und haben einen solchen Rat nicht nötig. Ich meine die andern Prinzessinnen.» Liselotte erhob sich, im Herzen voller Stolz und Dankbarkeit für so viel Güte. Es war für sie eine grosse Genugtuung, dass das der König in seiner letzten Stunde zu ihr vor allen gesagt hatte. Nun stand sie doch gerechtfertigt da.
Erst am Sonntag darauf starb Ludwig XIV. Liselotte war des besten und mächtigsten Freundes beraubt, den sie besessen hatte. Drei Generationen des königlichen Hauses hatte der Tod in kurzen Zwischenräumen hinweggerafft. Liselottes Sohn war plötzlich in den Vordergrund gerückt. Ihm war es bestimmt, das im Sinken begriffene Staatsschiff als Regent des noch minderjährigen Ludwigs XV. weiterzulenken.
Wir wissen, dass die Herzogin von Orléans sehr stolz auf ihren begabten Sohn war. Mit viel Geschick und grossem Verständnis hatte er die Staatsgeschäfte in die Hand genommen, und es erwies sich, dass er nicht nur ein tüchtiger Feldherr, sondern auch ein ausgezeichneter Politiker war. Aber als Mensch war er, wie sein Vater, ein Wüstling. Der Mutter waren seine Ausschweifungen nicht unbekannt, und sie konnte sich nicht recht des grossen Glücks erfreuen, das Philipp nach dem Tod Ludwigs XIV. auf den Thron Frankreichs erhoben hatte. Sie sah voraus, dass ihr Sohn erst recht in den Strudel der Leidenschaften mit fortgerissen werden würde, sobald er tun und lassen konnte, was er wollte und keinen Gebieter mehr über sich fühlte. Ein gewisser Trost in dieser trüben Voraussicht war ihr nur, dass sein Herz bei allen Fehlern nicht verdorben war und nicht verderben konnte. Philipp war nur durch den Zynismus einer überaus leichtlebigen und sinnlichen Umgebung verwildert. Das verderbliche Beispiel seines Vaters, das er von frühester Jugend an vor Augen gehabt hatte, überhaupt das ganze verführerische Leben an Ludwigs epikuräischem Hofe hatte viel zu den Neigungen des jungen Herzogs beigetragen. Was jedoch Liselotte, die so wenig Glück und Liebe in der eigenen Familie kennengelernt hatte, wirklich erfreute, war der Umstand, dass ihr Sohn ihr stets die grösste Achtung und Ergebenheit erwies, selbst als Regent. Wenn er auch nicht immer mit seiner Mutter übereinstimmte, so vermochten doch niemals die Intrigen des Hofes ihn ganz von ihr zu entfernen.
Nur mit der Schwiegertochter, dem «Mausdreck», war die Herzogin von Orléans nie einverstanden. Sie behauptete, die junge Herzogin beherrsche ihren Sohn vollkommen und mache mit ihm, was sie wolle. Liselotte fürchtete und hasste zugleich diesen Einfluss, mehr als jeden anderen; denn sie kannte ihres Sohnes Gemahlin als getreue Verbündete ihrer grössten Feindin, der Madame de Maintenon. Es war überdies nicht eine ganz unbegründete Angst der Mutter. Beinahe wäre es den Brüdern der jungen Herzogin, besonders dem Herzog von Maine, gelungen, sich nach des Königs Tode an Philipps Stelle auf den Thron zu setzen. Und in dieser Intrige spielte die eigene Gattin Philipps keine unbedeutende Rolle. Jedenfalls waren Madame de Maintenon und ihre einstigen Zöglinge die Hauptführer der Hofverschwörung gegen den Regenten.
Eine grosse Veränderung war in Versailles vor sich gegangen, seit der Sohn Liselottes die Zügel der Regierung in Händen hatte. Schon die letzten zehn Jahre der Herrschaft Ludwigs waren nicht mehr mit den glänzenden Zeiten des prachtliebenden Sonnenkönigs zu vergleichen. Die Maintenon hatte alles Prunkvolle, allen Glanz, alles Frivole, aber auch alles Zierliche und Anmutige von diesem Hofe verbannt und aus den Gemächern des Königs Betstuben gemacht, worin sie mit frommen Taubenaugen ihre Herrschaft ausübte. Aber der Sumpf und Moder war nur oberflächlich von dieser erzwungenen Tugend überdeckt. Mit der Regierung des Regenten brach sich die Sittenlosigkeit erst recht Bahn, aber roh und ungestüm in wüstes Treiben, nicht in die feine galante Form gezwängt, die Ludwig XIV. selbst seinen schlimmsten Ausschweifungen zu verleihen wusste. Liselottes Sohn war ein Gemisch von urwüchsiger Kraft, verdorbenen Sitten und verfeinerter Kultur, ohne die Tünche des Salonmenschen des 18. Jahrhunderts.
Allmählich gewöhnte Liselotte sich an ihr neues Leben. «Muss nur sehen», meint sie resigniert, «so zu leben, dass ich ruhig sterben kann. Und es ist schwer, in diesen Weltgeschäften ein ruhiges Gewissen zu haben.» Solche Grundsätze in Liselottes ehrlichem Herzen waren indes nicht nur durch das Alter herbeigeführte Maximen. Es waren Grundsätze, die seit langem tief in ihrem Charakter eingeprägt waren. Sie war, mitten in einer glänzenden, heuchlerischen Umgebung, wo Frauenlist und kühne Zudringlichkeit abgefeimter Günstlinge sich zu den Staatsgeschäften herandrängten, in der unverstellten Geradheit ihrer Gesinnung nie erschüttert worden. Wie sie aus Heidelberg gekommen war, so blieb sie am französischen Hof bis an ihr Ende, offen, ehrlich und natürlich. Mit diesem Fehlen aller Falschheit und Zweideutigkeit verband sie ein weiches Herz, das zum wärmsten Mitleid gegen Unglückliche gestimmt war. Sie gab, wo sie konnte. Und so wenig sie an Ludwigs prachtliebendem Hofe die grosse Kunst der Sparsamkeit üben gelernt hatte, war sie doch in allen ihren Ausgaben sehr haushälterisch. Die Sorge um die Zukunft spielte in ihrem Leben eine grössere Rolle, als es sonst bei Fürstlichkeiten der Fall ist. Sie legte zurück, um nicht später einmal in Schulden zu geraten, aber auch um immer etwas für Bedürftige übrig zu haben. Geiz war ihr fremd. Wo sie übertriebene Kargheit bei ihren Standesgenossen gewahrte, machte sie sich lustig. Repräsentieren, und zwar gut und vornehm repräsentieren, galt ihr immer als die erste Pflicht eines Souveräns. Das hatte sie von Ludwig XIV. gelernt. Deshalb ist es ihr auch leid, dass es am Hofe ihres Sohnes so einfach zugeht. «Wohl waren ihr alle Zeremonien zuwider, aber ein bürgerlicher Hof war ihr auch nicht recht. Ein Hof musste ein Hof sein, und in ihren Augen war der Hof der Regentschaft eben keiner. Und wie sie mitten unter der prunkhaften Gesellschaft Ludwigs XIV. eine Fremde gewesen, so blieb sie es auch jetzt in der Umgebung ihres Sohnes. Einsam blieb sie am Kamine sitzen und musste sich langweilen». Die einzige Zerstreuung für sie war, mit scharfen Augen hinter die Kulissen dieses Hofes zu schauen. Und das hat sie denn auch mit kluger Beobachtungsgabe getan.
Liselotte wird alt. Sie geht den Siebzig entgegen. Aus der einst schlanken, kräftigen Herzogin von Orléans ist eine dicke, unförmige Frau geworden, die sich über ihre eigene Fülle und Schwere lustig macht. Wer aber H. Rigauds bekanntes Gemälde in der Galerie von Braunschweig gesehen hat, ist ein wenig anderer Meinung über das Aeussere der Herzogin von Orléans. Mag der Maler auch idealisiert haben, so ist doch dieses Bildnis nach Liselottes eigenem Geständnis sprechend ähnlich. Und da sehen wir eine kräftige, gesunde Matrone vor uns im Hermelinmantel und mit den äusseren Zeichen ihrer Würde geschmückt. In ihren sympathischen Zügen spiegelt sich Güte und Energie, Ehrbarkeit und Frauenwürde. Vornehmheit und Selbstbewusstsein liegen in der ganzen Haltung dieser Fürstengestalt, die uns das Einfache und Natürliche in Liselottes Wesen verbirgt. Von abschreckender Hässlichkeit oder ekelerregenden Fleischmassen ist auf dem Bilde nichts zu bemerken, das die Herzogin selbst zu dem erstaunten Ausrufe veranlasst: «Man hat sein Leben nichts Gleicheres gesehen als Rigaud mich gemalt hat!»
Je älter sie wurde, desto philosophischer dachte sie über die sogenannten überirdischen Dinge. Sie erinnert sich oft an die letzte Grenze ihres Daseins. Zwar wünscht sie sich keinen frühen Tod, aber sie äusserte mehrmals, dass sie jeden Augenblick bereit sei, dem Winke der Natur zu folgen, sobald das Ziel ihres Lebens gesteckt sei. «Ich bin fest persuadiert», schreibt sie am 23. Juni 1720 an Harling, «dass meine Stunden gezählt, und ich werde keinen Augenblick darüber gehen ... Bin weiter in keinen Sorgen, was daraus werden wird, das wäre wohl eine grosse Torheit, wenn grosse Frauen und Herren sich einbilden wollten, dass unser Herr Gott was besonders für sie machen sollte; als wenn alle Menschen nicht vor unserem Herr Gott gleich wären! Solchen Stolz und Hochmut habe ich gottlob nicht. Ich weiss wer ich bin und lasse mich hierin nicht betriegen.»
Im Jahre 1722 nahmen Liselottes Kräfte sichtbar ab, so dass man ihr nur noch kurze Zeit zum Leben gab. Zudem ward das Ende ihrer Tage durch die Ungeschicklichkeit der Aerzte, denen sie ja bekanntlich nie viel Vertrauen entgegengebracht hatte, beschleunigt. Sie sollte ihre Ansicht am eigenen Körper bestätigt finden. Man hatte nämlich beschlossen, bei eintretender Mattigkeit ihr durch einen Aderlass Erleichterung zu verschaffen. Dabei geschah es, dass der Chirurg zu tief schnitt, so dass Liselotte ungeheuer viel Blut verlor, zumal der Arm zu locker gebunden war. Infolge dieses grossen Blutverlustes nahmen ihre Kräfte noch mehr ab. Zu diesem Schwächezustand gesellten sich heftige Krämpfe und die zu jener Zeit sogenannten «Vapeurs», denen die Aerzte durch starke Abführmittel Einhalt zu gebieten suchten. Auch das schwächte den Körper der Herzogin ungemein. Ihr Appetit verlor sich, ihr Gedächtnis nahm ab. Sie hatte keinen Willen mehr. Ganz im Gegenteil zu früheren Zeiten tat sie alles, was die Aerzte von ihr verlangten. Sie lieferte sich denen, die sie einst nur verächtlich «Charlatans» nannte, mit Gleichgültigkeit aus und nahm die Arzneien, die ihr sonst so zuwider waren, dass sie «krittlich wie eine Wandlaus davon wurde», geduldig ein.
Mit dem Chirurgen aber, der sie so unglücklich behandelt hatte, erfasste sie das grösste Mitleid; denn der Aermste war vor Schreck über sein Ungeschick schwer erkrankt. Und so bemühte sich Liselotte, ihn in jeder Weise zu beruhigen und von der Verantwortung freizusprechen. Was lag ihr am Leben? Sie gab nichts darum, es zu verlängern; denn sie schied nicht ungern von der Welt, in der sie nichts mehr zu hoffen hatte. Ihr schien ein zu hohes Alter durchaus nicht angenehm. «Man muss zu viel leiden, und in Absicht des Schmerzensleiden bin ich eine grosse Poltron.»
Indes scheint sie doch ihren Tod nicht so schnell erwartet zu haben, wie er wirklich eintrat, obwohl ihr Gesundheitszustand sehr zu denken gab. So hatte sie sich besonders auf die im Herbst 1722 stattfindende Krönung des jungen Ludwigs XV. in Reims gefreut, der sie auch noch beiwohnte. Aber gleich nach ihrer Rückkehr nach Saint-Cloud ging es mit ihrer Gesundheit bedeutend schlechter. Sie fühlte das Ende nahen. Von Todesahnen durchdrungen, schrieb sie noch am 3. Dezember an die Raugräfin Luise: «Erhält mir Gott das Leben bis übermorgen, werde ich antworten, nun aber nur sagen, dass ich Euch bis an mein Ende lieb behalte.»
Das Uebermorgen erlebte sie noch, aber sie war nicht mehr imstande, ausführlich auf den Brief Luises zu antworten. Am 6. Dezember fand sich Liselotte so schlecht, dass sie sich das Abendmahl reichen liess und ihr Sohn zwei Nächte hintereinander an ihrem Krankenlager wachte. Die Atemnot war so gross, dass man jeden Augenblick befürchtete, sie werde ersticken.
Am 8. Dezember 1722 endlich hatte Liselotte ausgelitten und entschlummerte ruhig, wie sie es gewünscht hatte, um 4 Uhr morgens im 71. Lebensjahre. Philipp beweinte seine Mutter aufrichtig. Vielleicht war er der einzige Mensch am ganzen französischen Hofe, der die Eigenart dieser merkwürdigen Frau verstanden und schätzen gelernt hatte, obwohl Massillon an ihrem Grabe sagte: «Unser Ruhm oder unser Unglück war ihr Ruhm oder ihr Unglück. Durch Blut und Freundschaft mit dem grössten Teil der europäischen Fürsten verbunden, gehörte sie niemand mit dem Herzen an als der Nation, und inmitten der Kriege, welche sie gegen uns rüsteten, waren ihre Verbindungen mit fremden Höfen nichts als glänzende Zeugen ihrer Liebe zu Frankreich.» Liselotte von der Pfalz stand indes den Franzosen ebensowenig mit dem Herzen nahe, wie die Franzosen sie geliebt hatten. Und so ging die Herzogin von Orléans unbemerkt aus der Welt, wie sie auch in ihr unbemerkt gelebt hatte. Ihr Leichnam ruht in Saint-Denis, dem Begräbnisort der französischen Könige; ihr Sarkophag ist einfach und prunklos, wie es ihrer ganzen Lebensweise und Denkungsart entsprach.