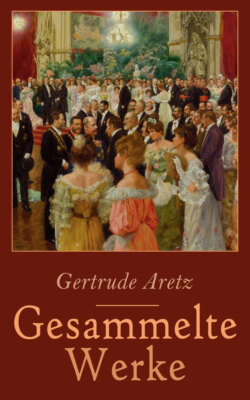Читать книгу Gesammelte Werke - Gertrude Aretz - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel. Kinderjahre
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Das Kind Elisabeth, über dessen Taufbecken einst vier Lords einen prächtigen Thronhimmel hielten, dem die Tochter des Herzogs von Norfolk, Maria Howard, den hermelingefütterten rotsamtenen Taufmantel mit der endlosen Schleppe wie den Purpurmantel einer Königin nachtrug, dieses Kind geriet durch die Nichtigkeitserklärung der Ehe und den Tod seiner Mutter nicht nur in eine zweideutige, sondern auch in eine sehr armselige Lage. Wäre Lady Margaret Bryan nicht gewesen, wer weiß, was aus der armen Kleinen geworden wäre. In dieser gutherzigen Dame findet die von ihrem Vater Verstoßene, ebenso wie auch ihre jetzt neunzehnjährige Stiefschwester Maria, eine zweite Mutter und Helferin.
Fern vom Hofe in London, wo mit dem Einzug der neuen Königin Glanz und Freude herrschen, lebt die kleine Prinzessin Elisabeth auf Schloß Hunsdon, ihrer Kinderseele glücklicherweise unbewußt, das Leben einer Mißachteten. Auch Maria verbringt hier ihre bittere, von Scham und Schmerz über das Schicksal ihrer Mutter, Katharinas von Aragon, zerrissene Jugend, in ständiger Auflehnung gegen den Vater und seine »Konkubine«. Nie hat Maria Anna Boleyn anders betitelt. Heinrich VIII. kümmert sich weder um diese noch um die andere Tochter. Die kleine Elisabeth haßt er nicht. Er haßt besonders Maria, die von ihrer spanischen Mutter her Strengkatholische. Er fürchtet ihre anklagenden Augen, ihr ganzes ostentativ zur Schau getragenes Wesen der beleidigten Tochter. Einst hat sie der kleinen Schwester Elisabeth alle Rechte abtreten müssen, sogar ihren Titel Prinzessin von Wales. In Hunsdon oder Hatfield lebt sie seit drei Jahren auf Anna Boleyns Veranlassung als Enterbte, wie eine Gefangene. Solange Elisabeths Mutter lebte, durfte Maria es nicht wagen, an ihren Vater, ja nicht einmal an ihre unglückliche Mutter zu schreiben. Als die Sterbende im Januar 1536 nach ihrem Kinde verlangt, wird der Tochter verboten, ihr Lebewohl zu sagen. So wenig menschliches Gefühl zeigte Heinrich dieser Tochter gegenüber, und Anna Boleyn unterstützte ihn darin.
Nun aber hat das gleiche Unglück Annas eigene, auf so glanzvolle Weise zur Welt gekommene Tochter Elisabeth ereilt. Auch sie ist von ihrem Vater vergessen, entrechtet, allen Glanzes beraubt. In Hunsdon, einer kleinen, armseligen Hofhaltung, unter der Oberaufsicht Lady Bryans, besitzt das Kind kaum das Nötigste. Die Erzieherin muß sich an den allmächtigen Staatssiegelbewahrer, Lord Cromwell, der Anna Boleyn aufs Schafott gebracht hat, wenden, damit er beim König vorstellig werde, der kleinen Prinzessin Kleider und Wäsche zu beschaffen. Lady Bryan weiß nicht einmal, wie und als was sie ihre Schutzbefohlenen nun behandeln soll. »In welchem Verhältnis Mylady Elisabeth jetzt betrachtet werden soll«, schreibt sie, »kenne ich nur vom Hörensagen. Ich weiß auch nicht, wie ich sie und mich oder einen der Leute, die unter mir stehen, das heißt, ihre Wärterinnen und Diener, anzusehen habe. Ich bitte Sie daher, Mylord, um Ihr Wohlwollen für meine Kleine. Ich bitte Sie, ihr ein paar Kleider zukommen zu lassen, denn sie hat weder Wäsche noch Rock, noch Leibchen, noch Unterkleid, noch etwas an Leinenzeug, weder Hemden noch Tücher. Sie besitzt keinen Mantel, kein Häubchen. Ich habe, mit Euer Gnaden Erlaubnis, damit hausgehalten, so lange es ging, aber nun kann ich, auf mein Wort, nicht mehr weiter. Bitte, bitte, Mylord, sehen Sie zu, daß meine Gnaden das Nötige bekommen.«
Andrerseits hat Heinrich verordnet, daß die kleine Dreijährige alle Tage an der großen Tafel in Hunsdon speisen soll, wo sie mittags und abends mit den schweren Gerichten der damaligen Zeit, in der auch die Frauen gewöhnt sind, sich den Magen zu überfüllen, traktiert wird. »Ach, gnädigster Herr«, fleht die Erzieherin, »es geht doch nicht für ein Kind in dem Alter, eine solche Lebensweise zu führen. Ich sage Ihnen offen, daß ich es dann nicht auf mich nehmen kann, sie gesund zu erhalten, wenn man sie so essen läßt. Sie sieht ja so manche Speise, Früchte und Wein, und für mich ist es schwer, Ihre Gnaden davon zurückzuhalten.« Lady Bryan kennt ihren kleinen Schützling und seinen Eigenwillen genau. Sie weiß, Elisabeth hat bereits alle Anlagen zu einem genießerischen Wohlleben in sich. »Sie ist noch zu jung«, fährt Lady Bryan fort, »um so etwas im Ernst zu tun, kommt sie aber einmal so weit, so kann ich sie weder zur Ehre Seiner Majestät des Königs noch zu ihrer eigenen noch zur Ehre meiner Wenigkeit, am allerwenigsten aber zur Erhaltung ihrer Gesundheit großziehen. Und darum lege ich Ihnen, Mylord, mein Verlangen ans Herz. Ach, sorgen Sie doch dafür, daß Mylady einen Gang aufs Zimmer bekommt, etwa von einem oder zwei guten Gerichten. Das ist genug für die Prinzessin... Guter Mylord, gedenken Sie meiner Kleinen und meiner selbst.«
Inzwischen hat Heinrich gleich am folgenden Tag nach der Hinrichtung Anna Boleyns Jane Seymour geheiratet. Bald darauf ist im Parlament die Akte durchgegangen, die seine Tochter Elisabeth zur Thronfolge für unfähig erklärt und die Nachkommenschaft der neuen Königin Jane Seymour als erbberechtigt anerkennt. Im Stillen freut sich Heinrichs älteste Tochter Maria darüber, daß nun ihrer kleinen Rivalin das gleiche Schicksal blüht wie ihr. Nach außen indes gibt sich Maria den Anschein, dem intelligenten, schon frühzeitig äußerst begabten Kind die mütterliche Liebe zu ersetzen. Das geschieht gleichzeitig in der Absicht, den Vater zu beschämen, der seine Kinder so leicht vergißt. Maria ist jetzt bald Zwanzig. Der Tod ihrer Feindin Anna Boleyn hat ihr endlich eine gewisse Freiheit gebracht. Wenige Stunden vor ihrer Hinrichtung hat Anna ihre Stieftochter in tiefer Reue und Verzweiflung um Verzeihung gebeten für alles, was sie ihr Böses zugefügt habe. Nun faßt Maria Mut. Sie kennt ihren Vater. Er ist durch das neue Liebesglück in versöhnlicher Stimmung. Die Erinnerung an Marias Mutter ist in ihm verwischt. Ihr Tod hat alles ausgelöscht. Sein Haß gilt jetzt vielmehr Anna Boleyn. So unternimmt Maria es – allerdings noch auf Umwegen – sich von neuem die Gnade des Vaters zu erringen, und damit die Hoffnung auf Anerkennung. Im Herzen dieses stolzen, herrschsüchtigen, überaus ehrgeizigen Mädchens frißt die Wut, der Gram um ihr verlorenes Thronrecht. Es entspinnt sich zwischen ihr und dem allmächtigen Thomas Cromwell ein lebhafter Briefaustausch. Wie eine Ertrinkende fleht Maria um Rettung. »Lange schon wollte ich Sie bitten, mir Ihre Fürsprache bei Seiner Gnaden, dem König meinem Vater, zu schenken, um seinen Segen und sein Wohlwollen zu erlangen. Doch ich begriff: niemand würde gewagt haben, zu meinen Gunsten zu sprechen, so lange jene Frau lebte, die jetzt nicht mehr ist und für die ich Gott bitte, ihr in seiner großen Barmherzigkeit alles zu vergeben. Jetzt, da sie nicht mehr lebt, erlaube ich mir, Ihnen zu schreiben, denn ich habe Sie jederzeit als einen meiner besten Freunde betrachtet. . . .«
Ihr guter Freund, der gerissene Cromwell, ist indes nicht so leichten Kaufes zu gewinnen. Er verlangt eine Gegenleistung. Nichts anderes fordert er von der tiefkatholischen Prinzessin, als die Aufgabe ihres Glaubens, ferner die Unterzeichnung eines Schriftstückes, wodurch sie sich ganz der Herrschaft Heinrichs unterordnet und seine Oberhoheit über die Kirche anerkennt. Außerdem muß sie der Nichtigkeitserklärung der Ehe ihrer Mutter zustimmen. Sie kämpft mit ihrem Gewissen als Tochter und Katholikin. Sie holt sich bei ihrem mächtigen Vetter Karl V. Rat. Er rät ihr nachzugeben, weil Heinrich VIII. ihm für seine Politik nötig ist. Als Cromwell alles erreicht hat, erst dann darf Maria ihrem Vater wieder persönlich schreiben und ihm für seine große Gnade danken. Maria ist klug genug alles zu tun, was man von ihr verlangt. Im Herzen bleibt sie Katholikin und läßt sich in ihrem Glauben nicht stören. Als sie ihrem Vater schreibt, hält sie es für diplomatisch, nicht nur für sich allein zu bitten, sondern ihm auch die kleine Schwester Elisabeth in Erinnerung zu bringen. »Ich glaube«, schreibt sie am 26. Juli 1536 an den König, »Elisabeth wird einmal Eurer Hoheit Grund zur Zufriedenheit geben, wenn es dem allmächtigen Gott gefällt. Sie ist ein sehr folgsames Kind.«
Heinrichs Interesse gilt indes nicht der kleinen Tochter. Es wird bald einzig und allein auf seinen Sohn, den sehnlichst erwarteten Thronfolger gelenkt, den ihm Jane Seymour im Oktober 1537 schenkt. Mit diesem Ereignis ist allen Zweifeln, allen Schwierigkeiten für die Zukunft Englands ein Ende bereitet. Alle Hoffnungen und Wünsche richten sich auf dieses Kind. Heinrich ist glücklich und – wie Maria richtig vermutete – versöhnlich gestimmt. Seine älteste Tochter darf an den Hof, sie darf als Patin den kleinen Prinzen über das Taufbecken halten. Die dreijährige Elisabeth trägt das kostbare Taufkleid mit der viele Meter langen Schleppe. Ihre winzigen Hände sind aber viel zu schwach, und einer der Herzöge muß das Kind auf den Arm nehmen, damit es mit seiner Hilfe die schwere Last tragen kann.
Heinrichs Glück mit Jane ist nur ein kurzes. Noch ehe er die Glückwünsche zur Geburt seines Sohnes Eduard vom englischen Volk entgegennehmen kann, stirbt die junge Mutter. Zum erstenmal reißt das Schicksal von Heinrichs Seite eine Frau, deren er noch nicht überdrüssig geworden ist, die er vielleicht bis ans Ende geehrt hätte, weil sie ihm den Erben seines Thrones gebar. Sowohl Maria als auch die kleine Elisabeth verlieren in Jane Seymour eine Fürsprecherin beim König. Sie hatte sich durch Leutseligkeit und Liebenswürdigkeit viele Anhänger am Hofe erworben. Auch sie galt allgemein als die Protektorin des Protestantismus. Aber sie nützte ihren Einfluß auf Heinrich nicht zur Förderung des Hasses gegen die Katholiken aus. Vor allem sorgte Jane dafür, daß Elisabeth, auf der der Fluch einer auf dem Schafott geendeten Mutter lastete, eine sorgfältigere Erziehung als bisher genoß. Von diesem Augenblick an kam die Kleine dem Hofe wieder etwas näher. Es wurde besser für ihr geistiges und körperliches Wohl gesorgt. Und was Königin Jane eingeführt hatte, blieb auch nach ihrem Tod bestehen. Besonders, als Prinz Eduard größer wurde. Er liebte das um knapp vier Jahre ältere Schwesterchen zärtlich. Elisabeth, noch zu jung, um in dem Bruder einen unwillkommenen Eindringling in ihre Rechte zu sehen, der sie der englischen Krone beraubte, erwiderte die Zuneigung des Kleinen in spontaner Freude und Glückseligkeit, einen Gespielen gefunden zu haben.
Als der Prinz zwei Jahre alt war, erhielten beide Kinder eine gemeinsame Erziehung, die gleichen Lehrer. Dadurch kamen sie sich fürs Leben nahe. Elisabeth hat diese Kinderjahre mit dem Bruder als die schönsten ihres Lebens betrachtet. Nie sprach sie anders von Eduard als in Ausdrücken höchster Liebe und des größten Bedauerns über seinen allzufrühen Tod. Wie ein Lichtstrahl in ihrer von Schrecken und Gefahren umgebenen Jugend sind diese Jahre des gemeinsamen kindlichen Erlebens und Lernens. Die Hinrichtungen, die Heinrichs Argwohn alle Tage befahl, die Verfolgungen, die durch ihn heute Protestanten, morgen Katholiken zu erdulden hatten, haben das Kind Elisabeth wohl wenig oder gar nicht berührt, weil sie erstens noch viel zu jung war und zweitens meist abseits vom Hofe in eigner Hofhaltung erzogen wurde. Die späteren Jahre ihres Kinderlebens aber sind bereits voll Unsicherheit und Mißtrauen. Sie lernt frühzeitig, sich zu verstellen, zu schweigen, sich zurückzuhalten. Der Gehorsam des anscheinend fügsamen Kindes ist oft nur äußerlich. Innerlich leidet Elisabeth bereits unter jeder Zurücksetzung und Bedrückung. Sie ist ernst und klug wie eine Große. Jener zwiespältige Charakter der späteren Herrscherin, der sich aus Stolz, Herrschsucht, Leidenschaftlichkeit, Willensstärke, Schwäche, Launenhaftigkeit und geschmeidiger Sanftmut zusammensetzte, schlummert bereits in dem kleinen Mädchen, das seine Abstammung von seinem leidenschaftlichen, zügellosen Vater und der genußsüchtigen Mutter in keiner Weise verleugnet. Elisabeth aber ist obendrein klug, als Kind sehr frühreif. Das Leben selbst lehrt sie sich zu beherrschen, ihr wildes Tudortemperament zu bändigen. Am Hofe ihres Vaters und noch mehr am Hofe ihrer Schwester Maria lernt sie jene Selbstbeherrschung, die sie als Königin aus Staatsgründen so oft anwenden muß. Der tyrannische Vater sowohl als auch die nicht minder herrschsüchtige Schwester sind mit harten Strafen schnell zur Hand. Man darf nicht viel sagen, wenigstens nicht alles, was man denkt. Der Tower ist finster. Es konnte vorkommen, daß man, wenn man einmal darin eingesperrt war, niemals wieder seinen Kerker verließ, niemals die Sonne wieder sah!
Elisabeths Kindheit entbehrt jedoch nicht der Freuden und mancher glücklichen Stunden. Fast jeder, der mit ihr in Berührung kommt, hat sie gern. Am Hofe bringt man dem höflichen aufgeweckten kleinen Mädchen Zuneigung und Liebe entgegen.
Man bewundert des Kindes schlagfertige Antworten, seine leichte Auffassungsgabe, seine Vorliebe zum Lernen und vor allem das frühzeitig ausgeprägte Talent für fremde Sprachen. Auch Heinrich freut die Klugheit seiner Tochter.
Elisabeths Geist wird schon sehr früh im Sinne der Renaissance gebildet. An Heinrichs Hofe gibt es viele über den Durchschnitt gebildete und gelehrte Frauen. Sich im Lateinischen und Griechischen, wie auch in lebenden Sprachen fließend unterhalten zu können, ist keine Ausnahme, sondern die Regel für den Renaissancemenschen der oberen Klassen. Eine Dame, die Anspruch auf Bildung macht, muß einen philosophisch gründlich durchgebildeten Geist besitzen, in der Dichtkunst und Musik Beweise ihres Könnens erbringen, auf allen Gebieten des Geisteslebens einigermaßen bewandert, in gesellschaftlichen Dingen erfahren sein. Der Mann aber muß, neben einer guten geistigen Bildung, auch ein kühner Reiter, ein Kämpfer bei allen Turnieren und Ritterspielen sein. Den Frauen der Renaissance steht Geist, Wissen, gesellige Sicherheit allen anderen weiblichen Eigenschaften voran, ohne daß sie dabei Lust und Lebensfreude und ihre äußere Schönheit vernachlässigen. Alle zimperliche Sentimentalität, wie sie später das 18. Jahrhundert so kraß zeitigt, ist ihnen fremd. In dieser Beziehung ist man am englischen Hofe vielleicht sogar um Nuancen robuster und derber als in Frankreich, wo die Sitten um diese Zeit bereits beginnen, verfeinerter, gezierter zu werden.
Die Welt, in der Elisabeth aufwächst, ist ein Gemisch von echter, tiefempfundener Frömmigkeit und gründlicher Gelehrsamkeit auf der einen, von zügelloser Ausschweifung, Rücksichtslosigkeit und Verrohung auf der anderen Seite. Der Vater selbst gibt durch sein Leben kein gutes Beispiel. Einige seiner Frauen noch weniger. Aber weder Heinrich noch sein Hof versinken in Dummheit und Stumpfsinn. Über allen Genüssen und rohem Genießen steht der Geist der Zeit, die einen Bacon und Shakespeare, Reformatoren und Diplomaten, Männer und Frauen hervorbringt, an denen die Weltgeschichte nicht vorübergeht. Das kluge Kind Elisabeth wächst in ihr. Fast alle Frauen ihres Vaters entdecken irgendeine Eigenschaft in dem Kinde, die es ihnen interessant macht. Fast alle bringen Elisabeth Sympathie, wenn nicht mehr entgegen. Jane Seymour wäre der Kleinen gern eine zweite Mutter geworden. Der Tod entreißt sie ihrem eigenen Sohn und der Mutterlosen. Heinrichs vierte Gattin, Anna von Cleve, erlebt nur eine kurze Ehe mit ihm. Sie ist Heinrichs größte Enttäuschung. Sie kommt mit der Scheidung davon und hat kaum Zeit, sich am Hofe ihres Gatten zu erwärmen. Später kommt eine Art Freundschaft zwischen ihr und Elisabeth zustande. Die berüchtigte Catherine Howard, wie Anna Boleyn des Ehebruchs angeklagt, muß wie sie ihr Haupt aufs Schafott legen. Und gerade sie hat Elisabeth viele Wohltaten erwiesen. Jede von diesen drei Königinnen läßt in dem Kinde die Erinnerung an irgendetwas von ihrem persönlichen Einfluß, ihrem Wesen zurück. Keine jedoch lebt lange genug am Hofe, um dem heranwachsenden Mädchen Leiterin und Führerin zu sein. Die einen sind selbst noch zu jung, zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, um sich mit des Kindes Eigenart ernstlich zu befassen. Die anderen beherrscht nur ein einziger Gedanke: so lange wie möglich sich die Gunst des Königs, ihres Gemahls zu erhalten. Die fünfte aber, Catherine Howard, verliert sich in ihren Ausschweifungen. Mit 22 Jahren besteigt sie auf Befehl ihres Gatten das Blutgerüst.
Immer wieder haben Frauen den Mut, für Heinrich VIII. in den Tod zu gehen, wenn sie eine kleine Weile Erdenglück mit ihm genossen haben. Es findet sich eine sechste. Anders als alle anderen. Reifer, klüger, geschickter und gütiger. Catherine Parr, die Witwe Lord Latimers, zieht im Jahre 1543 als Königin in Windsor ein.
Die neue Gemahlin Heinrichs besitzt außer Lebenserfahrung und außer ihrer menschlichen Güte einen sehr gebildeten Geist. Sofort erkennt sie die hervorragenden Gaben der nun zehnjährigen Elisabeth. Sie sieht, was hier versäumt wurde und was noch gutzumachen ist. Sie nimmt sie an ihr Herz gleich dem sechsjährigen Thronfolger. Sie ist die erste, die keinen Unterschied macht, daß Elisabeth die Tochter der auf dem Schafott geendeten Anna Boleyn ist. Auch sie ist ein Kind des englischen Königs, so gut wie Eduard sein Sohn ist. Beide Kinder haben lange die Mutter entbehrt. Beide sind bis jetzt in den Händen von bezahlten Erziehern und Gouvernanten gewesen. Wenn auch John Cheke, William Grindall und Roger Ascham hervorragende Pädagogen und Gelehrte waren, Liebe und Herzlichkeit einer Mutter fehlte den Kindern. Vor allem Elisabeth ist sich viel selbst überlassen gewesen. Erst jetzt, mit Catherine Parr, beginnt für sie eine Kindheit voll Liebe und Verstehen. Der kleine Bruder hängt, je älter er wird, immer mehr, immer zärtlicher an ihr. Er liebt die kluge Schwester mit dem rötlichflammenden Haar, mit den Knabenmanieren in ihren gemeinsamen Spielen. Denn fast scheinen die Rollen der Kinder vertauscht. Elisabeth scheint der Junge und Eduard, der Zarte, Feine, das Mädchen zu sein. Beide indes haben etwas gemeinsam: die Vorliebe für ihre Unterrichtsstunden! Beide sind intelligent. Sie lernen alles mit Feuereifer. Elisabeth ist zwar dem Jüngeren in vielem voraus, nicht nur, weil sie älter ist, sondern weil sie eine außerordentlich rasche Auffassungsgabe besitzt. Sie braucht nie zu »büffeln«. Sie lernt spielend und arbeitet leicht. Nie ist ihr etwas zu viel. Nie fällt ihr etwas zu schwer. Man gibt beiden Kindern die besten Lehrer, die ihren Schülern nichts erlassen. Der Geschichtsprofessor ist der berühmte Gelehrte Haywood. Ascham und Grindall, zwei bedeutende Humanisten, sind nacheinander Elisabeths Erzieher. Richard Cox und Professor John Clarke von der Cambridge Universität leiten die Erziehung des Thronfolgers.
Selbstverständlich werden Elisabeth und ihr Bruder mit der neuen Religion bekannt, deren Anhängerin auch Catherine Parr ist. Die Kinder erhalten regelrechten Religionsunterricht. Sie beginnen ihren Tag mit Gebeten und religiöser Lektüre aus dem Alten oder Neuen Testament. Nach dem Frühstück gibt es Sprachunterricht, Literaturstunden und später Kunstgeschichte und Philosophie. Auch der Prinz ist seinem Alter nach im Schulunterricht weit voraus. Er muß sich außerdem, zur Stärkung des Körpers, in Ritterspielen und den Waffen üben, denn die Renaissance verabscheut Weichlinge und Stubenhocker.
Elisabeth wiederum darf Musik und Tanz nicht vernachlässigen. Sie lernt die Laute schlagen und die Viola spielen. Handarbeiten füllen zur Schonung des Geistes ein paar Stunden des Tages des Kindes aus. Immer aber ist die neue Glaubenslehre der Leitstern des ganzen Unterrichts. Mit Gott beginnen die Kinder den Tag, mit Gott beenden sie ihn. Und doch ist Anna Boleyns Tochter ebensowenig eine wirkliche Protestantin geworden, wie sie, während Marias Regierung, eine wirkliche Katholikin war. Elisabeths spätere Willfährigkeit gegen die römischen Kirchengebräuche entsprang zwar hauptsächlich ihrer äußerst klug berechnenden Politik, teils aber auch einer gewissen Lauheit gegen die neuen Glaubensanschauungen. Wie bei Heinrich, ihrem Vater, ist auch bei Elisabeth das religiöse Gefühl schwankend. Heinrich brach mit der römischen Kirche eigentlich nur aus Trotz, nur weil Rom ihm die Auflösung seiner Ehe verweigerte. Allerdings hatte er die Nationale Kirche bereits so weit in der Hand, daß er diesen gefährlichen Schritt ohne weiteres wagen konnte. In seiner in allen Dingen schrankenlosen Willkür wollte er Alleinherrscher auch über die Kirche sein. Und er führte durch, was er wollte. Um mit Erich Mareks zu reden, »Er hat sich den Wechsel der Verfassung, des Eides erzwungen. Er hat so die stärkstgefügte der englischen Institutionen mit allem ihren Reichtum an moralischem Einfluß und an materiellem Gute und politischer Macht dem Königtume einverleibt. Er hob damit sich selber über die Gewalt des Parlaments, dessen er sich in alledem als seines Werkzeuges bediente, aufs neue hoch empor«. Heinrich blieb trotz allem Katholik, wenn er auch durch Thomas Cromwell als Generalvikar die Klöster aufheben ließ und alle mit Gewalttat und Grausamkeit bestrafte, die sich seinem Willen widersetzten. Er machte dabei keinen Unterschied, ob es Katholiken oder Protestanten waren. Jeder, der sich seinem Machtwort nicht fügte, wurde mit dem Scheiterhaufen bestraft.
Worin Heinrich VIII. aber machtlos erschien, war, daß auch er die protestantische Strömung von England nicht aufhalten konnte. Er beschützte zwar schon früher manchen Reformator, wie Latimer, aber sein trotziger völliger Abfall von Rom machte den Boden in England für den neuen Geist, der aus Deutschland kam, erst völlig aufnahmefähig. Die Bibel wird Allgemeingut. Jeder Engländer darf sie in der Landessprache lesen. Noch aber ist es eine unvollkommene Kirchenreform, die Heinrich aus persönlichem Egoismus herbeigeführt hat. Die Zeiten sind zerrissen, das Volk ist in religiösen Spaltungen verwirrt. Der Lebenswandel und Frevel des Herrschers lasten auf dem Lande. England ist von einer maßlosen Unruhe erfaßt, obwohl sein Wohlstand und Reichtum zunehmen. Am Hofe herrscht durch das rohe Gefühlsleben des Königs unter der Tünche schwelgerischer Pracht und Genußsucht die gleiche Zerrissenheit, die gleiche Unruhe. Viele zweifeln an Heinrichs aufrichtiger Überzeugung.
Das Kind Elisabeth sieht verhältnismäßig wenig von diesem Leben. Als sie nach jahrelangem Fernhalten vom Hofe endlich durch Catherine Parr wieder in der Nähe ihres Vaters leben darf, wird sie nicht lange darauf ein ganzes Jahr lang von neuem aus seinem Gesichtskreis verjagt. Sie hat in kindlicher Unschuld den Namen ihrer Mutter öffentlich ausgesprochen! Es ist aber allen, auch den Kindern, streng verboten, jemals die geschiedenen oder gemordeten Frauen Heinrichs zu erwähnen. Heinrichs Zorn entlädt sich über die zehnjährige Tochter Anna Boleyns, das lebende Zeugnis seiner furchtbaren Tat. Nicht einmal die Fürsprache ihrer gütigen Beschützerin nützt Elisabeth. Catherine vermag ihren Gemahl nicht zu bewegen, dem Kinde zu verzeihen. Es wird in St. James Palace von allem Familienleben des Königs ferngehalten, auch die Königin darf es nicht besuchen.
Fast ist ein Jahr vergangen, seitdem Elisabeth die Ungnade des Vaters erduldet. Er ist inzwischen zur Belagerung von Boulogne in den Krieg gegen Franz I. gezogen. Diese Gelegenheit ergreift die Elfjährige, um des Vaters Herz zu rühren. Es existiert ein italienisch geschriebener Brief von der Hand des Kindes vom 21. Juli 1544 an ihre »gute Freundin und wirkliche Mutter, die Königin«. Die kleine verbannte Prinzessin bedauert darin unendlich, der Gesellschaft Catherines beraubt zu sein. Sie empfindet diese Trennung als unerträglich, wenn sie nicht hoffen könne, sie bald wiederzusehen.
»In meiner Verbannung«, schreibt Elisabeth, wahrscheinlich unter der Leitung ihres italienischen Lehrers, »habe ich wohl gemerkt, daß Sie, Hoheit, sich in Ihrer Güte um mein Wohlbefinden ebenso besorgt und liebevoll gekümmert haben, wie es der König selbst getan haben würde. Daher fühle ich mich nicht nur verpflichtet, Ihnen zu gehorchen, sondern Sie auch wie eine Tochter zu verehren und zu lieben, vor allem, weil ich weiß, daß Eure Hoheit niemals vergessen, von mir in Ihren Briefen an Seine Majestät zu sprechen. Es ist also an mir, mich an Sie um Ihre Fürbitte beim König zu wenden, denn bis jetzt habe ich noch nicht gewagt, an ihn selbst zu schreiben. Ich bitte Eure ausgezeichnete Hoheit, mich, wenn Sie Seiner Majestät schreiben, ihm besonders mit der Bitte zu empfehlen, er möge mir seinen für mich so süßen Segen erteilen. Ebenso heiß erflehe ich von unserm Herrgott, ihm den besten Erfolg und den Sieg über seine Feinde zu gewähren, damit Eure Hoheit und ich uns auf die baldige Rückkehr Seiner Majestät freuen können.
Gleichzeitig bitte ich Gott, Eurer Hoheit ein langes Leben zu schenken. Ich küsse Eurer Hoheit demütig die Hände und überlasse und empfehle mich ganz Ihrer Güte
Eurer Hoheit gehorsamste Tochter und treueste Dienerin
Elisabeth.«
Es ist erstaunlich, wie gut sich bereits das kleine Mädchen in einer fremden Sprache auszudrücken versteht, selbst wenn ihr der Lehrer dabei geholfen hat. Die Renaissance forderte von den höfischen jungen Damen in diesem Alter bereits einen Stil und die Persönlichkeit des Ausdrucks, die Elisabeth später durch ihre geschraubte Schreibweise stark verminderte. Um dieselbe Zeit, da sie diesen Brief an die Königin schreibt, beschäftigt sich das Kind mit einer schwierigen literarischen Arbeit, einer Übersetzung aus dem Französischen der Margarete von Valois, »Miroir de l'âme pècheresse«. Mit einer beinahe geistig überlegenen Bemerkung sendet Elisabeth das Werk an die Königin Catherine. »Ich habe versucht, das Werk und seinen Geist so gut ich es vermag wiederzugeben, aber es bleibt leider noch viel zu wünschen übrig. Viele Stellen sind ungeschickt und nicht nach meiner Zufriedenheit ausgefallen.« Die Selbstkritik einer Elfjährigen ist erstaunlich.
Catherine erreicht es schließlich doch, daß sich Heinrich mit seiner Tochter Elisabeth versöhnt. Sie darf sich wieder vor ihm sehen lassen, wenn er auch wenig Notiz von ihr nimmt. Das Kind aber ist für jedes Wort, jeden Blick, jede Geste des Vaters dankbar. Sie liebt ihren Vater. Er ist der König von England. Und sie ist seine Tochter. Am glücklichsten ist sie jedoch, nun wieder mit ihrem Bruder Eduard vereint zu sein. Diese Trennung ist ihr am schwersten gefallen.