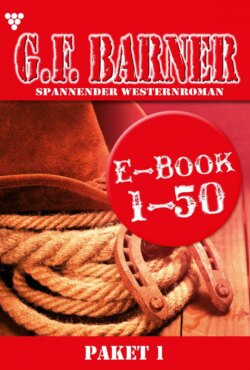Читать книгу G.F. Barner 1 – Western - G.F. Barner - Страница 15
ОглавлениеEs würde ein leichtes Geschäft werden. Die Ranchmannschaften sind alle unterwegs nach Süden, um das Vieh zur Bahn zu treiben. Folglich wird kaum jemand zu Hause sein, wenn sie ihre Besuche machen.
In der Mitte reitet Bruce, der Mann, der am besten denken kann, der die Befehle gibt und Pläne macht. Links neben Bruce hockt James im Sattel. Der Bursche sieht aus, als käme er gerade von einer Beerdigung. Er trägt seinen Revolver links und hat die Hand immer in der Nähe des Kolbens. Er ist ohne Zweifel der schnellste Mann dieses Rudels.
Neben James, ganz außen, reitet Lispy. Er heißt eigentlich ganz anders, aber er lispelt und stottert. Darum hat er seinen Namen bekommen, seinen richtigen kennt er kaum noch. Lispy ist der Spaßvogel dieses Vereins.
Rechts neben Bruce reitet Phil Dorrey. Er ist dick, nicht gerade klein, und wirkt die meiste Zeit mürrisch. Ganz rechts hängt Sid McDewey auf seinem Pferd und hat wie immer die Lippen zusammengekniffen. McDewey ist ein völlig egoistischer Bursche, finster und undurchschaubar.
Sie haben noch dreißig Meilen zu reiten. Es ist Mittag. Vor dem späten Abend werden sie nicht an jenem Platz sein, an dem sie ein Geschäft machen wollen. Man könnte zu diesem Geschäft auch Überfall sagen, oder Raub, Diebstahl, aber sie reden immer nur von ihrem Geschäft.
Sie kommen nun aus dem Buschgelände, halten auf den Fluss zu und reden wenig. Nur Lispy, der leicht schwitzt und bei der Hitze dieses Maitages geradezu austrocknet, sagt stotternd und lispelnd: »Bruce, la – lass uns ma – mal zum Fluss – Fluss reiten. Ich mu – muss mein He – Hemd wa – waschen.«
»Warum musst du verdammter Narr auch nur eins mitnehmen!«, zischt Dorrey, dem die Hitze ebenfalls zu schaffen macht. »Du bist ein fauler Hund. Wenn Faulheit stinken würde, dann könnte es keiner von uns neben dir aushalten. Nimmt nur ein Hemd mit, weil er zu faul gewesen ist, seine dreckigen Sachen zu waschen.«
»Zu fli – flicken«, erwidert Lispy. »Alle haben Lö – Löcher.«
James, der seine Augen überall hat, obwohl er immer zu schlafen scheint, sagt kurz und knapp: »Da ist ein Pferd ohne Reiter, Bruce. Links von uns.«
Dicht an der Schlucht stehen ein paar Büsche, hinter ihnen sehen sie nun das Pferd und halten verwundert an. In dieser Wildnis, in die sich höchstens ein Jäger verirrt, steht ein gesatteltes Pferd. Das Gewehr ragt mit dem Kolben über den Sattel, hinter dem ein dicker Packen aufgeschnallt ist.
»Was ist denn das?«, fragt McDewey überrascht. »He, wie kommt hier ein Gaul her? Ich werde verrückt. Liegt da einer neben dem Pferd?«
»Ich sehe keinen«, antwortet James. »Da links ist eine Spur. Der Gaul ist angebunden.«
»Siehst du das wirklich?«, fragt der ewig misstrauische Dorrey staunend. »Aber wo ist sein Reiter, he?«
»Das werden wir gleich wissen«, sagt Bruce und winkt Lispy heran. »Lispy, komm, wir wollen mal nachsehen.«
Das Gras dämpft den Hufschlag, als sie weiterreiten. Die anderen Drei kommen ein Stück nach, halten dann und sehen Bruce und Lispy absteigen.
Lispy schielt auf den dicken Packen, sieht Bruce an und fragt stotternd: »Wa – was mag wo – wohl da drin sein, Bruce?«
»Weiß ich das?«, knurrt Bruce.
»Und we – wenn er Geld ha – hat.«
»Hör mal, was hast du wieder für krumme Gedanken?«
»Krumm – krumme nicht, aber – ob er ei – ein Hemd ha – hat?«
»Lispy, lass die Finger davon. Vielleicht liegt der da oben auf den Felsen vor der Biegung und schießt, wenn er dich an den Packen gehen sieht.«
»Wi – will ja blo – bloß mal na – nachsehen.«
»Lass es, sage ich!«
Lispy zuckt zusammen, bleibt stehen und hebt die Hand. Links neben dem Pferd dicht am Rand der Schlucht, durch die der Fluss braust, liegen Stiefel, eine Hose, ein Hemd, ein Hut und Socken.
Als Bruce die Sachen dort liegen sieht, winkt er mit der Hand Lispy zu, sich zu ducken. Er sagt nichts, bückt sich und legt sich schließlich dicht vor der Kante hin. So schiebt er sich auf die Kante zu, linst durch das Gras nach unten und sieht Lispy wie einen Schatten neben sich auftauchen.
Im nächsten Moment, das Plätschern der Wellen ist zu hören, sehen sie den Mann unten. Er hat blondes Haar, mag so groß wie Lispy sein, und schwimmt gerade auf das jenseitige Ufer des Flusses zu. Anschließend hat er überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihn jemand beobachten könnte, denn er hat nichts an.
»Der ba – badet«, sagt Lispy stotternd. »Sch – schämt der si – sich nicht? Er ba – badet ohne Hose, Bruce?«
»Was willst du?«, fragt Bruce und rutscht zurück, denn der Mann kann nicht vor fünf Minuten wieder hier sein, selbst wenn er in diesem Augenblick umdrehen würde. Die Strömung ist scharf, der Fluss beinahe 100 Yards breit und der Hang steil. Er muss wohl gedacht haben, dass hinter der Biegung noch mehr Felsen kämen und ein Abstieg dort unmöglich sei.
»Bruce – ich ha – hab doch kei – kein Hemd, Mann!«
»Kommt nicht infrage. Wir wollen ein Geschäft machen, da können wir uns so was nicht leisten, ist dir das nicht klar? Wenn der uns folgt, was dann, he?«
»Kommt uns ni – nicht nach, Bru – Bruce. Ka – kann er au – auch so tun, wa – was? Sieht er un – unsere Fährte, dann wird er viel – vielleicht neu – neugierig, was?«
»Das ist gar nicht so verkehrt gedacht«, erwidert Bruce und richtet sich auf. »Also gut, sehen wir mal nach. Kein schlechtes Pferd, was?«
Er geht zum Pferd, schnallt den Packen ab, macht ihn auf und sieht etwas Proviant, zwei graue Hosen aus Cordstoff und vier rote Hemden.
»Alles ro – rote Hemden«, stellt Lispy fest. »Zwei sind sau – sauber. Die neh – nehme ich mir.«
Der Gaul, denkt Bruce und betrachtet das Pferd genauer, sieht nur gut aus, viel wert ist er nicht. Der Gaul taugt nichts, das ist ein Blender.
Lispy kichert, als er einen Geldbeutel findet. »Lei – Leichtsinn mu – muss be – bestraft werden«, stellt er kichernd fest. »Wer lä – lässt denn sei – sein Geld liegen, he? Bruce – sieh ma – mal her!«
»Mensch, das sind ja über dreißig Dollar«, sagt Bruce und streckt die Hand aus. »Gib her, Lispy.«
»Wa – was? Und ich?«
»Wir teilen, Lispy. Los, mach schon, lass ihm seinen Packen da. Klemm dir die beiden Hemden unter den Arm und wirf sein Gewehr hin.«
»Wo – wollte sie ja nu – nur mal a – ansehen«, sagt Lispy maulend. »Schön – schöne Uhr, ist wa – wahr. So – da liegt sie.«
Er legt sie hin, seufzt abgrundtief und bedauert, dass sie nur halbe Arbeit machen. Kaum aber hat er die Hemden und das Gewehr zu den anderen Sachen gelegt, führen sie das Pferd weg, als er daran denken muss, was er sagen würde, wenn er nach einem Bad heraufkäme und sein Gaul verschwunden wär.
»A – armer Hu – Hund«, sagt er vor sich hin. »Aber, wa – warum bist du lei – leichtsinnig, he? Dei – deine eigene Schuld, d-du Tro – Trottel.«
Er schwingt sich in den Sattel, stopft ein Hemd in seine Satteltasche, zieht sein durchschwitztes Hemd aus und das neue an.
Sie reiten mit dem Gaul jenes Fremden zu den anderen zurück.
»Da«, sagt Bruce knapp und hebt den Beutel hoch. »Über dreißig Dollar hat er gehabt.«
James, der nie viel sagt und manchmal für einen Dieb und Gauner seltsame Ansichten äußert, sieht ihn an und runzelt seine Stirn. Jetzt wirkt er noch düsterer. Er sieht aus, als käme er von seiner eigenen Beerdigung.
»Bruce, lass ihm wenigstens zehn Dollar.«
»Was, bist du verrückt?«, fragt Bruce verstört. »Weshalb denn? Wenn er so dumm ist und lässt alles oben liegen, dann muss er dafür bestraft werden. Noch mal lässt der seine Sachen nicht zurück, wetten?«
»Hör mal, Bruce, er hat kein Pferd und kein Geld mehr. Nimm ihm doch wenigstens nicht alles Geld weg.«
»Sieh mal an«, stichelt McDewey spitzzüngig. »Er hat es wieder mal mit der Moral, der gute James. Was denkst du? Würde dir das passiert sein, machte sich auch keiner Gedanken um dein Geld, sondern steckte es schön ein.«
»Halt die Klappe, Sid!«, knurrt James scharf. »Ich will das nicht, fertig. Bruce, sei mal anständig. Ich verzichte auf meinen Anteil von zehn Dollar an unserem Geschäft, klar?«
»Du hast Vögel unter dem Hut, was?«, sagt Dorrey. »Wegen eines Fremden auf zehn Dollar verzichten, das müsste mir einfallen.«
»Na gut«, antwortet Bruce, steckt das Geld bis auf zehn Dollar in seine Tasche, schnürt den Beutel zu und wirft ihn einfach an der nächsten kahlen Bodenstelle vom Pferd. »Das findet er schon, der Trottel. Darüber muss er ja stolpern, was?«
Sie reiten weiter, sind längst hinter der Biegung und kommen wieder an das Buschland. Ihre Entfernung zu jenem Platz, an dem sie den Mann bestohlen haben, mag über eine Meile betragen. Als sich James zufällig umsieht, erkennt er weit hinten eine Gestalt, die um die Biegung rennt. Die Sonne lässt den Gewehrstahl blinken. Der Mann bleibt stehen, hebt sein Gewehr und legt an.
»He, reitet schneller«, sagt James warnend. »Wenn es auch zu weit ist, ich habe es schon erlebt, dass auch eine zufällige Kugel traf. Der Kerl ist da.«
Der Mann muss sie einigermaßen sehen können. Die Kugel schlägt weit hinter ihnen ein. Der Mann feuert noch drei-, viermal hinter ihnen her, aber er trifft nicht.
»Jetzt weiß er, dass es fünf sind«, sagt Bruce mürrisch. »Das gefällt mir verdammt nicht. Er hat fünf Reiter gesehen und wird es überall erzählen.«
James antwortet. »Wo denn, he? Die nächste Ranch ist dreißig Meilen entfernt. Ehe er dort ist, ist es übermorgen. Es gibt Zufälle genug, aber dass ausgerechnet noch jemand außer ihm hier herumreiten sollte, kann ich mir nicht denken. Was wollen wir denn mit dem Gaul machen, Bruce?«
»Stehen lassen, irgendwo und weit genug entfernt«, antwortet Bruce achselzuckend. »Der bringt keine zwanzig Dollar ein, sieh ihn dir genau an, dann weißt du es.«
James überlegt einen Moment, dann nickt er, sagt aber warnend: »Lass uns etwas weiter nach Norden reiten, damit es aussieht, als wollten wir woandershin. Sobald wir dann an den Flathead kommen, reiten wir ein Stück nach Norden, das wird erst in der Dämmerung sein. Dort lassen wir den Gaul stehen und reiten zurück im Wasser.«
»Ja, er wird uns dann im Norden vermuten«, antwortet Bruce zufrieden. »So geht es. Einen Tag wollen wir uns die beste Ranch ansehen. Also noch insgesamt zwei Tage, dann haben wir, was wir wollen. Der Kerl kommt uns nicht mehr in die Quere.«
*
Dorrey hat keine schlechte Laune mehr, er ist eher ausgesprochen guter Stimmung. Das ist er manchmal, wenn er etwas sieht, was ihm gefällt. Diesmal ist es das Mädchen.
Er stiert aus sieben Yards Entfernung in das Eckzimmer der Ranch und leckt sich über die Lippen. Das Mädchen steht vor dem Spiegel. Und es ist ein Glück, dass es dunkel ist, sonst würde sie Dorreys dickes Gesicht mit den Glotzaugen sehen müssen. Das Mädchen kämmt sich. So langes Haar hat Dorrey selten gesehen, und so schwarzes eigentlich noch nie.
»Komm schon«, zischt McDewey hinter ihm. »Was ist schon an einer Frau dran, he? Am Ende bist du doch der Dumme, das ist immer so.«
»Bei der nicht, ei, verdammt, ist das ein Vögelchen«, sagt Dorrey anerkennend.
Da trifft ihn McDeweys warnender Blick. Hinter ihnen taucht Bruce auf und sieht sofort, was los ist, warum Dorrey wie hypnotisiert in das Fenster starrt.
»Du Idiot«, sagt er grimmig, wenn auch sehr leise. »Kaum sieht er einen Unterrock, vergisst er alles um sich. Du sollst zum Anbau, hatte ich das nicht gesagt?«
Die Stimme von Bruce klingt so drohend, dass Dorrey den Kopf einzieht und wirklich losgeht. Dabei aber denkt er immer noch an das Mädchen, schleicht am Zaun entlang, einem einfachen Staketenzaun, und muss am Bunkhaus vorbei, in dem kein Licht brennt. Der Anbau der Ranch ist noch 17 Yards entfernt.
Im Anbau klappert jemand mit Geschirr. Die Leute haben heute spät gegessen, weil der Rancher den Rest seiner Herde von der Wasserstelle wegtreiben musste. Sonst ist niemand hier.
Es ist genauso, wie Bruce es im vorigen Monat gesehen hat. Die Corrals sind leer, die Mannschaft treibt die Herde an die Bahn. Über den Hof ist ein alter, hinkender Mann gegangen, anscheinend ein Ranchhelp, der wegen seines Alters nicht mehr am Trail teilnimmt. Außer den Mädchen sind also nur zwei Mann auf der Ranch, es wird nicht sehr schwierig sein, das denken sie alle.
Dorrey, der wie die anderen sein Pferd hinter den Büschen am Bach zurückgelassen hat, geht langsam und vorsichtig auf den Anbau zu. Das Fenster, das den ganzen Tag aufstand, ist noch offen. Hier ist die Ranchküche, das Geklapper aus dem Fenster schallt ihnen entgegen.
Lispy, der schnellste und auch beweglichste Mann von allen, schiebt sich an Bruce Murdocks Seite und deutet auf ein Fenster. Bruce hält ihn am Ärmel fest, zischt einmal und bringt dadurch alle Mann zum Stillstand.
Sie stehen alle ohne Stiefel da, nur drei Paar Socken an den Füßen, die jeden Schritt so dämpfen, dass sie kaum zu hören sind.
»Lispy, du musst zuerst hinein, klar?«, zischelt Bruce. »Steig ein, aber pass auf, er darf dich nicht sehen. Denk an die Milchkannen. Stell dich neben die Tür. Wenn wir es schaffen, kommt James mit. Sonst musst du es allein tun, klar?«
»Klar«, erwidert Lispy nur, der wie eine Katze schleichen kann und für den es nicht schwierig sein wird, durch das Fenster in den Butterraum neben der Küche zu steigen.
Bruce Murdock aber dreht sich um, streckt die Hand aus und sieht James an.
James, der einen langen Stock trägt, den sie von den Zweigen befreit haben, reicht den Stock Murdock. Vor ihnen schieben sich nun Dorrey und McDewey an der linken Wand des Anbaues entlang, bis sie hinter dem Holzstapel kauern und in den Hof blicken können. James und Lispy huschen auf das Fenster zu. Lispy steht rechts, James links. Es fällt nur mattes Licht aus der Kammer, die Verbindungstür zur Küche steht etwas offen. Lispy, der wie ein Geist hochwächst und in den Raum blickt, sieht die Tür, die Bank mit ein paar Käseformen direkt unter dem Fenster und nickt.
»Kommst du ohne Krach hinein?«
»Sicher, James.«
Neben ihnen kauert Bruce Murdock, hört es und ist zufrieden. Dann schleicht Murdock weiter. Zwischen dem Anbau und dem rechten Winkel des Hauses ist eine Art Verschlag, der eine schmale Tür besitzt. Im Verschlag liegen die Eisenrohlinge für Hufbeschlag, die Esse steht dort, die Verschlagecke ist etwas vorgebaut und bietet Murdock, der durch die nur angelehnte Tür getreten ist, eine gute Deckung.
Im nächsten Augenblick zeigt es sich, dass Murdocks Berechnungen, die auf James’ Augenmaß beruhen, richtig gewesen sind. Murdock streckt nun den rechten Arm mit der langen Stange aus. Links von Murdock fällt das Licht aus der Küche in den Hof. Rechts aber stehen Milchkannen auf einem Gestell. Die Kannen, die der Rancher und der alte Ranchhelp heute von der Weide mitbrachten, sind ausgewaschen worden. Nun sollen sie über Nacht trocknen.
Murdocks Stock erreicht die erste Kanne. Er grinst, er hat ein wenig Freude an sich selber und an seinen glatten Gedanken.
Murdocks Berechnungen haben bis heute immer gestimmt. Kein Mensch hat sie jemals verdächtigt, keiner sie jemals gefunden. Es wird auch hier so sein, denn Murdock ist ein Meister darin, die Reaktion anderer Leute vorauszuberechnen.
Nun ist der Stock an der Kanne, und Murdock stößt auch schon den Stock vorwärts.
Die Kanne kippt, dann donnert sie vom Gestell auf den Boden und rollt klappernd drei Yards weit. Im gleichen Moment zieht Murdock seinen Stock zurück. Während er den Stock zu Boden gleiten lässt, weicht er hinter den Vorsprung des Anbaues zurück.
Kaum klappert es auf dem Hof, als jedes Geräusch in der Küche verstummt.
Lispy, der langsam an das hintere Fenster tritt, hört einen Moment nichts mehr aus der Küche. Dann aber sagt der Alte dort brummelnd: »Was war denn das? Sollte das wieder der Kater sein?«
Schritte sind in der Küche zu hören, ein Schatten verdunkelt jenen breiten Lichteinfall in den Hof. Murdock, der den Schatten genau sieht, rührt sich nicht.
»Tatsächlich, hat der Bursche doch wieder auf den Kannen gehockt«, sagt der Alte mürrisch. »Na warte, Freundchen, das gewöhne ich dir noch ab. Sie riechen die Milch selbst dann noch, wenn die Kannen ausgewaschen sind. Dabei haart das Vieh, ich werde sie noch mal auswaschen können. Der verdammte Kater.«
Und dann geht er los.
Der erste Teil von Murdocks Plan erfüllt sich. Der Alte humpelt zur Kanne, hebt sie auf, nimmt sie in die Hand und geht los, nachdem er noch einen Moment nach dem Kater gesucht hat, der irgendwo verschwunden ist.
Brummelnd kommt der Alte auf die Tür des Küchenanbaues zu.
Lispy hat sich an der Wand hochgezogen, kauert eine Sekunde auf dem Fensterbrett und tritt dann auf die Bank, die leicht wackelt. Aber es gibt kaum ein Geräusch. Sekunden später, der Alte draußen hat noch nicht einmal die Kanne erreicht, zieht Lispy geräuschlos die Verbindungstür auf.
»James, komm!«
James, hager, groß und sehnig, klettert so schnell wie Lispy über die Bank hinweg. Dann sieht er Lispy kurz an, blickt durch die nun offene Tür auf jene andere, durch die der Alte verschwunden ist, und sagt zischend: »Bleib du hier stehen, du tust das nicht gern, ich weiß. Warte, ich habe ihn gleich.«
Er macht drei Schritte, kommt geduckt durch den Raum, tritt hinter die offen stehende Außentür und sieht, wie Lispy die Verbindungstür wieder halb zuschiebt.
Nichts scheint sich in der Küche verändert zu haben. Und doch sind zwei Männer drin, die sich vollkommen still verhalten.
Die Kanne klappert, als der Bügel an das Metall schlägt. Die Schritte schlurfen unregelmäßig über den Hof auf die Tür zu.
»Noch mal auswaschen«, brummelt der Alte und kommt in seine Küche. »Der Teufel soll den Kater holen, ich werde ihm eine Blase an den Schwanz binden, was?«
Dann ist er auch schon im Raum. Er geht einen Schritt an James vorbei, der die Hand aus der Tasche genommen hat. Die schlurfenden Schritte des Alten führen nun zum Herd, auf dem ein Kessel mit heißem Wasser steht. Im gleichen Augenblick, in dem sich der Alte gerade nach dem Schöpfbecher bückt, tritt James mit drei, vier schnellen katzenhaften Schritten von hinten auf ihn zu.
James, das Halstuch vor dem Gesicht, in das zwei Löcher geschnitten sind, holt jäh mit der rechten Hand aus. Zwar reibt sich der Stoff seiner Jacke, aber der Alte hört nichts. Dann saust die Hand mit dem runden, länglichen Gegenstand herunter.
Einen Moment denkt James an das Alter des Mannes, aber er hat keine andere Wahl. Sachen wie diese hat er schon zu oft getan, der Gedanke ist gleich wieder fort. Dafür schnappt James mit der linken Hand blitzschnell zu. Es ist ein so sicherer Griff, dass der Alte, der nach vorn stürzt, nicht mehr auf den schweren Herd schlagen kann.
Ohne einen Laut von sich zu geben, nur die Kanne kracht hin und der Schöpfbecher klappert zu Boden, rutscht der Alte zusammen.
Aus dem Butterraum aber kommt Lispy, er nimmt die Kanne, es ist wieder still.
»In Ordnung«, sagt James dann leise. »Da haben wir ihn ja. Los, mach schnell, stell die Kanne zur Seite und fass an. Wo ist der beste Platz für ihn?«
Er sieht sich um, während hinter dem Anbau Murdock herauskommt. Er starrt zum Haus, aber dort, das Licht brennt in einem der oberen Zimmer, rührt sich nichts. Zwei Sekunden darauf steht auch Murdock wie ein Geist in der Küche.
»Die Bank«, sagt James flüsternd, »ist sehr schwer. Er kann sie nicht von der Stelle bekommen, wenn wir sie an die Schrankfüße binden, na?«
»Ja, los.«
Es geht schnell. Sie fesseln den Koch und legen ihn auf die Bank. Dabei starrt Lispy ununterbrochen zum Haus, aber alles bleibt friedlich und still.
Nach kaum drei Minuten sind sie fertig und sehen sich an.
»Zum Haus!«, zischt Bruce Murdock kalt. »Lispy, der frisst hier.«
Sie sehen alle zu Lispy. Von ihm sagen sie, dass er verfressen sei. Lispy hat sich in der Küche umgesehen und ein Stück Rinderbraten entdeckt. An dem kaut er und sieht die anderen unschuldig an.
»Wa – was ist?«
»Mensch, wie kannst du schon wieder fressen?«
»Wenn ich doch Hu – Hunger hab?«
»Er hat Hunger, der verdammte Idiot«, zischt McDewey böse und wirft Lispy einen giftigen Blick zu. »Der hat immer Hunger. Selbst wenn sie ihn eines Tages aufhängen, wird er noch was fressen müssen.«
Lispy hält in der Kaubewegung inne und macht einen jähen Schritt auf McDewey zu.
»Du – d-d-duuu!«, sagt er stotternd vor Erregung und ist ganz blass geworden. »Da – das sagst du nicht no – noch mal. Hä – hängen – da – das ist ver – verdammt kein Wort, da – das ich hören will.«
»Sieh an, davor hat er Angst, der Träumer«, antwortet McDewey giftig. »Kann dir schon passieren, dass sie dich hängen, Lispy. Mach bloß nie dein Maul auf, wenn wir irgendwo sind, hier auch nicht, ich rate es dir. Sonst erkennen sie dich überall. Einer, der so stottert wie du – das ist ’n Stottergraf. Hähäh – Stottergraf …!« Und er will sich krank lachen, weil Lispys Gesicht erstarrt und blass geworden ist.
»Stottergraf!«, zischt Bruce Murdock und dreht sich ihm zu. »Lass den verdammten Unsinn, lass ihn in Ruhe. Er kann nichts für sein Gestotter, das weißt du so gut wie ich. Lass ihn in Frieden, ohne ihn hätten wir manches Pferd nicht – äh, besorgt, was? Und du kein Geld in den Taschen gehabt, mit dem du hättest klimpern können. Lass deine Wut nicht an Lispy aus, der wehrt sich nie.«
»Ha – hab ihm ni – nichts getan«, sagt Lispy und wendet sich ab. »Ma – Mann – ich ha – hab doch blo – bloß ge – gegessen, Boss.«
»Ja, Lispy, ist ja schon gut«, antwortet Bruce Murdock besänftigend. »Nun Schluss mit dem Streit. Die Lady ist hinten in einem Zimmer, der Alte im ersten Stock, und die Nacht dunkel. Uns kann nichts mehr passieren, nicht hier draußen. Macht schnell, huscht zum Haus.«
So schnell sie können, hasten sie über den Hof.
Lispy steht schon am Haus. Hinter ihm James, der leise sagt: »Warte, bis Bruce die Tür aufgemacht hat, Junge.«
Lispy schreckt zusammen, als James ihm einen kleinen Stoß gibt.
»Lispy, los, vorwärts.«
James hinter ihm, so kommen sie leise wie Geister in das Haus hinein.
Von nun an sprechen sie sich nur noch mit Nummern an, ziehen die Halstücher hoch, stehen im Flur und sehen sich um.
»Zwei«, flüstert Murdock und meint McDewey. »An die Treppe nach oben. Drei, komm jetzt.« Damit ist Lispy gemeint.
Ein langer Flur, rechts zwei Türen, links ein kleiner Flur. An seinem Ende, bis zu dem das Licht der kleinen Flurampel nicht reicht, ein Streifen Helligkeit unter einer Tür.
Das Zimmer, in dem das Mädchen sich die Haare gekämmt hat.
»Vier, du bleibst neben der Tür stehen, klar?«
Vier, das ist James. Nummer fünf ist Dorrey, aber der hat eine andere Aufgabe. Dorrey ist in der Küche hinten auf dem Hof.
Murdock hebt die Hand, deutet rechts neben die Tür. An dieser Seite ist das Schloss.
Hinter der Tür klappert etwas, das Mädchen summt irgendeine Melodie vor sich hin. Neun Uhr erst, im Haus schlägt es dumpf die volle Stunde.
Lispy steht neben der Tür und sieht Murdock im Zwielicht seltsam an.
Im Zimmer sind deutlich Schritte zu hören, die schnell auf die Tür zukommen.
Da geht plötzlich die Tür auf. Er hat nicht an die Lampe im Zimmer gedacht, der Lispy. Die Lampe bescheint ihn. Und das Mädchen, das aus der Tür in den Flur sieht, blickt ihn an, sieht einen Mann im roten Hemd, der ein Tuch vor dem Mund trägt und den Hut tief in die Stirn gezogen hat.
Vielleicht will sie etwas sagen, aber sie macht nur den Mund auf. Murdock ist schneller, seine Hände greifen zu. Was immer das Mädchen sagen will, es wird nichts als ein heiserer, halberstickter Laut. Murdock aber, der ihr die Hand vor den Mund hält, drängt sie blitzschnell zurück und sagt zischend: »Keinen Ton, nicht schreien, dann passiert nichts.«
In diesem Moment übersieht Murdock etwas – die Hände dieses Mädchens, die durch die Luft fahren. Er sieht auch den Kleiderständer nicht. Linker Hand steht ein Eisengestell, an das die Lady greift. Und dann passiert es. Ihre linke Hand reißt den Ständer herum. Der kippt samt dem Hauskleid, das an ihm hängt, zur Seite und knallt Murdock auf den Kopf. Murdock sieht eine Sekunde lang Sterne. Dann rutscht der Ständer ab und fällt auf Murdocks Arme.
Das Mädchen aber, das wieder Luft bekommt, weicht mit einem gellenden, schrillen Schrei zurück. »Vater, Hilfe! Banditen! Vater, Hilfe, Banditen!«
Dann kommt Murdock schon wieder zu sich, stößt sie auf das Bett und presst sie in die Kissen.
Was, denkt Lispy und sieht James in den Raum kommen, mein Gott, was wird das?
Der Schrei ist durch das Haus geschallt, oben poltert es irgendwo.
Auf halber Höhe der Treppe duckt sich McDewey am Geländer und hält entsetzt den Atem an. Der Schrei muss den Mann oben alarmieren. Der Rancher wird kommen. Da poltert es schon.
Schritte sind oben auf dem Flur zu hören. Licht fällt auf die Treppe aus einem Zimmer.
»Anne, Anne, was ist? Anne, antworte!«
Keine Antwort, alles still unten.
McDewey hat den Revolver in der Faust, einen ganz trockenen Mund und starre Augen bekommen.
Es sieht gruselig genug aus, als der Schatten im Lichtschein auftaucht und über die Treppenstufen geworfen wird. Der Mann hat eine Waffe. McDewey sieht es am Schatten, sieht den Arm und in der Hand die Waffe.
Dann sind schnelle Schritte auf den ersten Treppenstufen, der Rancher kommt herunter, rennt wie ein Wilder, erscheint an der Biegung und wird von hinten beleuchtet.
Und dann sieht er den Mann unten kauern, sieht McDewey dort, reißt den Arm hoch.
McDewey schießt, als der Rancher den Arm hebt. Er sieht ihn gegen das Licht so deutlich, dass er gar nicht vorbeifeuern könnte, selbst wenn er ein miserabler Schütze wäre. Brüllend ist der Knall im Flur, der McDewey dreimal lauter als ein normaler Abschuss vorkommt. Blitz und Feuer in dem Zwielicht, aber von oben auch ein Knall und das Fauchen der Kugel so haarscharf an McDeweys Gesicht vorbei, dass die Augen McDeweys entsetzt zucken.
Großer Gott, so knapp, so dicht vorbei.
McDewey duckt sich, sieht den Mann gegen das Geländer prallen, hat den Revolver immer noch auf ihn gerichtet. Dann rutscht der Rancher vom Geländer ab, ganz langsam, als wolle er gar nicht fallen. Dann aber neigt er sich, stürzt auf die Stufen und beginnt zu rutschen.
Der Rancher poltert die Treppenstufen herab, er überschlägt sich zwei-, dreimal, bis er genau vor dem kauernden McDewey, der sich mit dem Rücken an die gedrehten Stäbe des Treppenaufganges presst, still am Absatz liegt.
Er hat ein weißes Hemd an. Und auf dem Hemd sieht McDewey den Fleck.
Der Mann ist ohnmächtig. Tot kann er nicht sein, die Kugel sitzt zu hoch in der Schulter.
Unten aber sagt jemand fauchend: »Hast du ihn, Zwei?«
McDewey bewegt die Lippen. Es kostet ihn Mühe, zu sprechen, er formt die Worte ganz langsam und schwerfällig.
»Ja, ich habe ihn, er liegt hier, ist aber nicht tot.«
»Dein Glück, bleib da, wir kommen gleich.«
Unten ist das Mädchen und sieht zwei Männer, fühlt den Ruck an ihren Händen und hört die Worte des einen Mannes. Als man sie umdreht und ihr ein Tuch vor die Augen binden will, sieht sie wieder für einen Bruchteil einer Sekunde den einen Mann in der Tür, den Mann im roten Hemd und sonst nichts. Dann wird es dunkel vor ihren Augen.
Der Mann im roten Hemd, das Rot des Stoffes hat ihre Blicke angezogen, wird ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Sie wird ihn nicht vergessen, als sie nach neun Stunden endlich von den Fesseln loskommen kann.
Sie wird ihn auch nicht vergessen, als sie ihren Vater und den alten Ranchhelp findet.
Dann wird sie vor dem aufgebrochenen Schreibtisch stehen und kein Geld mehr in der Schublade finden. Die 2000 Dollar sind fort. Genau wie elf Pferde, ausgerechnet die besten Pferde, die nie auf einen Rindertrieb mitgenommen werden.
Elf Pferde und 2000 Dollar …
Und ein Mann im roten Hemd, ein blonder Mann, bei dem eine Haarsträhne unter dem Hut zu sehen war, dessen Brauen hell waren.
Lispy hat gar nicht zu reden brauchen, man weiß nun, wie er aussieht, auch wenn man seinen Namen nicht kennt. Lispy ist der Mann im roten Hemd. Der Bandit ist er, den man suchen wird.
Aber wen werden sie finden …?
*
Er reitet genau zu dem Balken und sieht sich im Absteigen um.
Der Mann steht immer noch vor seiner Schmiede, die fleckige braune Schürze vor dem dicken Leib, den Hammer in der rechten Hand und den Mund offen.
Der Mann starrt ihm nach und regt sich nicht. Aus den Augenwinkeln sieht Kenneth Cord die Frau drüben vor der Bäckerei. Die Lady hat ein etwa neunjähriges Kind an der Hand und sieht zu ihm hin, genau wie der Schmied.
»Teufel«, sagt Kenneth halblaut und sieht an sich herab. »Fehlt mir was, habe ich eine zerrissene Hose, sieht mein Hemd hinten heraus, oder was ist sonst? Was haben die Leute, warum sehen sie mir nach?«
Es ist alles in Ordnung. Und doch starren ihm diese Leute nach. Aber vielleicht irrt er sich auch?
Kenneth geht los, blickt einen Moment zum Schild empor, auf dem Charles Morgan steht. Morgans Store in einem Nest, das aus sieben Häusern besteht. Tabak, denkt Kenneth, endlich wieder Tabak haben und dann fragen, wo ich hier überhaupt bin. Der Teufel soll sie holen. Diese Gauner, wenn ich die erwische, ich schlage ihnen so auf das Maul, dass ihre Zähne im Bauch Klavier spielen. Klauen mir mein Geld und lassen mich 20 Meilen zu Fuß rennen, ehe ich mein Pferd finde. Wenigstens zehn Dollar haben sie mir gelassen.
Er tritt durch die Tür in den halbdunklen Store, wo es nach Petroleum, getrockneten Pflaumen, Gewürzen, Stoffen und auch nach Leder riecht.
Hinter dem Tresen steht ein Mädchen, keine zwölf Jahre alt, mit langen Zöpfen und einer Stupsnase, auf der ein paar Sommersprossen sind.
»Hallo«, sagt Kenneth freundlich. »Nun, mein Kind, wie heißt dieser schöne Platz?«
Das Mädchen blickt ihn an und lächelt auch.
»Durham, Mister«, erwidert sie. »Dies ist Durham in Montana, Sir. Sie sind fremd, nicht wahr?«
»Das will ich meinen«, antwortet Kenneth und sieht in einem Verschlag ganz hinten, in dessen Wand ein Fenster ist, zwei Männer sich bewegen. Sie blicken zu ihm hin, aber was sie reden, das hört er nur als Gemurmel. »So, Durham in Montana. Und welche größere Stadt haben wir in der Nähe? Ich meine, wo ist hier ein Sheriff?«
»In Missoula, Sir«, erwidert sie. »Das ist dreißig Meilen von hier entfernt. Dort haben wir den Sheriff. Dies ist das Missoula-County, Sir.«
»Aha, na schön, dann weiß ich Bescheid«, sagt Kenneth und sieht, wie der eine Mann kurz aus der Tür des Verschlages blickt, um dann wieder zu verschwinden. »Habt ihr Wells und Fargo-Tabak zu verkaufen?«
»Aber gewiss, Mister. Wie viel darf es denn sein?«
»Fünf Unzen.«
Sie nickt und steigt auf eine Leiter, um den Tabak aus dem Regal zu nehmen.
»Verpflegung brauchte ich auch ein wenig«, sagt Kenneth, hört hinten die Tür klappen und sieht einen kleinen, schmalbrüstigen Mann mit einer randlosen Brille, einem Kneifer, den er halb auf die Nase gerutscht trägt, langsam hinter dem Tresen herankommen. Der andere ist nun gegangen. Der kleine Mann lächelt, streckt die Hände aus, hebt das Mädchen herunter und sagt mit einer sehr hohen Stimme: »Schönen Tag haben wir heute, was Fremder? Nun, geh schon zu Mutter nach oben und hilf ihr bei der Wäsche, Tochter. Ich habe genug mit Mr Farlow geredet.«
»Aber Dad, Ma wird schon fertig …«
»Gehst du wohl?«, sagt er beinahe zornig. »Gehorche, wenn ich dir etwas sage, Tochter. Marsch, zu Mutter, du brauchst mir heute nicht mehr zu helfen. Wirst du wohl?«
Sie zuckt zusammen und verschwindet hastig aus dem Store.
»Ein Kreuz, wenn sie älter werden«, sagt der kleine Mann jammernd und sieht Kenneth an. »Solange sie klein sind, da ist alles einfach, aber wenn sie erst größer werden … Nun, Sie kennen das sicher, Mister, wie?«
»Ich habe keine Frau, Mr Morgan«, erwidert Kenneth achselzuckend. »Aber es kann schon sein, dass Sie recht haben. Ihre Tochter sagte mir, es wären dreißig Meilen bis Missoula, ist das wahr?«
»Ja, sicher doch«, gibt Morgan zurück und reibt sich die Hände, als fröre er. »Das ist der County-Sitz, Mister. Was darf es denn außer dem Tabak noch sein, Verpflegung? Für Sie, Mister, oder …«
»Nun, für mich, für wen sonst?«, murmelt Kenneth Cord. »Ich bin nicht grade reich, jemand hat mir … Mr Morgan, sind hier vielleicht in den letzten Tagen fünf Männer durchgekommen?«
Morgan, der kleine Kerl mit dem Kneifer, zuckt zusammen und sieht ihn kurz an, dann dreht er sich um und hantiert am Regal.
»Fünf Männer, Mister? Nein, ich habe keine gesehen. Warum?«
»Nun, ich will etwas von ihnen«, sagt Kenneth, dem es nicht liegt, über sein Pech zu sprechen, weil man höchstens darüber lachen würde. »Vielleicht kennt der Sheriff in Missoula sie. Morgan, geben Sie mir Rauchfleisch, ein halbes Brot und noch etwas Schmalz. Ich muss heute noch ein ganzes Stück reiten.«
Morgan bedient ihn umständlich, stößt einen Stapel Kartons um und schimpft leise vor sich hin, als er sie wieder aufstellt.
»Entschuldigung, Mister, manchmal hat man seinen schlechten Tag, was?«, sagt Morgan heiser. »Kommen Sie von weit, Mister?«
»Ziemlich, Morgan, aus Washington herüber. Ich dachte, weiter nach Osten zu müsste es Arbeit geben. Ich bin Pferdemann, Fänger für Wildpferde.«
Morgan hustet bellend, hält sich die Hand vor den Mund und verschluckt sich beim Husten.
»Pferdefänger?«, fragt er dann krächzend. »Da müssen Sie schon weiter nach Süden reiten. Dort sind genug Ranches, die Pferde züchten.«
»Auch ein paar große Ranches? Kleine stellen um diese Zeit noch keine Leute ein, man wartet immer auf die Trockenheit, die die Pferde zu den Tränken locken, erst dann beginnt man mit dem Fang. Im Augenblick kann ich nur auf einer großen Ranch Arbeit finden, denke ich. Liegt eine größere Ranch im Süden?«
»Ja, da gibt es zwei, gar nicht so weit von hier im Süden. Die Colbrane-Ranch und die von Roy Tiffin. Der fängt auch Pferde, er beschäftigt immer einen Haufen Leute.«
»Und wo liegt die Ranch, Morgan?«
»Am Rock Creek, etwa neunzig Meilen von hier, Sir. Eine schöne große Ranch mit den prächtigsten Pferden in dieser Gegend. Araber-Aufzucht, Mister. Es sind wundervolle Tiere.«
»Ah, dann werde ich sie mir ansehen«, erwidert Kenneth. »Danke, Morgan, das ist alles. Was bin ich schuldig?«
»Drei Dollar und vierundzwanzig Cent«, gibt Morgan zurück. »Soll ich nicht einwickeln?«
»Das stecke ich schon in meine Satteltasche. Also, einen schönen Tag noch.«
»Auch so, Mister, auch so. Und gute Reise, Mister.«
Kenneth geht nach draußen und hört es links von sich klicken.
Und dann sieht er den Mann auch schon!
Es ist der Schmied, der links von ihm hinter der Hausecke herausgetreten ist und die beiden Läufe einer Schrotflinte auf ihn gerichtet hält.
»Streck die Arme hoch, Bursche!«, sagt der Schmied fauchend und zielt mitten auf Kenneths Bauch. »Schnell, hoch mit ihnen, sonst bist du ein Sieb!«
»Was soll das?«, fragt Kenneth Cord verblüfft. »Mister, ist das kein Irrtum?«
»Nimm die Hände hoch!«
Die Tür rechts neben ihm, die weit offen war, knarrt leicht.
Hinter ihr tritt der zweite Mann heraus und hat einen Revolver in der Faust. Er ist drei Schritte hinter Kenneth, eine tödliche Entfernung, wenn er abdrückt. Der Mann trägt eine mit Mehlstaub gepuderte Schürze vor dem Bauch und sieht nicht gerade friedlich aus.
»Leute, das ist …«, beginnt Kenneth.
»Keinen Trick. Streck sie hoch, sonst saust du in die Hölle!«, knurrt der mit der Mehlschürze. »Hoch mit den Händen, ich drücke sonst ab.«
Der Wind packt die Tür. Der Mann macht einen Schritt nach links. Die Tür geht so weit auf, dass Kenneth Cord den roten Fleck auf ihr sehen kann, ein Plakat!
Da sind die Blicke der Männer, da sind zwei, drei andere, die über die Straße auf ihn zulaufen und Gewehre in den Händen halten. Er sieht in ihre grimmigen, entschlossenen Gesichter und in die Mündung ihrer Waffen. Und er blickt auf das Plakat, auf dem groß und breit steht, dass man fünf Männer sucht. Ganz oben aber steht die Beschreibung eines Mannes – seine Beschreibung.
In der Sekunde, in der er es erkennt, ist der Schmied mit seiner Schrotflinte auch schon hinter ihm und drückt ihm die Mündung in den Rücken.
»Streckst du sie jetzt hoch, du verdammter Bandit?«
Die Dose mit dem Schmalz rollt über den Gehsteig, das Päckchen Tabak klatscht hin. Rauchfleisch und Brot fallen auf die Gehsteigbretter.
Er hebt die Hände und hört im Store den kleinen Morgan schreien, dass die Stimme fistelnd überkippt: »Er ist es, der verdammte, freche Schurke. Er hat mich nach einer Pferderanch gefragt, auf der nur gute Pferde sind. Und meine Tochter hat er nach dem Sheriff ausgehorcht. Wie weit es bis zum Sheriff wäre, hat er gefragt, der Lump, damit er sicher sein kann, dass der Sheriff auch nicht in der Nähe ist. Habt ihr ihn? Ah, da ist er ja, der Bursche.«
Und dann baut er sich vor ihm auf, während Kenneth Cord noch immer auf das Plakat starrt und den Text liest. Ein blonder, großer, schlanker Bursche wird gesucht, einer, der ein rotes Hemd trägt!
Blond, ein rotes Hemd!
Das ist es. Plötzlich weiß er es. Er denkt an seine verschwundenen Hemden, an den Kerl, der sie getragen hat.
Achthundert Dollar Belohnung. Sie haben elf Pferde gestohlen und über 2000 Dollar mitgehen lassen. Und den Rancher niedergeschossen – den Rancher John Crane.
»Leute«, sagt er plötzlich stockheiser und fühlt, wie ihm hundeschlecht wird. »Leute, es ist ein Irrtum. Ich gehöre doch nicht zu denen, ich …«
»Du schmutziger Lügner!«, schreit der kleine Morgan schrill und fuchtelt ihm drohend mit der Faust vor dem Gesicht herum. »Du verdammter, windiger Schurke, den Trick kennen wir. Aber nicht mit uns, das sage ich dir. Sich erkundigen, Arbeit suchen wollen, was? So einen faulen Trick kannst du mit anderen machen, aber nicht hier. Ja, der Sheriff ist in Missoula, und genau dort kommst du hin.«
»Geh da weg, er ist gefährlich, da steht doch, dass sie rücksichtslos schießen«, sagt der Schmied laut. »Geh zur Seite, Charlie. Wir haben ihn. Achthundert Dollar Belohnung, was? Verdammt, wenn die anderen in der Nähe sind? He, du, wo sind deine Kumpanen?«
Sechs, sieben Männer sind inzwischen da. Kenneth hat das Gefühl völliger Leere in sich, als er sie reden und schimpfen hort.
»Schnell, bindet ihn, vielleicht sind die anderen in der Nähe. Macht schnell.«
800 Dollar …!, denkt Kenneth entsetzt, das ist viel Geld für die Leute hier. Sie haben sich die Belohnung verdient!
Im selben Augenblick sieht er die Lider des einen Mannes links sich weiten. Instinktiv duckt er sich, aber da trifft ihn auch schon ein Hieb.
»Ich war’s nicht!«, schreit er noch. »Ich war es nicht.«
Dann kommen die Bretter auf ihn zu, und jemand ruft: »Dir werden wir helfen, friedliche Leute einfach niederzuschießen, Bursche. Mit Pferdedieben machen wir kurzen Prozess.«
Er sieht Stiefel vor sich, jemand landet auf seinem Rücken. Ein Stiefel kommt auf ihn zugeschossen. Dann ist der Schmerz da. Er kommt nicht mehr hoch. Es sind zu viele, die auf ihm kauern und auf ihn einschlagen.
Sie haben ihn, den Mann, der gesucht wird. Da liegt er, der Pferdedieb mit dem roten Hemd – Pferdediebe hängt man …!
*
Er sieht den Mann an, der in der Dunkelheit dieses Hofes nichts als ein Schatten ist. Sie haben ihn mit Stricken umwickelt, dass er wie ein Paket verschnürt ist. Ein Mann steht am Stall, der zweite liegt hinter der Luke im Schuppen. Der dritte Mister hockt auf der Schwelle der Haustür und hat das Gewehr über den Knien.
Es ist schon eine Stunde dunkel, einer der Männer seit vier Stunden unterwegs zur Stadt. Sie haben ihn sitzend an den Zaun gebunden und nicht etwa in eins der Häuser gebracht. Er soll hier draußen sterben, haben sie gesagt. Sie werden schießen, sobald seine Partner kommen und ihn vielleicht zu befreien versuchen, auch das haben sie ihm versprochen. Zeigt sich einer seiner Partner, dann wird die erste Kugel ihn treffen. In diesen Hof kann man nur von einer Seite aus kommen, nach links hin ist er offen. Wer immer dort heranschleicht, sie werden ihn sehen und ihm sagen, dass er keine Chance hat, ihn zu befreien.
Eine Falle für jeden, der den Gefangenen befreien will, genau das ist es.
Als sie ihn an den Zaun banden und er stehen musste, ohne Hut, die Sonne des Nachmittages auf dem Kopf, der immer noch schmerzt, ist er nach drei Stunden in den Stricken zusammengebrochen. Sie haben gelacht und ihn beschimpft. Er ist ein Banditenhund für sie, und sie sind stolz darauf, einen dieser Halunken, die anderen Pferde stehlen und sie niederschießen, erwischt zu haben.
Ihre Reden, denkt er bitter, diese verdammten Narren, was sie alles geredet haben. Gelacht haben sie, als ich ihnen erzählte, dass man mich bestohlen hätte und ich darum nach dem Sheriff fragte, einfach ausgelacht.
Als er sie angeschrien hatte, kamen sie mit einem Knebel und haben ihn erbarmungslos zwischen seine Zähne gezwängt.
»Jetzt hältst du dein Maul, was, Bandit? Merk es dir, du Dieb, wenn der Richter nicht zufällig der Bruder von Crane wäre, dann würden wir dich gleich hier aufgehängt haben. Aber die wollen dich lebend. Wo sind die anderen, spuck es in den Sand. Los, rede!«
Sie haben den Knebel herausgerissen, ihn angebrüllt, mit der Faust unter seiner Nase herumgefuchtelt.
»Ich kenn sie doch nicht, die haben mich bestohlen, ich schwör’s euch, die haben mich auch bestohlen. Einer von denen hat meine Hemden.«
Ein Fausthieb und danach wieder der Knebel.
»So ein verstockter Schurke. Der denkt wohl, die kommen ihn heraushauen, was? Wenn sie sich da nur nicht irren. Eher bist du eine schöne Leiche, Bandit, als dass die dich bekommen. Der lügt, sobald er das Maul aufmacht.«
Als die Luft immer knapper wurde, ist er umgefallen, in den Stricken zusammengesackt. Daraufhin haben sie ihn anders angebunden, im Sitzen.
Und dabei haben sie einen Fehler gemacht.
Die eine Strickschlinge läuft unter den Latten des Zaunes durch, man kann sie leicht hinabschieben. Aber solange es noch hell war, hat er es nicht gewagt. Nun ist die Schlinge schon unten. Er bewegt sich vorsichtig, lehnt sich ganz langsam nach vorn. Zoll für Zoll kommt sein Rücken von den Latten ab. Es schabt ganz leise, kaum hörbar.
»Flint, siehst du was?«
»Nichts, alles ruhig«, sagt der Mann im Stall, der nach hinten aufpasst. »Auf dem hellen Boden ist alles zu erkennen, die kommen nicht. Wenn Jim durchgekommen ist und ihn die Partner des Schurken da nicht geschnappt haben, dann wird es keine vier Stunden mehr dauern, und der Sheriff ist da.«
Sie haben Angst, denkt Kenneth grimmig, diese verdammten Narren haben nichts als Furcht. Alle Bewohner stecken in einem Haus, die Männer passen auf. Sie zittern alle bei dem Gedanken, dass meine vier Partner kommen könnten, sich vielleicht eine der Frauen greifen und dann meine Auslieferung verlangen. Darum haben sie sich verschanzt.
Er spürt deutlich, wie sich der Strick um die Zaunlatte schiebt. Ganz langsam bekommt er mehr Platz, er kann nun schon die Hände bewegen und zerrt sie auf seinem Rücken von rechts nach links.
Immer mehr Freiheit für die Hände, und keiner sieht etwas davon. Es ist zu dunkel. Behutsam zieht er etwas die Beine an, stemmt die Hacken in den Boden, hat die eine Latte erfasst. Vielleicht hatten sie ihn nur an den Zaunpfosten binden sollen, aber sie haben die Stricke noch um zwei Latten gelegt. Kenneth Cord stemmt die Handkanten gegen die eine Latte und schiebt seinen Körper nach hinten. Er kann die Nagelstelle fühlen und hat nur den einen Gedanken, dass der Nagel nicht zu fest im Holz der Querlatte sitzen möge.
Mit aller Kraft drückt er die Hände gegen die Latte, hört einen Hund bellen. Es knackt einmal, aber sie hören es nicht, weil der Hund bellt und zwei der Männer sofort losgehen. Der eine blickt über den Bretterzaun hinweg, der rechts zwischen Stall und Schuppen ist.
»Siehst du was?«
»Nein. Wer weiß, was der verdammte Köter hat. Ich sage euch …«
Sie reden, sie sind nur dunkle Schatten in der Nacht.
Noch ein Knacken, und dann drückt sich die Latte aus dem Querbalken. Er fühlt es, verstärkt den Druck, klemmt nun die Finger zwischen Latte und Querbalken. Gleich darauf kann er den Nagel ertasten, der sich aus dem Holz geschoben hat. Noch ein kleiner Druck, dann ist der Nagel ganz heraus.
Irgendwo im Haus ruft eine der Frauen nach Sam. Der Mann in der Hintertür des Hauses sagt brummig etwas und verschwindet.
Kenneth schiebt die Latte mit dem Nagel bis an den Pfosten heran, er dreht sie leicht, bis sie am Pfosten aufliegt. Dann tastet er über den Nagel hinweg.
Gleich darauf sticht die Spitze des Nagels in den Knoten an seinen Handgelenken. Er bewegt die Hände, spürt, wie der Knoten sich zu lockern beginnt. Langsam nach vorn rutschend, macht er den Knoten so weit auf, dass er nun mit den Fingern die entstandene Schlinge noch weiter auseinanderziehen kann.
Durch die Hintertür weht der Geruch nach gebratenem Speck zu ihm hin. Es beginnt nach Kaffee zu duften. Kurz danach kommt Sam wieder und sagt zu Flint, er solle nun essen gehen. Kenneth scheinen sie vergessen zu haben.
Dafür ist Kenneth ihnen sogar dankbar, denn er hat den letzten Knoten auf und die Hände frei. Einen Moment – vor dem ungewissen Schatten des Zaunes ist er nichts als ein dunkler Fleck – nimmt er die Hände Zoll um Zoll am Körper nach vorn. Eine Minute später zieht er die Beine leicht an. Hinter seinem Rücken kann er den Strick, der völlig locker ist, um den Pfosten ziehen. Er macht es so weit, dass er die Oberarme gut bewegen kann. Sollten sie nachsehen, ob die Fesseln noch fest sind, braucht er den Strick nur einmal anzuziehen, dann wird er wieder straff um den Oberkörper liegen.
Im Haus plärrt ein Kind, eine Frau schimpft, ein Mann redet dazwischen.
Flint geht wieder auf seinen Posten zurück.
Kenneth Cord aber hat auch an den Stiefeln den Knoten bereits gelöst. Er ist praktisch frei, er könnte aufspringen und die Seile von sich abstreifen. Verstohlen blickt er nach links, dort ist das freie Land. Dann dreht er langsam den Kopf, sieht zum Stall, auf die offene Tür und den Mann in ihr. An den Stall schließt sich der Bretterzaun an, vor dem in einer Ecke Holz gestapelt ist. Rechts kommt danach der Schuppen, der quer zum Haus steht. Das Haus bildet die rechte Seite dieses offenen Rechteckes.
Ein Mann im Stall, einer im Schuppen, der nächste in der Hintertür des Hauses. Drei Männer, von denen jeder schießen wird, ohne lange zu fragen.
Warten, denkt Kenneth bitter, ich muss warten, bis sie müde werden.
Loomis, der Bäcker, geht nun ins Haus.
Die Zeit verrinnt. Es muss inzwischen zehn Uhr sein, als er wiederkommt.
»He, du Strolch«, sagt Loomis und kommt direkt auf ihn zu. »Na, du wartest wohl immer noch auf deine Partner, was? Sieh mal her, was ich habe, oder hast du keinen Hunger? Ich schlage dir ein Geschäft vor, du Bandit …! Du bekommst was zu essen und sagst uns dafür, wo deine Partner stecken.«
Er kommt heran, bückt sich und zieht mit der linken Hand den Knebel aus Kenneths Mund. Dann hält er mit der rechten Hand einen Teller mit Bratkartoffeln und Speck unter seine Nase, aber er sieht nicht nach den Stricken.
»Loomis, streng dich nicht an, der sagt nichts, das ist ein ganz hartgesottener Halunke«, ruft der Schmied grimmig. »Mann, wenn der das Maul aufmacht, lügt er schon. He, du willst ihm doch nicht wirklich was zu essen geben?«
»Warum nicht, wenn er redet? Na, Bandit, nun sag mal was. Wo stecken die anderen mit Cranes Pferden, he? Das ist der dritte Pferdediebstahl in diesem Jahr. Im vorigen waren es ein halbes Dutzend. Mach den Mund auf, für jeden Satz bekommst du einen Bissen, ist das kein Angebot?«
Er beugt sich noch weiter vor und hat ein Stück Speck auf die Gabel gespießt, das bei seinen Worten dicht vor Kenneths Mund ist.
Jetzt, denkt Kenneth, und greift zu.
Er sieht in dieses dickliche Gesicht, mitten in die Augen, die sich entsetzt weiten.
Der Mann vor ihm, Loomis, ein Bäcker, der sicher nie den Ehrgeiz besessen hat, einen Banditen zu fangen, der Mann erstarrt.
Er ist kein Kämpfer. Er ist ein Held nur aus Zufall geworden, sie alle hier sind Gelegenheitshelden. Und darum reagiert Loomis auch nicht so, wie es ein harter Kämpfer tun würde. Er zuckt nicht einmal zurück, als vor ihm der Gefangene, den sie doch so fest gebunden hatten, seine Hände blitzschnell aus den Schlingen des Seiles zieht.
Loomis sagt gar nichts, er sperrt nur den Mund auf, als die Hände ihn packen und sich hinter seinem Nacken schließen.
Loomis wird nach vorn gerissen, ein Ruck, ein wilder Schwung, Loomis kracht auf die Knie und sieht den Pfosten vor sich, an dem der Mann gerade noch gesessen hat. Das Essen fällt in den Dreck.
In der nächsten Sekunde, unfähig sich zu wehren vor Schreck, knallt Loomis mit dem Kopf an den Balken. Er sieht ein ganzes Feuerwerk und stöhnt schrecklich. Er ist benommen, hat das Gefühl, dass sich alles um ihn dreht.
Den Ruck an seinem Hosenbund merkt er nicht mehr.
In dieser Sekunde geschieht es. Kenneth Cord hat den Revolver von Loomis und dreht sich.
»He!«, sagt Flint am Stall heiser. »He, was ist da los? Loomis, was gibt es?«
Aber Loomis antwortet nicht. Dafür bewegt sich jemand am Zaun.
Sam an der Hintertür will losrennen und hört plötzlich den Gefangenen scharf sagen: »Stehen bleiben, ich schieße! Ich habe Loomis erwischt, ich schieße ihn nieder, wenn ihr nicht pariert.«
Der blufft, denkt Sam und sieht zu spät, wie der Arm hochkommt.
Dann ist der Knall da, die Kugel faucht vor ihm in den Boden.
Wirbelnd dreht sich der Schmied, reißt sein Gewehr hoch, aber er sieht nicht genug. Wo steckt Loomis, welcher dieser beiden Schatten ist Loomis?
»Flint, lass die Waffe fallen, schnell. Ich erschieße sonst Loomis!«
Flint flucht, und Sam steht, in der Faust den Revolver, starr an der Hauswand und wagt sich nicht zu rühren.
Nach dem Brüllen des Schusses ist es im Haus still geworden. Es kommt Flint und Sam vor, als hielte selbst die Natur einen Augenblick den Atem an.
Und dann hört man plötzlich die Stimme von Loomis.
»Nicht, ich tue nichts, nimm den Revolver von meinem Hals.«
»Flint, ist das Gewehr bald am Boden?«
Flint gehorcht augenblicklich.
»Sam, die Hand auf!«
Der hat Augen wie eine Katze, denkt Sam entsetzt und gehorcht genauso schnell wie Flint. Dieser verdammte Bandit, was wird mit Loomis?
Es poltert in diesem Moment im Haus, es hört sich an, als fiele etwas um. Dann schreit Morgan, der sich genau wie die anderen im Haus aufhält und mit einem Gewehr die Straße bewacht: »Was ist los, was geht da vor?«
Schritte im Hausflur und die scharfe, kalte Stimme Kenneths: »Loomis, schnell, sag ihnen, was mit dir ist!«
»Morgan, nichts unternehmen, denkt an meine Frau und meine Kinder, er hat den Revolver an meinem Hals. Gehorcht ihm, er ist frei.«
Einen Augenblick herrscht Totenstille, dann ruft jemand aus dem Haus: »He, du Bandit, hörst du mich?«
»Ganz genau«, erwidert Kenneth draußen kühl. »Niemand verlässt das Haus, sonst stirbt Loomis. He, Flint, streck die Hände hoch und geh zu Sam. Morgan, hörst du mich?«
»Hölle und Pest, ja, ich höre!«
»Macht sofort eine Laterne an. Morgan, dreh sie klein und komme mit ihr heraus. Du hast zehn Sekunden.«
Gleich darauf taucht Morgan mit einer Laterne auf. Als er erkennt, dass Loomis wie ein lebendiger Schild vor diesem verfluchten Banditen auf den Knien kauert, wird er leichenblass.
»Nun, sag den anderen da drin, was du siehst!«, faucht ihn Kenneth an. »Los, schnell, Morgan, du Trickser, rede!«
»Er hat ihn vor sich«, berichtet Morgan laut und spröde. »Loomis ist verloren, sobald einer nur irgendetwas versucht. Um Gottes willen, macht nur nichts, der Bandit versteckt sich hinter Loomis.«
»Genau das«, bestätigt Kenneth grimmig. »Stell die Laterne hin, Morgan, dreh sie mit dem Spiegel den anderen zu, hier bleibt es dunkel. Und jetzt los, Kerl, du gehst zum Zaun, steigst darüber und sattelst mein Pferd. Du bringst meinen Karabiner in Ordnung, steckst genug Patronen in die Satteltasche und führst das Pferd von hinten in den Hof. Hau ab, Morgan, beeile dich, ich warte keine Ewigkeit.«
»Morgan, geh schnell los«, sagt Loomis mit zitternden Lippen. »Ich will nicht wegen einer Narrheit sterben, ich habe Frau und Kinder. Geh doch, Charlie.«
Charles Morgan steigt wirklich nach kurzem Zaudern über den Bretterzaun und läuft davon. Im Haus ist es bis auf das Schluchzen einer Frau, wahrscheinlich ist es Mrs Loomis, still.
Keiner sagt etwas, man hört nur das Knarren eines Tores irgendwo. Also ist Morgan wohl schon bei seinem Store.
»He, im Haus!«, ruft Kenneth so hart er kann. »Mrs Loomis, hören Sie mich?«
Das Schluchzen bricht ab, dann meldet sich die Frau mit weinerlicher Stimme.
»Ja, Mister?«
»Hören Sie gut zu!«, gibt Kenneth scharf zurück. »Ihrem Mann hier passiert nichts, wenn sich die anderen ruhig verhalten. Das ist ein Versprechen, hören Sie mich, Mrs Loomis?«
»Ja, Mister, ich höre. Tun Sie ihm nichts, ich bitte Sie darum.«
»Das hängt nicht von mir ab«, erwidert Kenneth. »Wenn sich jemand der Männer aus dem Haus schleicht, dann muss ich schießen, Madam, passen Sie nur auf, dass kein Mann auf diese verdammte Idee kommt. Ich will es wissen, verstanden? Sobald sich einer hinausstehlen will, rufen Sie, in Ordnung?«
»Ja, Mister, ich werde Sie warnen. Schießen Sie bitte nicht auf Adam, meinen Mann.«
Er schweigt einen Moment. Durch die Nachtstille kommt das Schnauben eines Pferdes, das Klappen einer Tür.
»Flint, kannst du normal denken?«, erkundigt sich Kenneth bissig. »Ich sage dir, Mann, wenn ich Freunde hätte, wie ihr es angenommen habt, und sie wären in der Nähe gewesen, als ich in die Stadt kam, wären sie nicht schon längst hier? Flint, nach dem Schuss müssten sie doch gekommen sein, oder?«
»Ich weiß nicht«, erwidert Flint. »Mister, ich weiß es nicht!«
»Aber ich!«, knurrt Kenneth wütend. »Es gibt keine Freunde, Mann. Ich bin vor sechs Wochen aus Washington aufgebrochen und habe auf einem halben Dutzend Ranches um Arbeit nachgefragt. Vorher war ich bei Mr Polland in der Nähe von Harrington, Washington. Ich habe da den Winter über gearbeitet. Hör zu, Mann, ich werde mich nicht gefangen geben. Weiß der Teufel, ob man mich nicht gleich aufhängt, ehe man auf den Gedanken kommt, einmal nachzuforschen.«
»Das weiß ich alles nicht, ich bin nicht dabei gewesen«, antwortete Flint. »Mister, die Beschreibung passt aber …«
»Ja, zum Henker, sie passt auf tausend Männer, die sich ein Hemd dieser Farbe anziehen und blond sind, oder nicht?«, erkundigt sich Kenneth scharf. »Das ist doch Wahnsinn. Ich bin nicht der Kerl, der gesucht wird. Die Lady auf der Ranch, diese Miss Crane, wird das bestätigen können, sie hat den Burschen ja gesehen. Mann, ich kann nicht abwarten, bis der Sheriff kommt, mich zur Stadt bringt und dort vielleicht aufhängt. Das geht schnell in diesem Land. Ich weiß das, ich war selbst mal dabei, als sie einen Pferdedieb an den nächsten Ast hingen. – Hört alle zu, ihr sollt euch bei Polland in der Nähe von Harrington erkundigen!«
»Gut geredet«, sagt irgendwer im Haus giftig. »Wer sagt denn, dass du nicht erst in den letzten Wochen zu diesen Banditen gestoßen bist, he? Du hast auf ein paar Ranches um Arbeit nachgefragt, alles Pferderanches, he? Und wenn du da nur spioniert hast für deine Partner?«
»Himmel, Donner, ist mit euch denn nicht vernünftig zu reden?«, fragt Kenneth wütend. »Mann, ich habe keine Partner, ich bin allein geritten.«
»Das beweise mal.«
»Aber, Mann, ich kann es doch nicht.«
»Siehst du, Freund«, sagt der Mann im Haus spottend. »Vielleicht bist du es nicht. Miss Anne Crane müsste das ja wohl wissen. Ich gebe dir einen Rat, Cord, reite zu den Cranes oder warte, bis der Sheriff dich Miss Crane gegenüberstellt.«
»Ihr verdammten Narren, wer garantiert mir denn, dass sie mich nicht einfach aufhängen, ehe ich Miss Crane gesehen habe?«, erwidert Kenneth heiser. »Ich habe euch erlebt, und ihr habt nichts mit den Cranes zu schaffen. Aber Cranes Mannschaft, die wird eine prächtige Wut auf die fünf Halunken haben. Die hängen mich vielleicht und fragen erst danach, was? Schluss jetzt, Morgan kommt.«
Die Hufe tacken auf der Straße. Morgan hält hinter dem Stall an und meldet sich spröde: »Ich bin hier, Mister.«
»Das höre ich«, antwortet Cord grimmig. »Binde den Gaul an, komm her und halte die Hände über den Kopf.«
Es dauert keine zwei Minuten, dann kommt Morgan zaudernd von links in den Hof, geht auf Kenneth Cords Befehl dicht an der Stallwand entlang und bleibt stehen.
»Morgan, dreh deine Taschen um, du stehst im Licht. Los, dreh sie um!«
Morgan gehorcht. Er hat keine Waffe bei sich.
»Ins Haus zurück. Und passt auf, Freunde, niemand rührt sich. Ich nehme Loomis ein Stück mit. Kommt mir einer nach, dann muss ich Loomis erschießen. Ich denke, wir verstehen uns, oder?«
»Nimm ihn nur mit«, erwidert jener Mann, der ihn verdächtigt, erst seit ein paar Wochen bei den Banditen gewesen zu sein. »Wir kommen nicht nach. Zehn von deiner Sorte sind einen anständigen Bürger nicht wert, du Mörder.«
»Mensch, komm heraus und sage mir das ins Gesicht.«
Der Mann schweigt. Aus der Sicherheit des Hauses hat er ganz gut reden. Morgan verschwindet im Haus. Loomis steht nach einem kurzen Revolverdruck auf.
»Geh rückwärts, Loomis, ich bleibe hinter dir. Und versuche nichts.«
Er packt ihn, drückt ihm die Waffe in den Rücken und zieht ihn rückwärts auf das Pferd zu. So viel er auch lauscht, niemand scheint etwas unternehmen zu wollen.
»Aufsitzen, Loomis.«
Loomis zieht sich schwerfällig und stöhnend in den Sattel, rutscht dann vor ihn und unternimmt nichts, als Kenneth Cord hinter ihm aufsteigt. Langsam lässt Kenneth das Pferd rückwärts gehen.
Dann zieht er das Pferd herum und drückt ihm die Hacken an. Loomis sitzt steif und furchtsam vor ihm, er wagt sich nicht zu rühren und sagt auch nichts.
Sie entfernen sich schnell in der Nacht. Das ausgeruhte Pferd bringt sie schnell nach Norden, obwohl Kenneth zuerst in Ostrichtung davonreitet. Er schwenkt eine gute Meile weiter und stößt Loomis leicht an.
»Loomis«, sagt er finster. »So wahr ich hier hinter dir sitze, ich habe mit der Geschichte nichts zu tun, du musst mir glauben, Mann. Wenn ich ein Bandit wäre, hätte ich dann nicht Sam einfach niedergeschossen? Loomis, ich nehme dich mindestens fünf Meilen mit, verstanden? Dann kannst du zu Fuß nach Hause gehen.«
»Ja, Mister, ich versuche ja nichts.«
»Hast du immer noch Angst?«, fragt Kenneth bitter. »Ich bin kein Bandit, ich bin immer für die Pferde einer Ranch verantwortlich gewesen. Das ist mein Beruf, aber nicht der, ein Bandit zu sein.«
Loomis schweigt, schrickt zusammen, als Kenneth Cord hält und lauscht.
Einmal ist es Cord, als hätte er Hufschlag gehört, aber alles bleibt still. So reitet er weiter, hält nach über einer Stunde an und lässt Loomis absteigen. Der Mann sieht furchtsam zu ihm hoch.
»Mann, hast du eine Angst«, murmelt Cord düster. »Ich tue dir doch nichts. Hau ab, geh nach Hause.«
Loomis zieht den Kopf ein. Es ist etwas heller geworden. Im ungewissen Licht entfernt sich Loomis zaudernd, sieht sich mehrmals um und beginnt schließlich zu rennen.
»Der Narr«, sagt Cord bitter, »er ist vor Angst fast gestorben. Teufel, sie haben recht, ich könnte auch erst in den letzten Wochen zu diesem Verein gestoßen sein. Und das kann ich nicht widerlegen … Niemals! Bleibt nur diese Miss Crane, die mich von dem Verdacht befreien könnte, ein Bandit zu sein. Also, weg hier, je weiter, desto besser.«
Er drückt dem Pferd die Hacken ein, prescht nach Norden und hält zweimal im Verlauf einer halben Stunde, weil er wieder Hufschlag zu hören glaubt. Doch alles ist still, niemand verfolgt ihn.
Vor sich kann er eine Bergflanke erkennen, die etwa zwei Meilen entfernt ist. Er stößt an einen Bach, kommt durch ein breites Tal, hält sich immer seitlich des Baches und sieht nun die Bergflanke deutlich. Der Bach fließt an ihr entlang. Er reitet im Wasser, wird langsamer und hört nichts als das Murmeln der kleinen Wellen.
Und dann geschieht es …
Genau in dem Moment, als er links offenes Buschgelände und rechts die Flanke des Berges sehr nahe vor sich hat.
Aus der absoluten Ruhe der Nacht blitzt es plötzlich unmittelbar vor ihm auf. Er sieht nur das Mündungsfeuer eines Gewehres. Dann trifft der harte Schlag seinen linken Arm. Die Kugel stößt ihn im Sattel herum, aber sie rettet ihn vor der zweiten, die aus dem Feuerblitz ganz rechts auf ihn zuschießt. Während sie haarscharf und singend vor seiner Brust vorbeifaucht, wirft er sich instinktiv nach vorn. Er prallt auf den Hals seines Pferdes, reißt mit der rechten Hand die Zügel herum und drückt die Hacken an.
Irgendwo in der Nacht, und der Schmerz in seinem Arm ist so heftig, dass er schwer stöhnt, ist der scharfe Ruf eines Mannes: »Anhalten!«
Es scheint von rechts zu kommen, vielleicht versucht Kenneth Cord darum nach links zu entwischen. Sein Pferd jagt los, kommt aus dem Bach und galoppiert auf die Büsche zu. Noch einmal irgendwo ein Ruf, dann fallen drei, vier Schüsse gleichzeitig. In jenem hallenden Krachen, das von allen Seiten zu kommen scheint, streift irgendeine der vielen Kugeln seinen Rücken. Es ist wie ein Hieb mit einer Stachelpeitsche, der ihn zusammenzucken und sich aufrichten lässt.
Vor ihm sind die Büsche, deren dunkler Saum rasend schnell heranfliegt. Und dann mitten zwischen ihnen der Feuerball. Es kommt ihm vor, als ritte er mitten in ihn hinein.
In der nächsten Sekunde stößt sein Pferd ein scharfes, schmetterndes Wiehern aus. Er steigt urplötzlich und beginnt sich zu drehen.
Kenneth Cord aber ist durch die zweite Kugel so benommen, dass er zu spät reagiert. Mit einem verzweifelten Ruck kommt er noch aus dem Sattel. Er prallt, weggeschleudert von der Flanke des Pferdes, auf den Boden.
Halb betäubt liegt er, sieht einen Schatten über sich immer größer werden und stößt einen Schrei aus.
Der Anprall, der jäh sein Bein trifft, jagt eine neue Schmerzwelle in ihm hoch. Alles in ihm ist nur noch Schmerz, der bis in seinen Kopf schlägt und alles in ihm auslöscht.
Dann ist die Dunkelheit da. Er weiß nichts mehr, bis irgendwoher eine heisere, knarrende Stimme sagt: »Die Äste jetzt hier herunterstecken. Hier, Leute. Hebt ihn an – hebt.«
»Er kommt zu sich, he, er wacht auf.«
Lichtschein ist zu sehen, er blinzelt. Irgendwer hat ihn unter den Armen gepackt und zieht ihn über den Boden. Er sieht verschwommen die dunkle Masse seines toten Pferdes am Boden neben sich. Schmerz ist in seinem Bein, in seinem Arm und in seinem Rücken.
Er stöhnt und rollt sich auf die rechte Seite, die einzige Seite, auf der er liegen kann.
Das Licht fällt auf sein Gesicht. Es ist so grell, dass er einen Moment die Lider schließen muss. Als er sie öffnet, sieht er einen Mann neben sich.
»Hallo, Bursche«, sagt der Mann, an dessen Weste der Sheriffstern steckt. »Da haben wir dich ja. Und lebendig genug, um stehend deine Verhandlung zu erleben. Mein Freund, du hast eine ganze Menge Pech gehabt, fürchte ich. Ich war in der Nähe von Arlee auf einer Ranch, als mich Jim Alcott suchte. Das ist ein wenig näher gewesen, als wenn er bis nach Missoula hätte reiten müssen. Du hast die Leute ganz sauber ausgetrickst, und solange du Loomis hattest, war es mir zu gefährlich, zu kommen. Wir haben dich von Durham aus verfolgt und schließlich überholt. Na, wie gefällt dir das?«
Allmächtiger, denkt Kenneth entsetzt, sie haben den Schuss gehört und waren schon da. Nun ist es aus.
»Sheriff, ich habe mit der Sache …«
Der Sheriff, ein hagerer Mann, sieht ihn zwinkernd an und grinst spöttisch. »… nichts zu tun, ich weiß«, unterbricht er Kenneth. »Das haben schon viele gesagt, Mister. Ich fürchte, du wirst noch mehr erzählen, aber es wird dir nichts helfen. Am Ende, Mister, hängen sie dich auf.«
*
»Lies weiter«, sagt Murdock heiser und blickt wieder zu Lispy hin. »Mach schon, James.«
Die Zeitung ist sechs Tage alt. Und der Mann, der den Artikel geschrieben hat, muss ein großer Moralist sein. Sonst würde er nicht alle Lügerei verdammen und Verstocktheit verfluchen.
Sie sind still, als James mit seiner ruhigen, sanften Stimme vorliest. Nur manchmal blicken sie auf Lispy.
James liest, er scheint ganz ruhig zu bleiben. Er hat so wenig gesagt wie Lispy, während Murdock geflucht und Dorrey gegrinst hat wie ein nackter Pavian auf einer Bananenstaude, so jedenfalls hat ihn Murdock tituliert!
Und dann schweigt James, er lässt ganz langsam die Zeitung sinken und sieht sie sich der Reihe nach an. In McDeweys Augen erkennt er sofort beißenden Spott und den Ausdruck, der immer in seinen Augen gewesen ist, wenn sie mal über Richter oder Sheriffs gesprochen haben, denn McDewey hasst sie noch mehr als die Pest.
»Ist das alles?«, fragt Murdock nach einem Moment und starrt zu Boden. »Mehr nicht?«
»Ist das nicht genug?«, erkundigt sich Dorrey und hat wieder das Grinsen um den Mund. »Mann, das ist ein Spaß, was? Die wollen den armen Kerl aufhängen. So dämlich kann auch nur eine Langhaarige sein. Erkennt in diesem Kerl Lispy. Mann, Lispy, ein Glück, dass du nie ein Wort reden darfst, wenn wir so was machen. Das hätte noch gefehlt. An deinem Stottern würde dich sogar ein Tauber erkennen.«
Lispy erwidert wütend: »Ver – verdammt, dass du la – lachen kannst. Hä – hätt ich doch blo – bloß nicht sei – seinen Packen u – und die He – Hemden …«
»Du hast aber«, antwortet James ruhig. »Lass nur, Lispy, ich weiß, du hast keine Schuld daran, aber es ist nun mal passiert. Noch vier Tage, dann bringen sie ihn nach Helena und hängen ihn am nächsten Tag. Immer am Montag, was? Sie werden ihn Sonntag nach Helena schaffen, sicher nehmen sie eine Kutsche.«
Bruce Murdock beißt sich auf die Lippen und flucht heiser.
»Und? Was können wir denn schon machen, he? James, was würdest du denn tun wollen?«
James’ hageres, faltiges Gesicht sieht noch genarbter aus als sonst. Er blickt auf die Corrals, in denen ein paar Rinder stehen, auf die Pferde, die ihnen tatsächlich gehören. Wolken sind am Horizont über den Bergen. Es ist viereinhalb Wochen her, dass sie aus Idaho zurück sind und die Pferde der Cranes verkauft haben jenseits der Idaho-Grenze in Kanada.
»He, James, sag was.«
»Ich weiß nichts«, murmelt James. »Verdammt, warum fragst du mich? Woher soll ich denn wissen, was wir tun müssen? Wenn sie ihn wegbringen, dann wird er gut bewacht. Von Missoula bis Helena sind es hundertfünfzehn Meilen. Man kommt an ihn nicht ohne Gewalt heran. Und was dann? Denkst du, die rechnen nicht damit, dass man einen Versuch machen könnte, ihn zu befreien?«
Murdock nickt finster, dreht sich eine Zigarette und steckt sie an.
»Also nichts«, stellt er heiser fest, nachdem er ein paar Züge geraucht hat. »Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, aber ich sehe keinen Weg, ich sehe wirklich keine Chance für den Burschen. Wie heißt er – Kenneth Cord?«
»Ja, ein Pferdejäger und Zureiter, irgendein kleiner Bursche«, murmelt James. »Zum Teufel, es gefällt mir nicht, dass wir tatenlos zusehen, wie sie ihn hängen, aber ich sehe keinen Weg, an ihn heranzukommen.«
»Was heißt tatenlos?«, mischt sich McDewey achselzuckend ein. »Ist er vielleicht der Erste, den sie unschuldig aufhängen? Auf einen mehr oder weniger kommt es doch nicht an.«
»Mensch«, faucht James und steht jäh auf. »Deine blöden, eigensüchtigen Reden soll der Teufel holen. Wenn du jetzt in Missoula im Jail sitzen würdest, was dann? Ich garantiere, du hättest die Hosen voll, Mister. Du würdest jede Nacht auf uns warten. Oder etwa nicht?«
»Ich bin aber nicht er«, antwortet McDewey höhnisch. »Ich bin nicht so blöde gewesen, meine Sachen am Ufer liegen zu lassen, ich nicht.«
Dorrey hustet, erhebt sich von der Bank am Haus und kratzt sich am unrasierten Kinn.
»Ich weiß was.«
»Du?«, fragt Murdock und sieht ihn groß an. »Lass hören.«
»Ich kann ja auch mein Maul halten«, erwidert Dorrey gekränkt. »Mein Vorschlag ist bestimmt nicht schlecht. Wie wäre es, wenn Lispy wieder eins der roten Hemden anziehen würde? Er müsste sich damit natürlich zeigen.«
»Du bist doch wahnsinnig«, knurrt James bissig. »Damit sie ihn vielleicht auch noch schnappen, was? Kommt nicht infrage, abgelehnt.«
»Lass mich doch erst ausreden!«, brüllt Dorrey, der es nicht vertragen kann, dass man seine Intelligenz anzweifelt. »Kaum mach ich mal den Mund auf, dann heißt es, ich sei blöde. Dabei bin ich vielleicht klüger als ihr alle. Wir müssen alle zusammen etwas machen. Wir reiten in die Nähe von Helena und zeigen uns auf irgendeiner Ranch mit fünf Mann. Und Lispy zieht das rote Hemd an.«
Einen Moment nimmt sogar Murdock vor Staunen die Zigarette aus dem Mundwinkel, sieht James an und danach Sid.
»Donner, gar nicht so verkehrt gedacht. James, du hast doch Erfahrungen, wie würde der Richter reagieren?«
»Überhaupt nicht«, antwortet James bitter. »Er wird doch nicht, nur weil fünf Mann auftauchen und einer so aussieht wie dieser Kenneth Cord, sein eigenes Urteil aufheben. Hast du schon mal einen Richter erlebt, der zugibt, dass er sich geirrt hat, solange es keine hundertprozentigen Beweise gibt? Dass fünf Mann auf einmal irgendwo spazieren reiten und einer wie jener Cord aussieht, das macht überhaupt nichts aus, ich weiß es. Tut mir leid, Dorrey, deine Idee ist wirklich gut, aber sie führt zu nichts.«
»Du musst es ja wissen«, gibt Dorrey zurück. »Ich habe nur gemeint …«
»Da ist nichts zu meinen«, brummt McDewey. »Lass uns die Sache vergessen, das ist alles, was wir tun können und werden. Sollen sie ihn hängen, na und?«
»Na – na und«, sagt Lispy zornig und steht vor ihnen. »Ich ha – hab ihn da hingebracht, ich wer – werde was tun, jawohl, ich werde wa – was machen. Die müssen ihn in ei – eine Kut – Kutsche setzen und fa – fahren. U – unterwegs ka – kann viel passieren, ich schmei – schmeiß mit Dyna – Dynamit, jawohl!«
James starrt Lispy an.
»Hör mal, ich denke, du wolltest nie einen umbringen. Dabei können aber Männer sterben, ist dir das auch klar?«
»Man ka – kann da – das arme Sch – Schwein nicht – st – sterben la – lassen«, stammelt Lispy.
»Du bist verrückt, du Stotterkaiser«, sagt McDewey und steht auch auf. »So verrückt kannst du nur sein. Halt den Mund, wenn wir reden, und misch dich nicht ein, hier bestimmen wir. Wir werden gar nichts tun, das ist ein Befehl!«
»Befehl?«, knurrt Lispy und sieht ihn wild an. »Du – du, du ha – hast keine Befeh – Befehle zu geben. Ha – halt du den Mu – Mund!«
»Der wird frech«, stellt McDewey äußerst überrascht fest. »Du hast zu gehorchen, wenn wir etwas beschließen, verstanden? Da kommt dieser Idiot wieder mit seiner verdammten Gerechtigkeit an. Vielleicht erzählt er uns noch, dass er hingehen und sich für den Kerl hängen lassen will, so verrückt ist der. Er liefert uns noch alle an einen Strick!«
»Hört auf, seid ruhig!«, bellt Murdock dazwischen. »Lispy, du musst doch einsehen, dass es Unsinn ist, wenn wir einen Gefangenentransport angreifen. Dabei muss man schießen. Bis jetzt haben wir niemals einen erschießen müssen. Na gut, angeschossen haben wir zwei, drei Mann, aber gestorben ist keiner. Und das wird passieren, Lispy, begreifst du nicht?«
»Der wird gehä – gehängt«, antwortet Lispy zitternd. »Ich will ni – nicht, dass sie ihn hä – hängen, klar? Ich sprenge das Jail in Mis – Missoula. Ich hole ihn her – heraus, Bruce.«
»Ja, und eine ganze Stadt jagt uns, bis wir alle am Galgen hängen!«, brüllt ihn McDewey wild an. »Genug mit deiner Schwätzerei, es geht nicht. Und damit basta! Du hast zu gehorchen, du Narr, der nicht bis drei zählen kann. Nicht nur, dass du stotterst, wie ’n schwindsüchtiger Gaul hustet, du fällst mir langsam auf die Nerven, Mann.«
Lispy starrt ihn an, dreht sich dann um und packt Murdock am Arm.
»Bruce, wir mü – müssen was tun. Hör doch – er ist unschu – schuldig. Sie du – dürfen ihn ni – nicht …«
»Jetzt habe ich genug, der Narr muss erst was auf das Maul haben, ehe er still ist!«, schreit McDewey, macht einen Satz und packt Lispy von hinten mit beiden Händen am Hemd. »Jetzt werde ich dir beibringen, was es heißt, wenn wir etwas bestimmen.«
Er dreht sich, reißt Lispy herum und lässt ihn dann los.
Lispy fliegt auf das Geländer neben dem Vorbau zu, prallt dagegen und rutscht ab. Er landet in der Ecke von Vorbau und Hauswand.
»He, verdammt, Sid, lass ihn in Ruhe!«
»Einen Dreck werde ich, Bruce!«, brüllt McDewey voller Wut. »Der Kerl macht mich schon die ganze Zeit verrückt, er muss endlich verstehen, dass hier nur wir bestimmen, und er zu gehorchen hat. Warte, Brüderchen, da bin ich.«
Er stürzt sich wieder auf ihn, streckt beide Hände aus und will nach Lispys Gürtel greifen. Es ist sicher, dass McDewey Lispy wieder herumschleudern und fliegen lassen will.
Doch dann, und sie glauben alle, dass Lispy halb betäubt sein muss, kommt es ganz anders.
Lispy reißt blitzschnell sein rechtes Bein hoch und trifft.
McDewey rennt mitten in den Tritt hinein. Nach einem kurzen, stöhnenden Laut kippt McDewey nach vorn, er hat einen Moment keine Luft mehr.
»Du – du Lump«, knurrt Lispy. »Von hi – hinten, was? Dir ha – habe ich scho – schon lange was …«
Er scheint doch leicht benommen gewesen zu sein, denn er schüttelt sich wie ein nasser Kater. Es gelingt McDewey gerade noch, sich am Geländer zu halten, aber mehr kann er in diesem Augenblick nicht tun.
Der friedliche Lispy, der nie auf eine Prügelei wild war, kommt herum und feuert die linke Faust ab. Als sie genau in McDeweys Gesicht trifft, sieht es aus, als wolle der nach dem Revolver greifen. Doch zu spät. Lispys Linke lässt McDewey an die Hauswand taumeln. Lispy ist schon wieder bei ihm und packt ihn an der Brust. Während er ihn zu drehen beginnt, streckt James die Hand aus und hält Murdock an der Schulter zurück.
»Nicht, Bruce«, sagt James leise. »Lass ihn. Das ist schon lange fällig gewesen. Lass ihn beweisen, dass er kein Narr ist, den Sid dauernd treten kann.«
»Verdammt, ich kann keine Prügelei gebrauchen, du weißt …«
»Lass ihn, Bruce, es ist richtig, verlass dich auf mein Gefühl.«
Murdock, der dazwischen wollte, bleibt stehen.
Vor ihnen dreht Lispy McDewey herum und lässt ihn dann los.
Bereits in diesem Moment zeigt sich, dass Lispy auch bei einem Kampf genauso schnell ist wie auf dem Rücken eines einzureitenden Pferdes. Sein Herumschleudern lässt McDewey genau an den Balken sausen. Es sieht beinahe spaßig aus, wie McDewey mit dem unteren Rücken an die Balkenstange kommt, sich ganz langsam nach hinten neigt und dann über sie hinwegkippt, indem er einen Salto rückwärts macht.
»Du – du wo – wolltest doch wa – was«, fragt Lispy und ist schon mit einer Flanke über den Balken hinweg. »Lass – lass das lie – lieber.«
Es ist genauso, als hätte er für diesen Kampf Monate trainiert. McDewey liegt zwar am Boden, bewegt aber die rechte Hand und will seinen Revolver ziehen. Doch ehe er so weit ist, der Revolver kommt aus dem Halfter, aber nicht mehr hoch, tritt Lispy genau unter die Hand. Der Revolver wirbelt weg.
»Nicht schi – schießen«, keucht Lispy. »Du mu – musst was begrei – fen.«
Er weicht dem Stoß von McDeweys rechtem Bein aus, springt hoch und erwischt seinen Gegner in der nächsten Sekunde vorn am Hemd. Dann zieht er McDewey hoch und lässt los. Sein nächster Hieb knallt McDewey unter die kurzen Rippen. McDewey torkelt vor Lispy her, der nachsetzt und ihn mit drei, vier Hieben bis dicht an den Wassertrog jagt.
»Mein Gott«, sagt Bruce stockheiser. »Teufel, der Junge kann was. James, soll ich nicht besser …«
»Misch dich jetzt nicht ein, er macht es nicht zu schlimm, dafür kenne ich ihn, Bruce.«
Einen Schritt vor dem Wassertrog holt Lispy links aus und schlägt zu. Sein Treffer landet genau an McDeweys Kinnwinkel. Es sieht aus, als wolle sich McDewey auf die Zehenspitzen stellen, aber dann kippt er rücklings über den Trog. Einen Moment bleibt er wie tot auf ihm liegen, doch als er sich zu bewegen beginnt, packt ihn Lispy schon wieder.
»Hi – hinein, du Sti – tinktier«, schnauft Lispy, und schiebt McDewey in den vollen Tränktrog. »Da liegst du gu – gut, was?«
McDewey taucht unter, er glaubt ersticken zu müssen und kommt durch das kühle Wasser schnell wieder zur Besinnung. Gleich darauf strampelt er, taucht auf und klettert aus dem Trog.
»Lispy«, meldet sich da James. »Wenn du jemanden brauchst, der dir hilft, dann werde ich mitkommen.«
»Hast du gehört, Bruce?«
Bruce Murdock zuckt zusammen, als habe jemand hinter ihm einen Revolver abgefeuert. Er dreht sich scharf um, starrt James einen Moment groß an und beißt sich auf die Lippen.
»He«, sagt er tonlos. »Das ist doch nicht dein Ernst, wie? Wir riskieren alles, wenn wir versuchen, den Mann zu befreien, weißt du das nicht?«
»Verdammt, er kann nicht für etwas hängen, was er nicht getan hat, Bruce, das ist mein letztes Wort! Der Mann ist unschuldig. Irgendwann muss man etwas tun, was anständig ist, und dies ist der Moment, damit anzufangen.«
Dorrey reißt entsetzt die Augen auf. Für ihn ist klar, was kommen muss, denn sie haben immer alles zusammen getan.
Einen Augenblick zuckt ein Muskel an Murdocks linker Wange schnell und heftig, ein Zeichen, dass Murdock äußerst erregt ist.
»Die Kutsche«, sagt er dann, »wird niemals die ganzen hundertfünfzehn Meilen durchfahren. Wahrscheinlich fahren sie am Sonnabend los und verbringen die Nacht mit dem Burschen in einer der Stationen oder Städte. Es ist Wahnsinn, aber vielleicht haben wir eine Chance. Allein lasse ich euch nicht gehen. Wir nehmen es alle auf uns, oder keiner. Also gut, ziehen wir uns an wie anständige Bürger, zu dieser Sache müssen wir vielleicht eine Menge Tricks anwenden. Verdammt, hätten wir dem Kerl doch nie die Hemden gestohlen.«
*
»Komm raus aus der Zelle, du Bandit!«
Da stehen sie, drei Männer, zwei mit dem Deputy-Stern und hinter ihnen der Sheriff, der die Handschellen in der einen Hand baumeln lässt.
Kenneth sieht sie an und geht die ersten Schritte etwas steif und müde.
Sie haben ihm zu essen gegeben. Hirse und ein Stück zähes Rindfleisch, eine Scheibe Schmalzbrot und einen Becher lauwarmen Kaffee. Der eine Deputy, Shoan, macht einen Schritt zur Seite, hält die Hand am Revolverkolben und sieht ihn kurz an. Dann knallt die Gittertür hinter ihm zu, und der zweite Deputy deutet mit seinem Revolver auf die kahle, getünchte Wand.
»Gesicht zur Wand, Cord, Hände auf den Rücken.«
Er sagt nichts, hört das Klimpern der Handschellen und die Schritte des Sheriffs, als er an der Wand steht.
»Streck sie höher, Cord«, sagt Sheriff Seymour mit seiner knarrenden, rauen Stimme, die den starken Raucher verrät, der zudem ab und zu ganz gern einen trinkt. »So ist’s gut, Mister!«
In dem Moment, als das Schloss einschnappt und Seymour den Schlüssel umdreht, beginnt Kenneth zu reden.
»Sheriff«, sagt er tonlos, und die Furcht ist wieder da, die ihn in der Nacht abwechselnd frieren und schwitzen ließ, »Sheriff, Sie können das doch nicht machen, ich war es nicht. Ich habe diese Ranch nie gesehen.«
»Ja, ja«, sagt Baldwin, der zweite Deputy, glucksend. »Wir verstehen schon, Cord. Du hast sie nie gesehen, du weißt nicht mal, wo sie liegt. Du hast nie Partner gehabt und bist nie Pferdedieb gewesen. Diese Tour, sich dumm zu stellen, kennen wir. Nur, mein Freund, bei uns zieht sie nicht. Fertig, können wir gehen?«
»Gehen wir«, bestimmt Sheriff Seymour knarrend. »Er fängt schon wieder an, der Narr. Nun gut, mancher schreit noch unter dem Galgen, er sei unschuldig. Es gibt so viele Unschuldige auf der Welt, was, Cord?«
»Sheriff, ich bin es. Verstehst du denn nicht, ich habe keinen Überfall mitgemacht, ich hatte keine Partner. Mann, warum sollte ich denn lügen?«
»Wer weiß, warum, wir nicht, aber du bestimmt«, erwidert Seymour achselzuckend. »Die Jury hat dich schuldig gesprochen, die Lady dich erkannt. Cord, gib es endlich auf, sonst bekommst du einen Knebel, verstanden?«
Er presst die Lippen zusammen, wird gestoßen und kommt ins Office. Dort sieht er Richter Crane stehen, den Bruder jenes Ranchers, den seine Partner angeblich niedergeschossen haben sollen. Neben Crane ist Roy Orwell Tiffin, der Sprecher der Jury war und den Schuldspruch verkündete.
Es sind wieder Tiffins seltsame, helle Augen, die Cord das Gefühl vermitteln, das er schon bei der Verhandlung hatte:
Dieser Tiffin hat seine Zweifel.
Für Cord ist Tiffin der einzige Mann, der ihm vielleicht glauben würde, wenn die Beweise nicht so eindeutig gegen ihn gesprochen hätten. Vor allem das Zeugnis des Mädchens, das ihn kaum angesehen hat. Als sie in den Zeugenstand trat und der Richter sie aufforderte, Cord anzusehen, tat sie es nur mit einem angewiderten, verächtlichen Blick. Und dann sagte sie fest: »Das ist der Mann, Euer Ehren.«
Cord friert wieder. Er blickt Tiffin, einen großen, sehnigen Mann, der die besten Pferde in diesem Land hat und nur auf Pferdezucht spezialisiert ist, Hilfe suchend an.
Mein Gott, denkt Kenneth Cord, und der kalte Angstschweiß bricht ihm aus, nimmt das gar kein Ende?
Der Richter ist der Bruder des Niedergeschossenen. Und sie sind hier so bekannt wie es Leute sein müssen, die noch zur Indianerzeit herkamen. Alle Leute halten zu ihnen, aber Tiffin – er ist noch jung, er hat mich mehrmals etwas gefragt. Er wollte genaue Einzelheiten wissen, auf die ich keine Antwort geben konnte, weil ich sie doch nicht wusste: Ich hatte keine Ahnung von dem alten Koch, den sie aus der Küche lockten.
»Mr Tiffin«, sagt er hastig, als Richter Crane etwas sagen will. »Hören Sie, ich bin unschuldig. Man kann mich doch nicht hängen. Wie weit geht der Richter denn noch? Ich war es nicht. Mr Tiffin …«
»Halt den Mund, Cord!«, donnert ihn Richter Crane an. »Du hast hier nicht ungefragt zu reden, Mann. Du bist schuldig, das ist alles, was wir wissen, was sich erwiesen hat.«
Kenneth Cord hat das Gefühl, vor einem Abgrund zu stehen, dessen Tiefe ihn gleich aufnehmen wird.
Richter Crane liest vor, aber Cord hört nur einzelne Worte, so sehr sitzt das Grauen in ihm.
»… Montag früh sechs Uhr etwas zu sagen, Cord?«
Aus, denkt er, das ist die Bestätigung des Urteils. Montag früh sechs Uhr hängen sie mich. Ob ich noch etwas zu sagen habe, ich?
»Cord, hast du noch etwas zu sagen?«
»Ja«, sagt er schnell und keuchend. »Ich war es nicht. Das ist ein Irrtum, Euer Ehren. Miss Crane hat sich geirrt. Wenn ich jedem blonden Mann ein rotes Hemd anziehe, der meine Größe hat …«
»Das hast du schon alles gesagt«, erwidert Richter Crane, ein untersetzter weißhaariger Mann mit strengen Zügen, grimmig. »Das sind alte Dinge. Also gut, du bist unschuldig. Du hast gehört, was dir bevorsteht. Ist noch jemand zu benachrichtigen, hast du jemanden, an den deine Sachen geschickt werden sollen?«
»Meine Sachen?«
»Ja, vermachst du sie jemanden, Cord?«
Cord sieht zu Tiffin, aber der wendet ihm den Rücken zu und blickt aus dem Fenster in den Morgen dieses Freitags. Vermachen, denkt Cord, vermachen?
»Na, Cord?«
»Da ist ein Junge«, sagt er heiser. »Er heißt Benny, er ist bei den Pollands in der Nähe von Harrington auf der Ranch. Der Junge hat keine Eltern mehr, er soll alles haben. Aber ich bin doch unschuldig. Das ist Wahnsinn, Richter. Ich soll meine Sachen jemandem vermachen, ich soll sterben für etwas, was andere getan haben? Warum habe ich denn nicht mit ihnen die Pferde weggetrieben, warum bin ich allein geritten?«
»Das weiß der Teufel«, antwortet Crane eisig. »Es ist nicht Sache des Gerichts festzustellen, warum du allein gewesen bist. Nur die Tatsachen zählen. Vielleicht habt ihr untereinander Streit gehabt. Zum Henker, jetzt fange ich schon an, diesem Banditen zuzuhören, wenn er seinen Unsinn verbreitet. Also, wie heißt der Junge auf der Polland-Ranch?«
»Benny Pohl. Er ist Ranchhelp, ein wirklich anständiger Junge. Richter, hören Sie …«
»Genug!«, gibt Richter Crane finster zurück. »Ich habe die Burschen gerade gern, die nicht mal zu dem stehen, was sie getan haben, sondern zu Lügen Zuflucht nehmen. Tiffin, willst du noch etwas?«
Roy Orwell Tiffin hat sich umgedreht und die Hand erhoben. Er blickt einmal zu Crane, dann sieht er Cord an.
»Cord«, sagt er langsam. »Ich habe mich genau nach dir erkundigt. Du hast überall deine Arbeit sauber getan und bist immer sparsam gewesen. Nun gut, du hast ein paar Prügeleien gehabt. Du bist ziemlich rechthaberisch, sagte man mir, aber sie sind alle mit dir zufrieden gewesen. Von all den Ranchern, die befragt wurden, hat nur einer gesagt, du hättest nicht viel getaugt.«
»Was, Sie haben sich erkundigt?«, fragt Kenneth und wird blass. »Mr Tiffin, dann muss sich der Richter doch sagen, dass ich unschuldig bin. Ich habe nie gestohlen, ich habe gespart, mein Geld …«
»Ich weiß, du hast das Geld deiner Mutter geschickt«, erwidert Tiffin heiser. »Dein Bruder weiß, was mit dir ist. Er kann es deiner Mutter nicht sagen, sie ist krank. Ich habe hier einen Brief deines Bruders.«
Richter Crane zuckt zusammen und sieht Tiffin scharf an.
»He, was ist das, Roy?«, fragt er zornig. »Du hast hinter meinem Rücken …«
»Ja«, sagt Tiffin und sieht ihn voll an. »Edward, wenn du nur keinen Fehler gemacht hast. Schließlich war er dein Bruder, wie? Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Mann uns vielleicht die Wahrheit gesagt hat.«
»Dummes Zeug, du und deine Gefühle. Für das Gesetz gibt es keine Gefühle, da zählen nur Tatsachen. Gefühle sind überflüssig.«
»Eben, du sagst es«, antwortet Roy Tiffin düster. »Nur, mein Freund, wenn Anne sich geirrt hat, was dann? Er hat recht, wenn er sagt, dass man tausend Männer, zudem in einem dunklen Flur, hinstellen könnte. Sind sie blond, dann werden sie sich alle gleichen.«
»Eine Crane irrt sich nicht, das solltest gerade du dir für die Zukunft merken«, knurrt Richter Crane gereizt. »Also gut, her mit dem Brief, ich will ihn lesen.«
Tiffin reicht ihm den Brief und zuckt die Achseln.
»Gewäsch«, sagt der Richter dann abfällig. »Ermahnungen eines Bruders an den anderen. Lies ihm den unterwegs vor, Roy. Mir reicht es für diesen Morgen, ich gehe. Hast du sonst noch was, Roy?«
»Noch eine Kleinigkeit«, antwortet Roy Tiffin und senkt den Kopf. »Edward, du bist ein sehr guter Richter, aber deine Familie war in diesem Fall betroffen. Du hättest darauf Rücksicht nehmen und einen anderen Richter bitten müssen, dich zu vertreten. Das ist die eine Sache – die andere ist bitterer. Richter können sich irren …! Auch du bist nicht unfehlbar, Edward. Wenn dieser Mann unschuldig ist, dann ist es Mord, wenn sie ihn hängen. Wir sind viel zu schnell damit bei der Hand, jemanden zu verurteilen. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber sollte die Verhandlung noch einmal stattfinden, würde ich mich keinem Schuldspruch anschließen. Da ist ein junger Bursche, der sein Geld seiner kranken Mutter schickt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er …«
»Teufel, Roy, jetzt ist es genug!«, bellt ihn Crane scharf an. »Wenn du mir solche Dinge zu sagen hast, dann nicht hier vor aller Ohren. Dir fehlt der Respekt vor dem Gesetz.«
»Nein, der hat mir nie gefehlt, aber ich liebe keine Irrtümer und unklare Sachen. Ich werde in Helena mit dem Gouverneur reden, du kannst dich darauf verlassen. Ich werde mit ihm sprechen und ihn bitten, die Urteilsvollstreckung aufzuschieben.«
Richter Crane erstarrt, läuft feuerrot an und beißt sich für Sekunden auf seinen Schnurrbart. Dann aber sagt er voller Zorn: »So ist das, sieh mal einer an. Du bildest dir etwas ein und versuchst den Gang der Justiz aufzuhalten, Roy? Ich werde dir sagen, was ich tun werde, ich werde Anne über dein Verhalten berichten. Du bist ja wirklich der reinste Freund der Familie Crane. Ein Glück, dass man es noch rechtzeitig erfährt. Guten Morgen, Gentlemen.«
Er setzt seinen Hut mit einer eckigen Bewegung auf und marschiert hinaus, um hinter sich die Tür derart zuzuknallen, dass die kleine Sichtscheibe zerspringt.
Einen Augenblick ist es still im Jail. Sheriff Seymour sieht zu Boden, der Deputy rechts von Cord hüstelt, und Baldwin, der zweite Deputy, reibt sich die Nasenspitze mit Daumen und Zeigefinger.
»Heißt das, Roy, dass du nach Helena mitfahren willst?«, fragt Seymour dann. »Ich müsste dich dann vereidigen, denn du kennst ja die Bestimmung.«
»Seit wann hast du Bestimmungen, Seymour?«
Seymour zieht den Kopf ein, als Roy Tiffin ihn fragt, und räuspert sich verlegen.
»Roy, du kennst Richter Crane. Zivilpersonen dürfen in einer Transportkutsche nun mal nicht mitfahren. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir uns gut kennen. Er wird Ärger machen, wenn du …«
»Dann gib mir einen Orden«, knurrt Tiffin bissig. »Das ist wahrhaftig der seltsamste Transport, den ich jemals gesehen habe. Die Deputys sind Männer der Cranes, der Sheriff hat Angst vor dem Richter Crane, und ich bin der Freund der Cranes. Und der da ist der Mann, der dabei war, als man John Crane niederschoss, wenn der Richter recht hat und ich mich täusche. Wirklich, hier transportieren lauter Crane-Leute einen Mann, der den Cranes etwas getan hat, das ist sicher auch im Sinne des Gesetzes. Aber was rege ich mich auf. Gehen wir hinaus, ich ersticke hier drin noch.«
»Himmel, Roy, hier leben nur Freunde der Cranes. Edward wird es Anne erzählen. Ich wette, er ist schon drüben und sagt es ihr. Da hast du dir was eingebrockt, Mann«, sagt Seymour seufzend. »Bist du denn wirklich nicht sicher, dass dies der richtige Mann ist?«
»Nein, ich bin nicht sicher.«
Er wirft Cord einen Blick zu, tritt aus der Hintertür in den Hof, in dem die Kutsche mit Ritchie, dem Fahrer, steht und wartet, bis die anderen mit Cord herauskommen.
Während Baldwin auf den Bock steigt und Seymour noch einmal die Polster der Kutsche durchsucht, steht Cord abwartend und von Shoan bewacht vor der Kutsche.
»Mr Tiffin?«
»Ja, Cord?«
»Sie werden den Gouverneur nicht umstimmen können.«
»Meinst du? Ich bilde mir ein, ihn ganz gut zu kennen. Das lass nur meine Sorge sein. Es sollte mir gelingen, Aufschub zu erreichen. Hör zu, hast du damals keinen der Männer deutlich gesehen?«
»Nein, ich war viel zu weit weg. Ich glaube aber, einer hat einen Schimmel geritten. Jedenfalls war sein Pferd ein heller Punkt in der Ferne.«
»Das hilft uns nicht viel, Mann. Schimmel gibt es in diesem Land wie Sand am Meer.«
Er wendet sich um, als Ritchie das Tor öffnet und drüben, jenseits der Straße, schnelle Schritte zu hören sind.
»Steig ein, schnell, Cord!«, sagt Seymour, der genau wie die anderen Anne Crane über die Straße kommen sieht. »Mach voran, Mann, und keine Narrheiten … He, Roy, jetzt bekommst du eine Predigt zu hören!«
Roy Tiffin wartet schweigend, bis Anne Crane in den Hof tritt, anscheinend erleichtert aufatmend, dass sie den Gefangenen nicht mehr sehen muss.
»Roy«, sagt sie schnell und zornig. »Du hast da einige Dinge zu Onkel Edward gesagt, die ich nicht glauben kann. Ist es wahr, dass du dich für einen Aufschub beim Gouverneur einsetzen willst?«
Ihr schwarzes Haar ist aufgesteckt. Sie trägt einen Hut, wie ihn Reiterinnen aufsetzen, hat einen Reitrock und eine dunkelgrüne Bluse an. Ihre dunkelgrauen Augen sind zornig.
»Hallo, Anne«, erwidert Roy Tiffin ruhig. »Ich habe das vor, dein Onkel hat nicht gelogen.«
»Das wagst du uns anzutun?«, erkundigt sie sich mit steigendem Zorn. »Roy, bist du närrisch? Dieser Mann ist ein Pferdedieb und Mörder. Er hat …«
»Welcher Mann?«, gibt Roy scharf zurück. »Sage mir, welcher Mann soll ein Mörder sein? Meinst du den Mann, den nur ein flüchtiger Blick von dir streifte, als die Verhandlung war? Du magst keine Diebe, und schon gar keine Banditen, die schießen. Du hast dich geekelt, ihn anzublicken. Ich kenne dich, Anne. Deine Abneigung war so groß, dass du ihn nicht mal genau angesehen hast. Das kannst du jetzt nachholen.«
»Was willst du?«, keucht sie, als er sie an beiden Armen packt. »Lass mich sofort los! Ich will dieses Scheusal nicht sehen. Loslassen, Roy, sofort!«
»Siehst du, ich habe es gewusst«, sagt er hart. »Du wirst ihn jetzt ansehen, ich will es, hast du verstanden? Worauf bildest du dir etwas ein, auf den Namen Crane vielleicht? Du hast die Pflicht, dir einen Mann genau anzusehen, den du beschuldigst, in euer Haus eingedrungen zu sein. Los, vorwärts, du kommst jetzt mit. Ich habe es absichtlich gewollt und es Edward heute gesagt, weil ich wusste, was du tun würdest. Los, geh, sonst trage ich dich.«
»Sheriff Seymour, nehmen Sie ihn fest.«
Seymour beißt sich auf die Lippen. Auch Baldwin und Shoan, beides Männer von der Crane-Ranch, rühren sich nicht. Wenngleich sie sicher eingreifen würden, um Anne Crane vor jedem anderen Mann zu beschützen, hier liegt die Sache anders. Tiffin ist so gut wie verlobt mit Anne Crane.
»Baldwin, Shoan, ihr verdammten …«
Jetzt wird sie wütend und vergisst sogar, sich wie eine Lady zu benehmen.
»Schrei nur«, erwidert Roy grimmig und trägt sie, die mit den Beinen strampelt und mit den Händen nach ihm schlägt, bis an den Wagenschlag. »Jetzt sieh ihn dir an, los, tu es! Es ist deine verdammte Pflicht, den Mann zu betrachten. Cord, steh auf, komm heraus.«
»Nein – nein! Roy, ich werde …«
Er hält Anne so eisern fest, dass sie jetzt nicht mehr zurück kann. Cord steigt aus. Und als sie den Kopf abwenden will, zwingt Roy sie, in Cords Richtung zu sehen.
»Ist es der Mann, trug der andere damals ein blaues oder ein schwarzes Halstuch vor dem Gesicht, ein grünes, ein dunkelrotes? Was für ein Halstuch, Anne?«, fragt er. »Erinnere dich, was für ein Halstuch genau? Du kannst nicht nur sagen dass es ein dunkles gewesen ist.«
»Du tust mir weh, Roy. Es war ein dunkles, es ging alles so schnell, aber es ist dieser Mann.«
»Wenn es so schnell ging und du nicht mal sicher bist, was für eine Farbe sein Halstuch hatte, dann willst du sicher sein, seine Augen im halbdunklen Flur erkannt zu haben? Sind das die Augen jenes Mannes? Sieh ihn richtig an, Anne, sage ich.«
Sie blickt in die Augen des Mannes, der noch immer ein rotes Hemd trägt. Und es ist wieder wie damals: Der rote Fleck zieht ihre Blicke wie ein Magnet an. Sie erinnert sich, dass sie nur den Schimmer eines Gesichtes über einem dunklen Halstuch und blondes Haar unter dem Hut herauslugen sah, mehr nicht. Der Mann hier sieht mit dem Ausdruck der Furcht in ihr Gesicht.
»Ich weiß nicht«, sagt sie keuchend. »Roy, es ist derselbe Mann. So genau kann ich das nicht sagen, aber er muss es sein.«
»Muss er es sein oder ist er es?«, fragt Roy drängend. »Du hast ihn mit deiner Aussage schuldig werden lassen, du allein, denke immer daran. Du hast über Leben oder Tod entschieden. Deine Aussage hat ihn an den Galgen gebracht. Mein Gott, verstehst du nicht, was ich will? Ich mag dich zu sehr, als dass ich dich der Belastung aussetzen will, die du haben wirst, wenn sich eines Tages vielleicht herausstellt, dass du es gewesen bist, die einen Mann an den Galgen geliefert hat. Anne, du bist stolz, aber gerade darin liegt die Gefahr für dich: Du könntest nie darüber hinwegkommen, einen Unschuldigen umgebracht zu haben. Verstehst du mich wenigstens?«
»Oh, mein Gott, Roy«, sagt sie stammelnd und liegt ganz schlaff in seinen Armen. »Roy, er muss es sein, er sieht genauso aus wie jener Mann. Ich kann mich nicht irren.«
»Also ist er es«, stellt Roy Tiffin bitter fest. »Du bleibst dabei, dass er es ist, meinst du das, Anne?«
»Ja, ich weiß nichts anderes. Es ist schon über einen Monat her, wie soll ich da genau wissen, was ich damals gesehen habe? Du machst mich ganz irre. Er ist es!«
»Nun gut«, antwortet er und lässt sie frei. »Für mich ist deine Aussage nicht überzeugend. Auch wenn er nach dem Sheriff gefragt hat, auch wenn er sich nach einer Ranch mit guten Pferden erkundigte, Dinge, die ihm zur Last gelegt worden sind, die man als Beweis dafür nahm, dass er ein Bandit ist, für mich sind das Fragen eines Mannes, der wirklich Arbeit suchte. Er wollte zum Sheriff, um sich nach den fünf Burschen zu erkundigen, die ihn beraubt hatten. Und er hat sich nicht etwa in dieser Gegend herumgetrieben, weil er meinte, dort am sichersten zu sein, denn niemand konnte auf die Idee kommen, dass er so viel Frechheit an den Tag legen würde, so hat es jedenfalls das Gericht ihm zur Last gelegt. Nein, er muss unschuldig sein. Anne, sie werden ihn hängen, wenn kein Wunder geschieht.«
»Du hast dich in etwas verrannt«, sagt sie bitter. »Er muss es sein, ich bin überzeugt davon …«
»Aber, Miss Crane, ich war es nicht. Bei meiner Mutter, ich habe es nicht getan«, stöhnt Cord. »Ich bin immer ein ehrlicher Mensch gewesen. Miss Crane, bitte …«
»Genug, ich will nichts hören«, erwidert sie und geht mit schnellen Schritten davon. »Mister, für mich bist du ein Bandit, ich habe dich genau gesehen.«
Cord, der ihr nachlaufen will, wird von Seymours Revolver gestoppt. Er steht, aschfahl geworden, vor Tiffin und sieht mit dem Ausdruck eines völlig Verzweifelten hinter Anne Crane her.
»Oh, mein Gott«, sagte er stöhnend. »Wie kann sie das alles sagen und tun? So wahr ich hier stehe, es wird sich aufklären, irgendwann und auf irgendeine Art. Und dann wird sie den Tag verfluchen, an dem sie mich beschuldigte.«
»Schon gut, Cord, ich weiß genau, was in dir vorgeht«, antwortet Roy Tiffin düster. »So könnte kein noch so gerissener Gauner schauspielern, davon bin ich überzeugt. Cord, sie ist mächtig stolz, und ihr Vater bedeutet ihr alles. Ich fürchte wirklich, dass eines Tages ihr Stolz zusammenbricht. Und dann wird ihr niemand helfen können. – Wir fahren, wenn ich einen Orden habe. Cord, ich werde alles tun, was ich kann, um einen Aufschub zu erreichen. Noch hängen sie dich nicht.«
*
»Stör sie nicht«, sagt James heiser und hebt die Hand. »Es ist wichtig. Wenn es nicht genau klappt, dann können wir einpacken. Sag schon, was ist, Dicker?«
Dorrey schwitzt, deutet auf die Büsche und Murdock, der zwischen ihnen kauert.
»Verdammt, bin ich geritten. Ich sage dir, die sind in einer halben Stunde hier. Vor ihnen reitet Tiffin, du kennst ihn doch.«
»Ja«, antwortet James kurz. »Er ist gefährlicher als der Sheriff und die beiden Deputys.«
»Baldwin sitzt auf dem Bock neben Ritchie. In der Kutsche sind Sheriff Seymour und Shoan ihm gegenüber. Verdammt, das geht nicht gut.«
»Ruhig!«
Dorrey schweigt. Er sieht, wie McDewey den Gaul antreibt. McDewey kommt jetzt den Weg heruntergejagt und schleift an einem Lasso eine Art Schleppscheibe hinter sich her. Das Ding besteht aus einem Stockgestell, das sie auf ein Brett genagelt haben. An das vielleicht einen Quadratyard große Gestell haben sie Pappe geklebt und auf die Pappe eine Art Zielscheibe gemalt.
Die Schleppscheibe wirbelt Staub auf, als McDewey sein Pferd fast bis zum Galopp treibt.
»Gut?«, brüllt Lispy, der etwa zwanzig Yards links von Murdock auf seinem Pferd hält, Murdock zu. »Ist es gut?«
»Ja, nicht schneller.«
»Was hat er vor?«, fragt Dorrey, der vom Endstadium ihrer Vorbereitungen nichts mitbekommen hat. »Warum soll Sid nicht schneller reiten?«
»Weil eine Kutsche auch nicht schneller hier herunterkommt«, erwidert James kühl. »Pass auf, jetzt!«
Es vergehen kaum drei Sekunden, dann ist McDeweys Pferd an den Büschen, hinter denen Murdock steckt, vorbeigerast. Und dann gibt es einen dumpfen, schwirrenden Ton. Durch die Büsche schießt ein dicker, mindestens vier Meter langer Pfahl. Er saust über den Weg auf die Schleppscheibe zu. Im nächsten Augenblick dringt sein spitzes Ende wie ein Riesenspeer durch die Scheibe. Beinahe im Zentrum durchschlägt er die Pappe. Die Schleppscheibe kippt, McDewey reißt sein Pferd zurück und hält.
»Verdammt«, sagt Dorrey bewundernd. »Alle neunhaarigen Teufelshalunken, das hat gesessen, was? Die Scheibe hat ja schon mehrere Löcher.«
»Na und?«, erwidert James achselzuckend. »Die Kutsche kann auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten hier herabrollen. Ist sie zu schnell, dann muss Murdock sie genauso treffen wie jetzt gerade, verstehst du?«
»Das Ding funktioniert, hätte ich nie gedacht.« Dorrey staunt und sieht Lispy über den Weg jagen, den überdimensionalen Speer aufheben und zwischen die Büsche werfen. »Sie sehen Murdock nicht, was? Wie habt ihr das gemacht, mit Seilen?«
»Dünne Stricke«, antwortet Murdock, der sich umdreht und zu ihnen kommt. »Wir haben zwischen den Büschen ein Dach gemacht und frisches Laub genommen. Du kannst mit vier Mann auf einer Kutsche sitzen und herabsehen, unter dem Laub bleibt alles verborgen. James, meinst du, dass es klappt?«
James geht wortlos unter das künstliche Laubdach, das vom Weg wie eine Ansammlung von Büschen wirkt, und nickt knapp. Dorrey und Murdock, die ihm gefolgt sind, blicken auf die einfache, trogförmige Holzschiene hinab, über der das Seil straff gespannt liegt.
Es ist eine so einfache Vorrichtung, dass sie keine vier Stunden gebraucht haben, um sie aufzubauen. Zwischen vier schweren Pfählen, die fest im Boden sind, haben sie einen armdicken, langen Espenast festgekeilt. Dieser Ast, schon von der Natur zu einem Bogen geformt, hat am Ende ein geteertes, stabiles Seil. So haben sie eine Riesenarmbrust gebaut, den Trog, in dem der Riesenspeer liegt, genau eingerichtet, und hinten einen einfachen Drehabzug gemacht.
Ihr Riesenspeer wird genau unter der Nabe des Kutschenrades über den Weg schießen. Er wird aus den Büschen kommen, wenn es niemand erwartet. Und dann tritt unweigerlich, treffen sie das eine Rad, die vorausberechnete Wirkung ein.
»Warum soll es nicht klappen?«, fragt James, als sie das Seil wieder spannen und den Riesenpfeil in die Trogschiene legen. »Bruce, wenn du die Nerven nicht verlierst und richtig triffst …«
»Ich treffe. Aber was ist, wenn der Pfeil zwischen den Speichen durchschießt, he?«
»Das kann er nicht, er ist zu lang dafür«, antwortet James kühl.
»Das Rad«, sagt Dorrey, »das ist weg, einfach weg, was? Ich sage euch …«
»Sag nicht zu viel über das, was vielleicht passiert«, brummt Murdock. »Wie sieht es aus, sie fahren also wieder. Und Tiffin?«
»Tiffin reitet auf seinem Pferd den anderen voraus. Manchmal hat er mehr als hundert Yards Abstand zur Kutsche.«
»Schlecht, James, was?«, wendet sich Murdock an James. »Nimm an, er ist so weit vor ihr?«
»Es wäre schlimmer, würde er nahe an ihr reiten in dem Moment«, murmelt James düster. »Bruce, da ist die Biegung, wenn er hinter ihr verschwunden ist und es schnell geht …«
Bruce Murdock sagt heiser: »Teufel, alles muss sicher sein. Warum ist Tiffin nicht in der Kutsche? Es würde alles leichter für uns sein. James, du musst …«
Joe James wirft einen kurzen Blick auf die Wegstrecke. Dort löscht McDewey alle Spuren. Während jenseits des Weges ein Hang, der vom Regen ausgewaschen ist, steil ansteigt, dessen Kante etwa sieben Yard über dem Weg liegt, ist hier Buschgelände, dem sich rechter Hand Wald anschließt.
Der Weg kommt von einem Hügel herab, er fällt sehr stark ab. Jedes Fahrzeug wird hier seine Geschwindigkeit vergrößern müssen. Etwa 30 Yards weiter zur Senke hin beschreibt der Weg einen scharfen Bogen nach rechts, weil der nächste Hügel links umfahren werden muss.
Hinter der Biegung stehen Bäume genug, der Wald ist an den Weg herangerückt. Für einen Reisenden ist dies hier eine prächtige Landschaft.
»Ich weiß, was ich muss«, erwidert James gepresst. »Tiffin ist ein Mann, der sofort schießt. Sage mir nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Wahl, wenn er kurz vor der Kutsche reitet. Sie können von der Kutsche aus, falls er weiter als vierzig Yards vor ihr ist, nicht sehen, wo er bleibt. Die Biegung verdeckt ihn. Es wird keine halbe Stunde mehr dauern, dann sind sie hier. Hat man dich gesehen, Dicker?«
Dorrey schüttelt den Kopf. Er hat sie nur beobachtet und ist dann im vollen Galopp seitlich weit entfernt an ihnen vorbeigejagt.
»Also nicht«, stellt Murdock fest. »Das ist gut. Je weniger sie sehen, desto besser ist es. Wir machen uns jetzt schon fertig. McDewey geht auf den Hang, ich werde nach dem Schuss hinter der Kutsche sein, Dorrey und Lispy drüben im Busch stecken. Hier ist verdammt viel Verkehr.«
»Anziehen!«, sagt Murdock heiser zu den anderen. »Es darf nichts passieren, ich sage es noch mal. Wir haben den ganzen Tag vor uns und müssen alles so besorgen, dass wir die Helligkeit ohne Verfolgung überstehen. In der Nacht sind wir schon weit weg, da finden sie uns nicht mehr.«
Er macht den Sack auf, nimmt fünf zusammengerollte Bündel alter Plane heraus und wirft jedem sein Bündel zu. Als sie es ausrollen, sind fünf völlig gleichmäßig geschnittene Umhänge da, an die sie Kapuzen angenäht haben, in denen Löcher für die Augen sind.
»Macht schon, jeder auf seinen Platz«, sagt Murdock gepresst. »Und vergesst nicht, es muss schnell und doch sorgfältig gehen. Entweder schaffen wir es, oder wir hängen eines Tages alle.«
Sie sehen sich einen Moment an und denken jeder auf seine Weise über Murdocks Worte nach. Schaffen sie es nicht, dann wird man sie jagen.
Und am Ende hängt man sie alle …
*
James kniet, hat die Äste unter sich und kauert hinter dem dicken Stamm der Eiche. Das Laub unter ihm ist dicht, ein grüngrauer Vorhang, durch den er den Weg sehen kann. Grau das Holz des Baumes, genauso grau wie sein Umhang, den er zusammengerafft hat.
Als er sich vorbeugt, sieht er die Wegbiegung vor sich, die Bäume, ihren Schattenfall auf dem Weg.
Und durch die Stille, die nur vom melodischen Zwitschern einiger Vögel unterbrochen wird, kommt das Rollen der Räder. Mit der linken Hand schiebt er die Zweige ein wenig beiseite. Er kann nun Lispy sehen, der zu ihm hinstarrt und ihm zuwinkt. Dann sinkt Lispy herab, er ist unter dem Busch verschwunden.
Kaum durch das Trappeln der Kutschenpferde dringend, kommt nun der Hufschlag auf.
Tiffin, denkt er und hat plötzlich einen dicken Kloß im Hals. Ich wollte, es wäre jeder andere Mann, nur nicht Tiffin. Der Bursche ist eisenhart und schlau.
Einen Moment ist die Furcht in ihm, dass der Abstand von Tiffin zur Kutsche zu klein sein könnte. Aber dann hört er den Hufschlag so deutlich, als sei Tiffin bereits vor der Biegung.
Tiffins Pferd, ein Brauner mit weißem Brustlatz, taucht an der Biegung auf. 50 Yards etwa, denkt James zufrieden. Er ist weit genug vor der Kutsche.
Er sieht ihn durch die Blätter, die der Wind leise bewegt. Tiffin hockt zusammengesunken im Sattel, der geborene Reiter, der wie ein Indianer erschlafft.
Zehn Schritte noch, dann wird Tiffin unter dem Baum sein.
Tiffin schaukelt in den Bewegungen seines Pferdes mit.
Nun zwei Schritte noch, dann ist das Pferd unter dem Ast.
James stößt sich ab.
Tiffin hat die Bewegung erkannt.
Für Tiffin taucht aus den Ästen des Baumes eine riesengroße graue Fledermaus auf. Der wallende Umhang schafft für den Bruchteil einer Sekunde den Eindruck, als segele etwas auf Tiffin zu.
Aber dass hier eine Gefahr auf ihn zukommt, das erkennt ein Mann wie Tiffin sofort. Und er handelt.
Blitzschnell hebt Tiffin beide Hacken an, schlägt sie in die Weichen des Pferdes und duckt sich tief nach links. In der gleichen Sekunde reißt seine linke Hand an den Zügeln – sein Pferd will herum. Und während Tiffin diese blitzartigen Ausweichmanöver durchführt, schnappt seine rechte Hand nach dem Revolver.
Sich umblickend, sieht er diesen großen, bedrohlichen Schatten herabstürzen, erkennt die hochgerissene Hand und das Blinken darin. Dann kracht der Mann, der ihn aus den Zweigen des Baumes angesprungen hat, auch schon knapp hinter ihm auf die Kruppe des Pferdes.
Schreien, denkt Tiffin, und plötzlich weiß er, dass nicht nur er in einer Falle steckt, er muss die anderen warnen.
Er stößt einen schrillen, lauten Schrei aus, wird aber in derselben Sekunde von der linken Hand des Mannes erwischt.
»Du verdammter Narr«, sagt der Mann heiser hinter ihm, als der Revolver auf Tiffins rechten Oberarm kracht und Tiffin seine gezogene Waffe vor Schmerz loslassen muss. »Du schreist nicht mehr.«
Es ist Tiffins einzige Chance, sich fallen zu lassen. Er macht es, greift hinter sich, erwischt den groben Stoff dieses grauen Umhanges und ruft noch einmal im Fallen: »Vorsicht, Überfall!«
Der Mann hinter ihm, der ihm mit der Behändigkeit eines Pumas auf den Boden nachkommt, holt, kaum dass sie beide unten sind, schon wieder aus.
Entsetzt sieht Tiffin hoch, und dann, für nicht mehr als eine Zehntelsekunde, sieht er, was er mit dem Griff in den harten Stoff getan hat: Er hat dem Mann die Kapuze herabgezogen. Er blickt mitten in zwei dunkle Augen und auf einen zusammengepressten Mund. Dann aber trifft ihn der Revolverlauf am Kopf. Das Gesicht, das er wie ein Zerrbild gesehen hat, verschwimmt plötzlich vor ihm. Es ist nur die Erinnerung an diese dunklen Augen, die ihm bleibt, als er die Besinnung verliert. Und es ist ein letzter Gedanke, der ihm durch den Kopf schießt: Hoffentlich haben sie mich gehört.
*
»He«, sagt Baldwin, als es neben ihm knirscht. »Ritchie, du verdammter Narr, lass das Saufen, wenn Tiffin es sieht …«
»Sieht er nicht«, Ritchie grinst, setzt die Flasche an die Lippen und nimmt einen anständigen Zug. »Nachdurst, sage ich dir, ist gut. Ich wette, Seymour hat einen Brummschädel und glaubt, dass er Ameisen im Gehirn hat. Mann, was hat der gestern Abend reingeschüttet. Hör mal, willst du auch?«
Baldwin schüttelt den Kopf. Sie haben in Drummond übernachtet, Cord eingesperrt und dann ein wenig getrunken. Seine Furcht, dass Seymour, einmal auf eine Flasche losgelassen, auf den Geschmack kommen würde, hat sich bestätigt. Der Sheriff ist wankend in das Zimmer gekommen und hat heute früh mit Kaffee seinen Kater weggespült.
Ritchie trägt ständig eine Flasche bei sich. Wie er sagt, sei das die beste Medizin, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
»Na, nimm schon«, brummt Ritchie und reicht ihm die Flasche. »Tiffin ist hinter dem Hügel verschwunden, der sieht es nicht … Nimm!«
»Nur einen Schluck«, murmelt Baldwin, trinkt und steckt die Flasche dann hastig unter den Sitz, als sie über die Kuppe kommen. »Ritchie, schaffen wir es bis zum Abend?«
Ritchie rülpst einmal laut. Die Kutsche wird schneller. Sie rollen in die Senke.
Ritchie schwenkt die Peitsche, sieht Baldwin an und sagt: »Darauf kannst du wetten. Zwei Stunden vor Mitternacht sind wir in Helena und den Vogel da drin los. Ich werde dir was sagen, Baldwin, obwohl es dich vielleicht ärgert: Tiffin kennt was von Menschen.«
»Was heißt das?«, fragt Baldwin. »Willst du sagen, er hätte recht?«
»Vielleicht, verdammt ja, vielleicht«, erwidert Ritchie. »Wir haben gestern bei Einbruch der Dunkelheit gewartet, dass sich diese Burschen zeigen sollten, aber ist einer gekommen? Du hast doch selbst gesagt, sie hätten nur auf dem Transport eine Chance, ihn zu befreien, und das am besten kurz vor der Nacht, weil sie dann mit ihm ungesehen verschwinden können. Na und, es ist Nacht geworden und sind sie gekommen?«
Baldwin, der heute früh dieselben Worte von Tiffin gehört hat, flucht lauthals.
»Das ist kein Beweis, für mich nicht, Ritchie. Der Bursche hat vielleicht mit den anderen Streit bekommen.«
Sie sind vom Hügel herunter und so schnell geworden, dass das Rumpeln der Räder eine Unterhaltung fast unmöglich macht, wenn sie nicht dauernd schreien wollen.
In dieser Sekunde hört Baldwin es, und es kommt ihm vor, als käme es von vorn. In diesem Geknatter, Gerassel und Dröhnen der Räder ist schlecht zu unterscheiden, aus welcher Richtung der Ruf kommt.
»He, Ritchie, hörst du?«
Er brüllt Ritchie an, der den Kopf herumdreht. Ritchie hört jedes fremde Geräusch, das mit seiner Kutsche zu tun hat. Er wird sofort merken, wenn ein Rad ausgeschlagen ist, einer der Reifen sich gelöst hat und klappert, aber den Schrei, den hat Ritchie nicht gehört.
So kommt es, dass die Kutsche mit unverminderter Geschwindigkeit noch einige Meter weiterrollt.
»Ritchie, da ruft jemand. Hörst du nicht?«
Und wieder der Ruf, diesmal lauter, wenn auch undeutlich.
»Vorsicht, Überfall!«
Auch Ritchie hat es jetzt gehört. Er duckt sich jäh, reißt mit der rechten Hand die Peitsche hoch und schlägt einmal wild über die Pferde hinweg. Er hat zweimal einen Indianerangriff auf seine Kutsche erlebt. Und wenn es auch Jahre zurückliegt, Ritchie weiß genau, dass er nur schnell sein muss, um entweder durchzubrechen oder davonzujagen.
Durch die Kutsche geht ein Ruck, als die Pferde anspringen. Rechts, keine drei Meter vor ihnen, stehen einige dichte Büsche, auf die Baldwin sein Gewehr richtet, hinter denen er etwas vermutet. Aber noch im Schwenken des Gewehres sieht er, wie etwas aus dem grünen Laub herausgeschossen kommt.
Für Baldwin sieht das Ding wie eine große grüne Schlange aus. Er feuert sofort blindlings auf die Büsche, glaubt noch einen Schrei zu hören und hat dann ein anderes Geräusch in den Ohren.
Jene grüne Schlange, auf die Murdock mit schreckgeweiteten Augen starrt, als sie davonzischt, schießt genau zwischen den Zweigen durch. Dann aber trifft sie das rechte Vorderrad der Kutsche. Ohne den Mann auf dem Bock sehen zu können, den das künstliche Dach über Murdock verdeckt, hat Murdock nur Augen für seinen Riesenspeer.
Es sieht so aus, als sause etwas in eine flimmernde Scheibe hinein. Und dann passiert alles sehr schnell. Er sieht nur, wie der dicke Speer sich hochstellt.
In der nächsten Sekunde knallt es ohrenbetäubend. Die Kugel aus Baldwins Gewehr faucht durch die Blätter. Es ist ein Hieb, der Murdocks linke Hüfte trifft und ihn aufschreien lässt. Er hat nichts von dem Abschuss gesehen, er hat nur das tosende Krachen in den Ohren und spürt den Schmerz.
Als er nach vorn auf das Gestell kippt, das nach James Ideen gebaut worden ist, sieht er, wie das Rad sich auflöst.
Er sieht die Speichen wie dünne Streichhölzer nach allen Richtungen davonfliegen. Vor seinen Augen bricht das Rad zusammen.
Aber es kommt noch schlimmer.
Die Kutsche, durch die Pferde in volle Fahrt gebracht, neigt sich plötzlich nach rechts.
Das ist alles, was Murdock sieht. Dann rutscht er stöhnend ab und hat urplötzlich das Gefühl, dass seine linke Seite verbrennt..
Baldwin, der gerade gefeuert hat, hört direkt neben sich Ritchie sagen: »Festhalten!«
Der alte Ritchie erkennt es sofort, er weiß es in der Sekunde, als das Geräusch von splitterndem Holz an sein Ohr dringt. Das rechte Rad fliegt in Stücke.
Was dann passiert, ist das Werk von wenigen Augenblicken.
Der Bock neigt sich nach rechts. Die rechte Achswelle ratscht über den Boden.
Und dann ist die Hölle los.
Baldwin hat das Gewehr immer noch in den Händen und will sich umdrehen, um noch einmal zwischen die Büsche zu schießen. Er erhebt sich halb, als Ritchie neben ihm losbrüllt. Aber kaum ist er hoch, als er plötzlich kippt. Baldwin stürzt nach hinten. Unter ihm sackt die Kutsche weg.
Der alte Ritchie hat die Leinen blitzschnell losgelassen und stürzt in den Fußraum. Vor ihm verschwindet Baldwin, der sein Gewehr krampfhaft festhält, wie ein Spuk vom Bock.
Baldwin fliegt im hohen Bogen mitten in einen Busch. Sein Kopf schlägt schwer auf. Er ist einen Moment ganz benommen.
In der Kutsche aber, die noch einige Meter weiterschliddert, ist die Hölle los.
»Was ist das?«, fragt Seymour heiser. »Shoan, sieh mal hinaus.«
Shoan, den der Ruck, mit dem die Pferde angezogen haben, einen Moment in die Polster gedrückt hat, sieht gerade noch, wie sich Cord mit Mühe auf dem Vordersitz halten kann.
Während Seymour und Shoan auf dem hinteren Sitz Platz genommen haben, sitzt Cord mit dem Rücken zur Fahrtrichtung.
Shoan, das Gewehr zwischen den Knien, beugt sich aus dem Fenster und hört in derselben Sekunde den Schuss. Dann kracht es irgendwo, als bräche Holz in tausend Stücke.
Ehe Shoan noch handeln kann, kippt die Kutsche plötzlich weg.
Dadurch fliegt er plötzlich nach vorn. Er sieht den Türrahmen rasend schnell auf sich zukommen. Dann schlägt er auch schon mit voller Wucht gegen den Rahmen.
Für Sekunden, die eine Ewigkeit zu dauern scheinen, bleibt er wie betäubt liegen.
Seymour, der neben ihm gesessen hat, wird bei dem Aufprall vom Sitz geschleudert. Er schießt quer durch die Kutsche, sieht entsetzt, dass er auf die Vorderwand zufliegt und hört Cords heiseren, erschrockenen Schrei. Dann prallt Seymour gegen den Sitz. Einen Moment liegt er so, danach rutscht er nach rechts ab. Er fällt gegen die Tür der schief auf dem Weg liegenden Kutsche. Und ehe er es noch begreifen kann, prallt er gegen den Türdrücker. Ein Schnappen, ein Ruck, er kippt nach hinten und stürzt rücklings aus der Kutsche.
Urplötzlich findet er sich neben dem Weg und dicht vor einem der Büsche wieder. So schnell dürfte er noch nie aus einer Kutsche herausgekommen sein.
Kenneth Cord liegt mit dem Rücken auf dem Vordersitz. Cord hat sich den Rücken gestoßen, sein Hinterkopf schmerzt, aber ihm fehlt sonst nichts.
Und in das wilde, erschrockene Prusten der Pferde mischt sich plötzlich der Schrei eines Mannes.
Mit überschnappender Stimme ruft er: »Fallen lassen! Das Gewehr weg!«
Baldwin, einen Augenblick benommen, stemmt sich hoch, hat das Gewehr immer noch und sieht einen Mann aus den Büschen springen.
Mit einem heiseren Fluch reißt Baldwin das Gewehr herum. Er will noch feuern, aber es ist zu spät. Der Mann dort, der einem vermummten Anhänger der Ku-Klux-Klan-Bewegung ähnelt, ruft ihm eine Warnung zu. Baldwin will schießen, hat das Gewehr auch in der richtigen Position, kommt aber nicht mehr zum Abdrücken.
Brüllend löst sich der Schuss aus einem Revolver. Dann trifft die Kugel Baldwins Schulter und schleudert den Mann, der noch auf den Knien am Boden kauert, nach hinten. Er verliert stöhnend das Gewehr aus den Händen und liegt in der nächsten Sekunde flach am Boden.
Auf dem Bock will Ritchie hoch, hört die Worte über sich und erstarrt.
»Nimm die Hände hoch, sonst drücke ich ab.«
Ritchis Arme gehen ruckhaft nach oben. Irgendwo hat er einmal ein Bild von Black Bart gesehen. Und die Gestalt dort oben am Hang, das Gewehr vor dem Umhang auf ihn gerichtet, gleicht Black Bart aufs Haar.
Keuchend kommt in der Kutsche Shoan hoch. Er kriecht, immer noch völlig verwirrt, auf die Tür zu, stößt sie auf, hört wie durch Watte einen Schrei, nimmt instinktiv sein Gewehr und will aus dem Kasten klettern, der seltsam schief liegt.
Kaum aber erscheint das Gewehr, schiebt sich Shoans Hand heraus, als jemand ruft: »Lass fallen, ich schieße!«
Shoan nimmt diese Worte kaum wahr, er will nur hinaus.
Dann aber kommt der grollende, wilde Knall des Gewehres. Entsetzt sieht der alte Ritchie, wie das Gewehr oben am Hang eine Feuerlanze ausspuckt. Dann brüllt Shoan. Die Kugel trifft seinen rechten Arm, dessen Finger sich spreizen. Shoans Gewehr fällt nach außen und klatscht auf den Weg. Der Deputy aber bleibt in der Tür liegen und wimmert vor Schmerz.
Noch schlimmer ergeht es Sheriff Seymour.
Er kommt hoch, will nach dem Revolver greifen und sieht plötzlich direkt vor sich einen Mann stehen.
Und es ist das erste Mal, dass Lispy etwas sagt, obwohl er eigentlich keinen Ton von sich geben sollte.
»Lass das sein, du sti – stirbst!«
Lispy drückt Sheriff Seymour nach diesen Worten sein Gewehr vor die Brust. Seymour hebt die Hände über den Kopf.
»Pass auf ihn auf«, hört er einen Mann von oben sagen. »Rührt er sich, dann mach’s kurz!«
Von rechts ertönt in der nächsten Sekunde Hufschlag. Und als er den Kopf wendet, sieht er Roy Tiffin quer über seinem Pferd liegen. Im Sattel aber sitzt ein großer Mann, der bei der Kutsche abspringt und seinen Revolver zieht, während er zum Kasten stürmt.
Tiffin, das sieht Seymour genau, ist an Händen und Beinen gebunden.
»Raus, Cord«, sagt der Mann knarrend neben der Kutsche. »Los, komm raus!«
»Nein«, erwidert Cord keuchend, der sich in die Ecke gedrückt hat. »Ich will nicht, Mister. Wer seid ihr, was wollt ihr von mir?«
»Das erfährst du noch früh genug, Cord. Komm schon. Die Narren werden dir doch nichts glauben, sie hängen dich einfach, wenn du bleibst. Komm jetzt raus, wir haben keine Zeit.«
»Mister, wenn ihr die Burschen seid, die Crane niedergeschossen haben, dann sag ihnen, dass ich nicht zu euch gehöre.«
»Das kann ich tun«, erwidert der Mann unter dem Umhang hämisch. »Aber, Junge, ob sie mir glauben und dich freilassen, das weißt du so wenig wie ich. Du könntest auch der sechste Mann gewesen sein, wie? Sie wollen dich nun mal hängen sehen, Cord. Und vielleicht erzählen sie dir nachher, dies sei ein Trick. Wir wären mit fünf Mann hier aufgetaucht, um sie zu bluffen und dich als unschuldig hinzustellen. Los, raus, sonst hole ich dich.«
»Ich will nicht«, sagt Cord. »Ich habe nichts getan, Mister. Wenn ihr es bestätigt, dann müssen sie mir glauben.«
»Zum Teufel, raus mit dir!«
Der Mann richtet seinen Revolver auf Cord. Der schluckt nur, steigt dann aus und sieht Seymour am Boden knien.
»Sheriff«, sagt er gepresst, »ich gehöre nicht zu denen, ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Das ist die Wahrheit. Sheriff, glaubst du mir jetzt?«
»Keine Reden …, zur Seite!«, faucht der große Mann mit dem Umhang. »Setz dich da hinten auf den Boden, Cord und sei still! Seymour, hast du noch eine Waffe?«
Er tritt hinter den Sheriff, nimmt dessen Revolver und tastet ihn ab. Der vierte Mann, der oben am Hang gestanden hat, kommt nun in langen Sprüngen runter, winkt Ritchie vom Bock und zwingt den Mann, Shoan aus dem Kasten zu ziehen.
»Nimm ihm die Waffe weg und wirf sie mir zu.«
Ritchie gehorcht. Er hat seinen Revolver oben auf dem Bock gelassen und hört aus dem Busch den fünften Mann sagen: »Drei, pass allein auf! Zwei soll herkommen, ich brauche ihn!«
Die Stimme hört sich gepresst an. Das ist es, was Ritchie auffällt.
Der eine Mister, er muss nicht sehr groß sein, hat Baldwin entwaffnet, schleift ihn neben den Sheriff und verschwindet dann. Zwischen den etwa sieben Yards entfernten Büschen hört Ritchie ihn mit dem fünften Mann flüstern.
Gleich darauf sagt der Mister, der zu den Büschen gegangen ist: »Fesselt sie und macht die Kutsche klar. Die Achse ist nur wenig verbogen, richtet sie und dann weg.«
Während einer der Banditen Seymour den Schlüssel abnimmt und Cord losschließt, kommt ein anderer mit einem Rad herbei. Die anderen beiden Banditen fesseln Seymour, verbinden Baldwin und Shoan und zerren sie dann alle hinter die Büsche. Das Knarren einer Klinkenwinde ist zu hören. Die Kutsche ächzt, Hammerschläge dröhnen. Tiffin, der aufgewacht ist, fragt heiser: »Hallo, Leute, hat Cord zu euch gehört oder nicht?«
»Tiffin«, erwidert der große Mister kalt, »Cord ist unschuldig. Er hat nie zu uns gehört. Das ist die reine Wahrheit. Wir werden ihn mitnehmen und so weit wegbringen, dass ihn kein Narr mehr für etwas hängen kann, was er nicht getan hat. Sobald im Helena Herald steht, dass er nichts mehr zu befürchten hat, kann er gehen, wohin er will, aber nicht eher.«
»Mann, ich werde dafür sorgen, dass er freikommt. Nehmt ihn nicht mit, er wird nicht mehr gehängt.«
»Das sagst du«, entgegnet der Große grimmig. »Zum Teufel mit dem Gesetz, von uns traut ihm niemand mehr. Gib dir keine Mühe, Tiffin, er reitet mit uns.«
»Seid ihr so dumm, dass ihr nicht begreift, dass man hinter euch her sein wird?«, fragt Tiffin. »Verdammt, du bist ganz schön schnell, Mann. Mein Kopf brummt mächtig.«
»Tut mir leid, es ging nicht anders«, antwortet der Große bissig. »Wir wollten nicht schießen, aber ihr habt uns keine andere Wahl gelassen. So, nun los.«
Zuerst tragen sie Seymour in die Kutsche. Tiffin, der wenig später zur Kutsche geschafft wird, sieht, dass sie an alles gedacht haben müssen, sie haben sogar ein Rad für die Kutsche hergeschafft.
Keine drei Minuten später rollt das Gefährt an. Alle müssen in der Kutsche am Boden bleiben, während zwei der Banditen rechts und links sitzen. Es geht durch den Wald, über steiniges Gelände.
»Wie weit wollt ihr uns bringen?«, fragt Tiffin lauernd. »Ihr habt sicher alle Spuren verwischt, he? Was wollt ihr tun?«
»Ehe sie euch finden, wird es dunkel sein, Tiffin. Ihr werdet so gebunden, dass ihr euch nicht selbst befreien könnt. Verlass dich darauf. Die Pferde nehmen wir weit genug mit. Tiffin, komm uns nicht nach. Ich weiß, du bist ein halber Indianer und verstehst dich auf Spuren. Also, komm nicht nach, das ist eine Warnung«, antwortet der Große.
Roy Orwell Tiffin schweigt. Er ist plötzlich sicher, dass dieser Mann ihn ganz genau kennen muss. Das könnte einige Dinge bedeuten, über die sich nachzudenken lohnen wird.
Vorläufig aber haben weder Seymour noch er eine Chance. Diese Burschen sind gerissen. Und wenn sie Glück genug haben, wird man sie wieder nicht fangen. Sie haben Cord befreit, um keinen Unschuldigen für sich bezahlen zu lassen. Das ist immerhin etwas, was Tiffin irgendwie imponiert, auch wenn sie dabei Baldwin und Shoan angeschossen haben. Sechzig Meilen vor Helena.
Sechzig Meilen bis zum Galgen …
*
Als er die Tür aufgehen sieht und der Mann erscheint, trifft es Roy Tiffin wie ein Schlag mit geballter Faust, denn der Mann ist blond, trägt ein blaues Hemd und sollte, wenn es nach Richter Crane gegangen wäre, längst hängen.
Tiffin beobachtet Kenneth Cord, der sich umsieht, um danach schnell über den Hof in das Hauptgebäude zu gehen.
Vor Tiffin liegen vier Corrals mit mehr als 30 Pferden. Es ist brütende Mittagshitze, und was immer Cord dazu gebracht haben mag, sein Versteck, das kleine, schuppenartige Blockhaus, zu verlassen, das Mittagessen dürfte ein Hauptgrund gewesen sein.
Tiffin studiert jede Einzelheit dieser Pferdehandlung.
Tiffin denkt daran, dass er heute den siebten Pferdehändler besucht.
Unwillkürlich denkt er daran, dass es sicherlich ein dummer Zufall ist, wenn es ausgerechnet bei dem siebenten Pferdehändler einen Erfolg gibt. Doch hat die Sieben in Roy Tiffins Leben immer eine bestimmte Rolle gespielt. Sie ist sozusagen zu seiner Glückszahl geworden. Wenn er nun, nach mehr als drei Wochen, die richtige Spur entdeckt hat, dann hat er es nur seiner angeborenen Sturheit zu verdanken.
Einen Moment erinnert er sich an die vergebliche Suche nach den fünf Banditen und Cord. Sie haben damals sämtliche Sheriffs benachrichtigt, und es hat Männer genug gegeben, die sich die Belohnung verdienen wollten, aber niemand hat etwas von den fünf Männern gesehen.
Hier aber, die Pferdehandlung liegt jenseits der US-Grenze auf kanadischem Gebiet, will es der Zufall, dass Tiffins logische Bemühungen endlich einen Erfolg haben.
Roy Tiffin zaudert noch einen Augenblick, dann lässt er seine beiden Pferde am Bachrand stehen, schlägt sich durch die Büsche und läuft geduckt auf den Stall zu. Rechts neben dem Stall steht eine kleine Blockhütte. Vielleicht hätte jemand Tiffin gesehen, wenn er offen herangeritten wäre, aber niemand taucht auf. Tiffin huscht hinter dem Stall entlang. Dann drückt er sich um die Ecke, läuft zum Blockhaus und bleibt am offenen Fenster stehen.
Als er sich hochzieht und in den verlassenen Raum einsteigt, sieht er das Bett, den Schrank, und findet im Schrank das rote Hemd, das Cord bei dem Überfall getragen hat.
Aha, denkt er zufrieden, es stimmt alles. Kein Zweifel, sie haben ihn hergebracht. Und er ist klug genug gewesen, hier abzuwarten, was der Richter in Helena beschließen würde.
Sein Blick wird auf die Zeitungen gelenkt, die auf der Bank gestapelt liegen. Cord hat regelmäßig den »Helena Herald« gelesen, aber die Ausgabe von vorgestern ist noch nicht dabei. Obwohl Tiffin Zeit hat und den Raum gründlich durchsucht, findet er keinen Hinweis auf die Männer, die Kenneth Cord hergebracht haben müssen. Dort liegen die Zeitungen mit der Aufforderung an Kenneth Cord, sich in Helena zu melden. Diese Aufforderungen haben Cord Straffreiheit zugesichert, aber es muss Cord klar geworden sein, dass sie ihn nur sehen wollten, um ihn über jene fünf Männer auszufragen.
Er ist nicht hingeritten, denkt Tiffin. Es sieht nicht so aus, als hätten sie ihn hier mit Gewalt festgehalten. Sicher hat er sich gesagt, dass er sie nicht verraten könnte und ist freiwillig geblieben, um abzuwarten, bis man das Urteil aufhebt. Er deckt sie also. Und er muss sie gut kennen, denn er ist mindestens drei Tage mit ihnen auf der Flucht gewesen. Nun, ich bin neugierig, was er dazu sagen wird.
Tiffin steckt sich eine Zigarette an, raucht am Hinterfenster und legt die Zeitung von vorgestern aufgeschlagen auf den Tisch.
Es vergehen etwa zwanzig Minuten. Dann hört er das Klappen der Haustür. Und als er aus der Tiefe des Blockhauses durch das Fenster blickt, sieht er Kenneth Cord über den Hof kommen.
Roy Tiffin stellt sich hinter den Schrank und verhält sich still. Cord kommt herein. Roy Tiffin sieht, wie er zum Tisch geht. Einen Moment blickt er, starr am Tisch stehen bleibend, auf die aufgeschlagene Zeitung. Er scheint zu lesen, und zuckt plötzlich zusammen.
Erst in diesem Augenblick scheint es Cord bewusst zu werden, dass die Zeitung niemals von allein auf den Tisch gekommen sein kann. Hätte sie Quinton, der Besitzer der Pferdehandlung, zu ihm gebracht, würde Quinton zumindest mit ihm über den fett gedruckten Absatz auf der ersten Seite geredet haben.
In der nächsten Sekunde blickt Cord sich lauernd um. Er scheint die Blicke Tiffins in seinem Rücken wie Nadelstiche zu spüren. Und dann sieht er den Mann hinter dem Schrank. Er sieht Tiffin starr an und wird kreidebleich.
»Hallo, mein Freund«, sagt Tiffin ganz ruhig. »Erschrocken?«
Cord schluckt einige Male, sein Blick huscht durch die ganze Hütte. Aber als er niemand außer Tiffin entdeckt, entspannt sich sein Gesicht wieder.
»Hallo, Tiffin«, erwidert er gepresst und stemmt beide Hände auf den Tisch. »Was wollen Sie hier?«
»Nun, das hast du doch gesehen, oder?«, erwidert Tiffin und kommt zum Tisch. »Da liegt die Zeitung. Du bist ein freier Mann, Cord. Es hat etwas lange gedauert, aber die haben die Anklage zurückgenommen und das Urteil aufgehoben. Du kannst gehen, wohin du willst. Ich dachte, ich sollte dir das sagen.«
»Hm, danke«, antwortet Kenneth Cord. »Aber, Mr Tiffin, wie haben Sie das hier gefunden? Woher haben Sie gewusst, dass ich hier bin?«
Tiffin sieht ihn offen an und lächelt.
»Gewusst?«, fragt er träge. »Ich habe geraten, Junge. Ich will nicht sagen, dass diese Burschen einen Fehler gemacht haben, aber sie mussten irgendwo jemand haben, bei dem sie ihre gestohlenen Pferde verkaufen konnten. Hier, wie?«
In Cords Augen glimmt es auf, dann sieht er zur Seite und presst die Lippen zusammen.
»Du willst nichts sagen, denke ich«, sagt Tiffin kühl. »Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist zu schweigen, denn ich werde sie finden, Cord. Dies hier ist kanadischer Boden, bis zur Grenze sind es mehr als achtzehn Meilen. Quinton hat immer gewusst, dass die Pferde, die er kaufte, gestohlen waren. Ich wette, sie haben sie hier umgebrannt, und er hat sie dann nach einiger Zeit verkauft. Weil die Pferde niemals wieder zurück auf amerikanisches Gebiet kamen, ist es auch keinem aufgefallen, dass sie einmal gestohlen wurden. Es ist doch so, oder?«
»Ich sage nichts«, antwortet er verbissen. »Mr Tiffin, diese Männer haben mir geholfen. Ich weiß nicht, ob man mich aus dem Jail entlassen hätte. Auch Sie wissen das nicht. Wären diese fünf Männer nicht gewesen, hätten sie mich vielleicht gehängt. Niemand hat mir glauben wollen.«
»Ja, ich weiß«, gibt Tiffin bitter zurück. »Du hast recht, Junge. Es hätte immer noch keinen Beweis für deine Unschuld gegeben, vielleicht Wochen gedauert, bis man dich herausgelassen hätte, aber herausgekommen wärst du.«
»Nicht ohne den Überfall«, sagt Cord. »Ohne das Auftauchen der Männer hätte es vielleicht einen Aufschub der Hinrichtung gegeben, mehr nicht. Das wissen Sie so gut wie ich. Machen wir uns nichts vor, diese Männer haben einen Überfall riskiert und mir geholfen. Ich bin nicht der Mann, der seine Helfer verrät, niemals, Tiffin!«
»Du kennst sie also?«
»Und wenn?«, fragt Ken Cord bitter. »Ja, ich kenne sie. Ich weiß, wie sie aussehen, ich kenne ihre Vornamen, aber ich werde sie niemals verraten, ganz gleich, was sie getan haben.«
Tiffin presst die Lippen zusammen, nimmt die Zeitung hoch und schlägt sie auf. Dann hält er das aufgeschlagene Blatt Cord vor die Augen und fragt kalt: »Und das hier, das hast du auch nicht gelesen, wie?«
Cord liest, fährt zusammen und sieht Tiffin mit großen, verstörten Augen an.
»Das ist nicht wahr!«, stößt er hervor. »Tiffin, ist das ein Trick? Ich denke, Crane war nur verwundet? Woran ist John Crane gestorben?«
Roy Tiffin bemerkt das Aufflackern in Cords Augen, die Blässe in dessen Gesicht und legt die Zeitung auf den Tisch zurück.
»Die Lunge«, sagt er dann. »Die Wunde war schon verheilt. Der Doc glaubte, sie säße höher, in Wirklichkeit hat die Kugel den oberen Lungenflügel durchbohrt. Vor zwei Wochen begann Crane zu husten, er spuckte Blut. Danach kam Fieber. Er ist vor vier Tagen gestorben, an der Kugel, die ihm einer der Burschen in die Brust jagte. Das ist Mord, Cord, oder?«
»Großer Gott«, erwidert Cord erschüttert, »das haben sie sicher nicht gewollt. Tiffin, wenn jemand nach acht Wochen stirbt …«
»Es bleibt trotzdem Mord«, unterbricht ihn Tiffin grimmig. »Cord, ich bin nicht hinter ihnen her, weil ich immer noch ein Freund der Cranes bin. Ich war Deputy-Sheriff, als sie die Kutsche überfielen, und ich bin es immer noch. Ich will diese Männer haben. Wenn du nicht reden willst, dann kann ich das verstehen. Aber, mein Freund, Quinton hat gestohlene Pferde gekauft. Das ist hier genauso strafbar wie bei uns. Es gibt nur einen Unterschied: Man bestraft in diesem Gebiet niemand, der bei uns Pferde stiehlt. Du hast ihnen versprochen, zu schweigen, und du willst dein Versprechen halten, aber Quinton wird reden müssen. Ist er allein hier, Cord?«
Kenneth Cord zuckt die Achseln.
»Ich weiß nichts«, sagt er mit der Verbissenheit eines Mannes, den man unschuldig vor eine Jury bringt. »Ich sage überhaupt nichts, Tiffin. Ehe ich jemals dem Gesetz helfe, das mich, obwohl ich unschuldig war, aufhängen wollte, beiße ich mir die Zunge ab. Fragen Sie Quinton, fragen Sie ihn doch.«
Einen Moment schweigt Roy Tiffin, dann sagt er leise: »Es mag sein, dass du voller Bitterkeit steckst, Ken, aber deine Art von Dankbarkeit ist diesen Männern gegenüber nicht angebracht. Kann sein, dass ein paar von ihnen ganz anständige Burschen sind, aber einer unter ihnen ist ein Mörder. Wenn man dich nicht wie den letzten Dreck behandelt hätte, würdest du anders denken. Nun gut, ich werde jetzt Quinton besuchen. Wirst du ihn warnen?«
Ken Cord, die Lippen fest zusammengepresst, blickt starr an ihm vorbei und schweigt.
»Ken«, fragt Tiffin noch mal, »du willst ihn doch nicht wirklich warnen? Du hilfst einem Mann, der gestohlene Pferde gekauft hat?«
»Und wenn?«, faucht Cord bissig. »Und wenn er es zehnmal gemacht hat, Tiffin. Dies ist kein Staat der USA, hier hat kein US-Deputy etwas zu suchen. Tiffin, der Mann hat mich anständig behandelt, ich werde ihm eine Chance geben. Das bin ich ihm schuldig.«
»Du bist verrückt, Mann«, knurrt Tiffin wütend. »Das gibt ein Unglück. Cord, zwinge mich nicht zu etwas, das du bedauern müsstest.«
Cord weicht zurück, als Roy Tiffin auf ihn zukommt.
»Such sie drüben, aber nicht hier«, sagt er keuchend. »Tiffin, ich bin noch nie jemand etwas schuldig geblieben. Geh weg, sonst …«
»Nun gut«, antwortet Roy bitter und dreht sich um. »Tut mir leid, Cord, ich werde ohne Waffe zu ihm gehen. Vielleicht ist dir das Recht, wie?«
Er zieht seinen Revolver, wirft ihn auf den Tisch und wischt sich über die Stirn. Dann macht er zwei Schritte und weiß genau, was Cord nun tun wird.
Kenneth Cord, den die Rancher, bei denen er arbeitete, schon als rechthaberisch bezeichneten, hat weder die Prügel noch die beiden Löcher vergessen, die man ihm zufügte, als man ihn als Pferdedieb jagte. Und er wird genauso wenig vergessen, dass er um ein Haar an einem Strick sein Leben ausgehaucht hätte.
Kaum hat Cord den Revolver vor sich auf dem Tisch liegen, kaum geht Tiffin zwei Schritte, als Cord sich bewegt. Er sieht den Revolver und die Chance, Tiffin an seinem Vorhaben zu hindern.
Kenneth Cord streckt bereits die Hand aus und hat den Revolver beinahe erreicht.
»Das«, sagt Tiffin bitter, »habe ich mir gedacht, Junge. Lass das!«
Aber Cord wirft sich auf den Tisch, kann den Kolben erreichen und reißt die Waffe hoch. In derselben Sekunde schlägt Tiffins linke Faust mit voller Wucht auf Cords Oberarm. Der Revolver fliegt aus Cords Hand, aber dann wirft sich Cord geistesgegenwärtig am Tisch vorbei. Er bringt den Tisch zwischen sich und Tiffin. Und während er versucht, hinter dem Tisch auf das Fenster zuzustürmen und Tiffin ihm nachspringt, schreit er brüllend los.
Tiffin ist um eine Sekunde zu spät herumgewirbelt und hat Cords Schnelligkeit unterschätzt.
»Quinton, Vorsicht, ein Deputy!« Cords Stimme gellt durch die Hütte, dringt nach draußen, muss im Hof zu hören sein. »Quinton, Achtung, hier ist ein Deputy von drüben! Quinton, pass auf, er weiß alles! Quinton, er ist hinter den fünf Mann her! Pass auf, Quinton, er …«
»Du verdammter Narr!«, keucht Tiffin und gibt ihm einen Stoß, als er aus dem Fenster hechten will. »Jetzt haben wir den verdammten Ärger am Hals!«
Roy Tiffins Stoß schleudert Cord aus der Bahn. Statt durch das offene Fenster zu springen, stößt Cord gegen die Wand. Er prallt mit voller Wucht gegen die dicken Stämme.
Sein Geschrei verstummt sofort. Er bleibt regungslos am Boden liegen. Tiffin wirbelt blitzschnell herum. Er nimmt den Revolver und rennt auf die Tür zu. Er weiß plötzlich genau, dass Quinton, wenn er eine Waffe in der Nähe gehabt hat, tödlich gefährlich sein wird. Es dürfte auch klar sein, dass Quinton in Kanada gestohlene Pferde verkauft haben muss. Quinton wird sofort schießen.
Tiffin schleudert die Tür auf und rennt über den Hof. Er weiß genau, dass er hier keine Deckung hat, aber er hofft, dennoch schneller als Quinton zu sein, der wahrscheinlich erst eine Waffe holen muss. Yards sind es vom Blockhaus bis zum Hauptgebäude. Roy Tiffin rennt auf die Hintertür des Hauses zu. Er hat den gespannten Revolver in der rechten Faust, starrt auf die geschlossene Tür und das schmale, offen stehende Fenster neben ihr.
Noch dreißig Meter.
Und dann taucht der Mann hinter dem schmalen Fenster auf.
Verdammt, denkt Tiffin noch, als er den Gewehrlauf sieht, der schießt. Dann zuckt der Lauf herum.
Quinton feuert sofort. Er hat Cords Warnrufe gehört und augenblicklich gehandelt.
Das Gewehr spuckt Feuer und Rauch aus.
Und Tiffin ist mitten im Hof, auf einer völlig ungedeckten Fläche. Er hat so gut wie keine Chance.
Roy Tiffin hechtet aus vollem Lauf zur Seite.
Tiffin prallt auf, hört den brüllenden Donner des Abschusses, dann faucht die Kugel haarscharf links vorbei und bohrt sich hinter ihm in den Boden. Eine Staubwolke weht hoch, eine andere entsteht, als Tiffin sich rollt. Er sieht genau, wie die Mündung der Waffe wackelt. Ein Zeichen, dass Quinton nachlädt. In dem Moment, wo der Lauf wieder herunterzuckt, rollt sich Tiffin nach links.
Und dann feuert er aus der Rolle auf das schmale Fenster. Auf fünfundzwanzig Meter kann er niemals genau treffen. Aber er hat die Chance, Quinton zu verwirren. Den Einschlag seiner Kugel erkennt er nicht. Dafür schießt die zweite Feuerlanze aus dem Fenster. Die Kugel fährt puffend neben ihm in den Boden.
Verzweifelt bleibt Tiffin liegen. Er weiß ganz genau, wie lange ein geschickter Mann braucht, um sein Gewehr nachzuladen und es abzufeuern. Vielleicht zwei Sekunden, mehr nicht. Und diese winzige Zeitspanne muss er ausnutzen. Auf dem Bauch liegend, nimmt Roy Tiffin seinen Revolver in beide Hände. Er kann so die Waffe ruhig halten, zieht den Hammer zurück, zielt.
Ehe Quinton noch einmal feuern kann, hat Tiffin das Fenster genau vor dem Lauf und drückt ab. Er hat über die Waffe gehalten, schießt und hört in derselben Sekunde auch schon den Schrei. Der Lauf der Winchester zuckt nach oben. Quinton muss getroffen worden sein.
Tiffin kommt wieder auf die Beine. Er läuft nun genau auf die Tür zu, hört es im Haus poltern und den schrillen Ruf Quintons: »Chessy, pass auf. Er kommt, er will zur Tür herein.«
Gleich zwei Mann im Haus, denkt Tiffin. Quinton muss getroffen sein, aber es kann keine großen Folgen haben. Warte, Freundchen.
Er erreicht die Hintertür, wirft sich an die Wand und zieht die Tür von der Seite her auf.
In derselben Sekunde kracht es im Haus ohrenbetäubend. Die Kugel, die irgendwo im Flur abgefeuert wird, schmettert in das dicke Holz der Tür. Ein gewaltiger Druck schleudert die Tür ganz auf.
Blitzschnell sieht Roy Tiffin in den Flur. Er kann einen Mann erkennen. Er hat irgendetwas in der Hand. Der Arm kommt hoch, Tiffin feuert.
Er sieht die schwankende Gestalt, hört den gellenden Aufschrei. Der Mann torkelt auf die Tür zu. Dann knickt er ein, stürzt hin und verliert seinen Revolver auf der Schwelle.
Dann polternde und schnelle Schritte auf der Treppe, deren Geländer rechter Hand hinten im Flur zu erkennen ist. Jemand rennt hastig die Treppe hoch. Das kann nur Quinton sein, der nach oben flüchtet.
»Quinton, gib auf!«, ruft Tiffin grimmig, als er in den Flur stürmt und einen kurzen Blick auf den reglos am Eingang zum Nebenraum liegenden Mann wirft. »Gib’s auf, Quinton. Sei kein Narr, ich will nur ihre Namen!«
Tiffin kann Quinton nicht sehen, der irgendwo oben lauern muss. Nichts schurrt oder kratzt, kein Laut.
Mit einem Sprung ist Tiffin unter der Treppe, nimmt mit der linken Hand seinen Hut ab und hält ihn dann neben die Treppe.
Kaum ist der Hut von oben zu sehen, als es so laut aufbrüllt, als schösse jemand eine Kanone im Flur ab. Quinton hat immer noch sein Gewehr. Die Kugel durchschlägt den Hut und lässt ihn aus Roys Hand segeln.
Doch sofort hebt Tiffin die rechte Hand, taucht unter der Treppe hervor und feuert nach oben. Er kann nur einen Fleck in diesem finsteren Treppenhaus erkennen. Über ihm ist ein heller, kreisrunder und lohend roter Feuerball. Quintons Gewehr geht los.
Die Kugel klatscht in eine Eichenstufe der Treppe. Quinton verliert sein Gewehr. Es hört sich an, als fiele etwas zu Boden, aber das Geräusch geht im wilden Gepolter unter, welches das herunterkollernde Gewehr verursacht.
»Quinton, steckst du jetzt auf, oder soll es ganz rau werden?«, ruft Tiffin heiser und rennt los. »Quinton, ich will nur ihre Namen haben.«
Oben stöhnt jemand. Es schabt, als schöbe sich ein Körper an einer Wand entlang. Zwei, drei tapsige Schritte, als Tiffin die Treppe nach oben stürmt. Als er die Biegung erreicht und um den Absatz der Treppe rennt, sieht er Quinton. Er ist an der Wand herabgesunken und sieht aus weit aufgerissenen Augen Tiffin entgegen.
Will Quinton hat den Mund offen, stöhnt heiser, presst die Hände auf seinen Leib und sieht Tiffin seltsam starr an.
Tiffin kommt näher und sieht, dass der Mann sterben wird. Er beißt fest die Zähne zusammen.
Quinton verdreht die Augen, rutscht seitlich weg und bleibt liegen. Tiffin kniet sich neben ihn, hebt seinen Kopf an und sagt heiser: »Quinton, das hätte nicht zu sein brauchen. Warum, zum Teufel, deckst du sie und schießt auf mich? Wo finde ich sie, Quinton? Rede, solange du noch Zeit dazu hast. Wo stecken sie?«
Quintons Lider flattern, er sieht Tiffin an. Dann bewegt er die Lippen, aber seine Worte sind so leise, dass Tiffin sie kaum verstehen kann.
»Quinton, wo finde ich sie? Rede, Mann, los.«
Quintons gestammelte Worte sind fast unverständlich und stockend. »Ca – bin – Kote – Doc – Doc – aaah!« Er sinkt zusammen, sein Kopf fällt schlaff zur Seite, seine hagere Gestalt streckt sich … Will Quinton ist tot.
»Du großer Gott«, keucht Tiffin und richtet sich hastig auf, als irgendetwas unten schabt.
Er saust die Treppe hinunter, sieht Chess kriechen, in einer Hand den Revolver halten, und sagt scharf: »Lass fallen, sonst drücke ich ab!«
Der Mann gehorcht, die Waffe poltert zu Boden. Dann versucht der Mann den Kopf zu wenden und sagt stockend: »Nicht schießen. Ich gebe es auf.«
Tiffin hat ihn nie gesehen. Er zieht ihn weiter in den Raum und hört draußen ein paar Leute rufen.
»Wer sind die fünf Männer, die Cord hergebracht haben?«, fragt Tiffin scharf. »Los, antworte, Mann! Wer sind sie?«
»Ich weiß nicht, Mister. Hier waren nur zwei.«
»Ihre Namen?«
»Joe, der eine, der Große, der andere heißt Lispy.«
»Lispy? Stottert der vielleicht?«
»Ja, Mister. Von den anderen weiß ich nichts, sie waren nie hier, nur die beiden.«
»Und sie haben Quinton gestohlene Pferde verkauft. Stimmt es?«
»Ja«, erwidert der Mann bestätigend. »Nicht meine Sache, Quinton ist der Boss, ich habe nichts damit zu tun.«
»Und wo sie stecken, weißt du das?«, setzt Tiffin nach.
»Nein, Quinton hat nie gesagt, woher sie kamen. Ich habe ihn mal gefragt. Er sagte, ich sollte mich um meine Arbeit kümmern. Meine Schulter – meine Schulter.«
Jemand ruft im Flur, Stiefel trampeln. Dann tauchen drei, vier Männer auf, bleiben stehen, als sie Tiffin mit dem Revolver in der Hand sehen – weichen zurück.
»Was ist hier los?«, fragt einer heiser. »He, Mister, wo ist Quinton?«
»Er liegt oben und ist tot«, erwidert Tiffin bitter. »Er hat auf mich geschossen, als ich ihn etwas fragen wollte. Wisst ihr über seine Geschäfte Bescheid?«
»Vielleicht«, sagt ein anderer Mann vorsichtig. »Aber hier kümmert sich keiner darum. Sie sind Deputy von drüben, was?«
»Ja. Mein Name ist Roy Tiffin. Wenn ihr Nachricht an den nächsten Sheriff schickt, dann sagt ihm gleich, ich käme entweder herüber oder er könnte mich in Missoula erreichen. Quinton hat gestohlene Pferde von drüben aufgekauft und wahrscheinlich auch welche aus eurer Gegend, um sie umzubrennen. Kennt jemand von euch die beiden Männer, die ihm öfter Pferde brachten? Der eine heißt Joe, der andere stottert, sie nennen ihn Lispy. Nun, was ist?«
»Nur vom Sehen«, erwidert einer der Männer. »Sie haben ab und zu im Saloon dort hinten einen Drink genommen, aber immer wenig geredet. Hier kümmert man sich wenig um solche Dinge, Deputy.«
»Es gibt eine Belohnung. Weiß wirklich keiner, woher die Burschen gekommen sind?«
»Von drüben«, erklärt einer etwas gesprächiger. »Aber woher sie sind, weiß kein Mensch. Hier jedenfalls nicht, Deputy. Wie hoch ist die Belohnung?«
»Achthundert Dollar.«
Einer der Männer pfeift durch die Zähne, zuckt bedauernd die Achseln und sagt mürrisch: »Ein ganz schönes Stück Geld, aber wir wissen nichts. Sie ritten immer ganz gute Pferde. Ich glaube, die hatten ein Brandzeichen, in dem ein Stern war. Ja, ich meine, es müsste ein Stern gewesen sein.«
»Ein Stern? Welche Form, wie viele Zacken?«
»Hm, wie viele Zacken? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.«
Tiffin wendet sich an den Verwundeten, fragt, aber der weiß auch nicht mehr, nur, dass der Stern vielleicht fünfzackig gewesen sein könnte.
»Also gut«, sagt Tiffin ernst. »Benachrichtigt den Sheriff oder einen der Rotröcke, wenn ihr welche in der Nähe habt. Ich bin jederzeit bereit, sofort herüberzukommen. Wenn ich nicht zurückgeschossen hätte, würde Quinton mich erschossen haben. Es war Notwehr!«
Er überlässt den Verwundeten den Männern, hastet hinaus und sieht Kenneth Cord torkelnd aus dem Blockhaus kommen.
»Wo ist Quinton, was ist mit ihm?«, fragt Ken Cord stöhnend.
Tiffin sieht ihn düster an, lädt seinen Revolver nach und sagt grimmig: »Er ist tot, Junge. Ohne dein Geschrei würde er noch leben, glaube ich. Ich wollte ihn nicht umbringen, aber es war zu dunkel im Treppenhaus.«
Ken wird leichenblass, lehnt sich an die Wand des Blockhauses und fasst sich an den Hals, als bekäme er keine Luft mehr.
Er sagt ächzend: »Tiffin, das habe ich wirklich nicht gewollt. Alles, was ich anfange, mache ich falsch. Ich habe ihn umgebracht, ich hätte nicht schreien dürfen. Mein Gott, ich habe ihn umgebracht.«
»Nicht so, wie du denkst«, erwidert Roy Tiffin. »Ein ehrlicher Mann hätte niemals zu schießen brauchen. Siehst du das ein? Irgendwann, Junge, ist es für jeden dieser Sorte zu Ende. Also, nimm das nicht zu tragisch und sage mir lieber, ob du den Ort kennst, wo sie stecken.«
Als Ken nicht antwortet, sondern nur wegsieht, schüttelt Tiffin grimmig den Kopf.
»Gut, gut«, antwortet er heiser. »Vielleicht würde ich an deiner Stelle auch so still sein, aber ich muss dir etwas sagen, Junge: Pferde kann ein Pferdedieb nur bei einem unehrlichen Händler verkaufen, der sich nichts daraus macht, ob es gestohlene Gäule sind. Du kannst sicher sein, dass ich eine Reihe von Burschen kenne, die mit solchen Händlern ab und zu Geschäfte machen. Ich habe sie gefragt, und sie nannten mir elf Händler im Umkreis von hundertfünfzig Meilen. Danach bin ich sie abgeritten, habe die im Norden zuerst besucht. Auf diesem Weg kam ich hierher. Mein nächster Weg, damit du es weißt, wird zurück über die Grenze führen. Was hältst du von einem fünfzackigen Stern-Brandzeichen?«
Ken Cord zuckt heftig zusammen, dreht ruckhaft den Kopf herum und beißt sich in die Unterlippe.
»Verdammt«, sagt er dann heiser, »das wissen Sie also schon? Nun, Tiffin, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich sage, dass ich den Platz nicht kenne, an dem sie stecken, genügt Ihnen das?«
»Junge, ich sagte schon, ich würde an deiner Stelle unter Umständen auch die Leute decken, die mich vor dem Galgen gerettet haben. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie habe. Begreifst du? Der eine heißt also Joe, und der andere, der stottert, wird Lispy genannt. Ist es so?«
Ken verfärbt sich, dreht sich um und schweigt.
»Also gut, sie heißen so«, stellt Tiffin fest. »Und einer ist verwundet, wie? Schwer, Ken?«
»Lassen Sie mich da heraus, Tiffin«, antwortet Ken bitter. »Sie wissen verdammt viel, mein Freund. Diese Leute sind nicht wie Quinton, sie werden mit dir fertig. Ich werde sie nie verraten, aber eins, Tiffin, solltest du dir merken: Der Mann, den sie Lispy nennen, ist kein Bandit, er ist ihr Zureiter und konnte nie einen Menschen umbringen. Er ist der beste Reiter, den ich jemals gesehen habe. Und das will einiges heißen. Lispy ist ein armer Bursche, ich habe mit ihm gesprochen. Er hat nie Glück im Leben gehabt.«
»So?«, fragt Tiffin eisig. »Er wird jetzt noch weniger haben, mein Freund. Ich wette, in vier Tagen habe ich sie. Weißt du, wer auf Crane geschossen hat?«
»Ja, aber ich sage es nicht. Der Kerl taugt wirklich nicht viel. Es ist gemein, einen Menschen zu verhöhnen, der für seinen Sprachfehler nichts kann. Indianer haben seine Eltern umgebracht. Dabei bekam er einen solchen Schock, dass er die Sprache verlor und sie erst nach und nach wiederfand. Er ist ein armer Mensch, Tiffin, aber das wird Sie wenig kümmern, was?«
Tiffin sieht an ihm vorbei und furcht die Brauen. »Vielleicht ist er das, aber er ist auch ein Pferdedieb«, entgegnet er kühl. »Ich wollte dir etwas sagen, als ich herkam, oder wann immer ich dich treffen würde, Ken: Ich suche immer gute Leute. Wenn du Lust hast, kannst du auf meiner Ranch arbeiten.«
»Nein«, erwidert Cord verbissen. »Nein, Tiffin, ich …«
»Junge, ich habe dir immer deine Geschichte geglaubt. Du kannst mich doch nicht dafür bezahlen lassen, dass alles so gekommen ist, oder?«
Cord presst die Lippen fest zusammen und wendet sich um.
»Überlege es dir, Cord. Ich ziehe mein Angebot nie zurück, ein Platz bleibt für dich offen. Und lass es dir nicht einfallen, diese Burschen zu warnen.«
»Wie denn? Ich weiß nicht, wo sie stecken«, antwortet Ken Cord missmutig. »Tiffin, Sie sind ein eisenharter Mann, aber in Ordnung, das weiß ich. Ich entschuldige mich für einige Dinge.«
»Das brauchst du nicht, Junge«, sagt Tiffin.
Er dreht sich um und geht zu seinen Pferden. Er denkt an den Stern-Brand. Es wird nicht schwierig sein, jemanden zu finden, der weiß, zu welcher Ranch dieses Brandzeichen gehört.
In vier Tagen habe ich euch, denkt Tiffin grimmig. Ihr stehlt nun seit einem Jahr Pferde in dieser Gegend. Wenn ich nur wüsste, was Quintons letzte Worte bedeuten sollen?
Er grübelt über sie nach, als er im Sattel sitzt und anreitet. Vielleicht aber sollte er weniger grübeln und sich lieber umsehen.
Roy Tiffin ist noch keine Meile geritten, als ihn der Reiter entdeckt und sein Pferd mit hartem Zügeldruck hinter einige Büsche lenkt. Wenig später jagt Tiffin an ihm vorbei, ohne ihn zu sehen.
Der Mann, der sein Pferd herumzieht, kneift die Lider zusammen. Dann wendet er den Kopf in die Richtung, aus der Tiffin gekommen ist.
»Alle Teufel«, sagt Joe James verstört, als er in die Tasche greift und die Zeitung fühlt. »Ich wette, er hat dieselbe Idee gehabt. Aber wie hat er ihn gefunden? Und was ist dort hinten passiert? Roy Tiffin reitet niemals umsonst. Wie viel weiß er?«
Er wartet, bis Tiffin nicht mehr zu sehen ist. Dann treibt er sein Pferd an. Er sieht Tiffins Fährte vor sich und kommt auf demselben Weg an die Pferdehandlung heran.
James’ hageres Gesicht wird noch faltiger, als er die Männer im Hof entdeckt und Kenneth Cord bei ihnen sieht. Andere Männer kommen aus der Tür, tragen jemanden zwischen sich und gehen auf den Schuppen zu.
Das ist Quinton, denkt Joe James entsetzt. Das ist das Ende. Dieser Spürhund hat alles entdeckt.
Er lässt sein Pferd zurück und huscht ins Blockhaus. Wenig später kommt Cord mit müden Schritten heran. Im selben Moment, als Ken die Tür öffnet, streckt James die sehnige Hand aus und packt ihn am Arm. Cord starrt ihn an wie einen Geist und bringt zuerst keinen Ton heraus.
»James«, sagt er und wird leichenblass. »James, es ist aus, ihr müsst verschwinden. Er weiß fast alles von euch.«
Aus …!, denkt James. Er hat es die ganze Zeit befürchtet.
*
Sie haben nur noch jene, die sie zur Flucht brauchen. Alle anderen, es sind über dreißig gewesen, haben sie nach Trout Creek getrieben und dort verkauft. 26 Stunden schon ohne Schlaf. Hart für vier Männer, aber grausam hart für den, der immer die Befehle gegeben hat und sie immer noch gibt: Bruce Murdock.
Es hat keinen Doc für Bruce gegeben, keine Behandlung, wie sie seine Hüftwunde erfordert hätte. Als sie sich damals nach dem Überfall auf die Kutsche trennen mussten und McDewey mit Dorrey Bruce, zwischen zwei Pferden liegend, auf die Ranch brachten, bekam Bruce Fieber, wälzte sich volle zwei Wochen in seinem Bett. Vielleicht wäre ein anderer Mann gestorben, vielleicht hätten sie einen Doc holen müssen, aber er wollte es nicht. So lange er sprechen konnte, beschwor er sie, keinen Doc zu holen. Und er wusste warum, denn vier Tage darauf stand es im »Herald«.
Einer muss schwer verletzt sein, eine Menge Blut wurde unter den Büschen gefunden. Er wird schnellstens ärztliche Hilfe brauchen und einen Doc holen müssen.
Als sie es lasen, haben sie sich angesehen und nichts mehr gesagt. Dann kam das Warten. Zwei Wochen Fieber und jeden Tag die Furcht, er könnte sterben.
Eines Tages aber war sein Blick wieder klar, wenn er auch mager und hohlwangig in seinem Bett lag und das Loch nicht heilen wollte. Es stammte von einem Querschläger, der an einem Ast abgeprallt war.
Aus, denkt James und sieht sich nach ihm um, blickt zu Lispy, der das Pferd von Murdock neben sich hat. Es ist aus. Wir müssen eine Trage bauen, ihn wieder so transportieren, wie sie ihn damals zur Ranch gebracht haben. Er hält es nicht durch, sein Körper ist zu geschwächt. Damals brauchten sie sieben Tage, um ihn auf die Ranch zu bringen. Wir kommen zu langsam voran, viel zu langsam. Sechzig Meilen bis zur Grenze, das hält er niemals durch.
Er schluckt schwer. Irgendwie hat er Bruce immer gemocht, aber mit ansehen zu müssen, wie jemand stirbt, wenn er weiter darauf besteht, nicht im Liegen und in einer Trage transportiert zu werden, das ist scheußlich.
James blickt zum Himmel, auf die dahinziehenden Wolken, auf den Mond, der dazwischen manchmal auftaucht.
Geld …, denkt er bitter. Der Schurke, dieser elende Dean. Ich hätte ihm eine Tracht Prügel verabreichen können, diesem Gauner. Da war Quinton doch ein anderer Mann, auch wenn er immer versuchte, die Preise zu drücken. Anständig ist er immer geblieben. Wenn er noch gelebt hätte, dann hätten wir gleich nach Norden treiben und die Pferde über die Grenze bringen können. So war nur noch Dean da, dieser ausgemachte Schurke, der uns mit all unseren Pferden kommen sah. Dieser ausgekochte Pferdehändler … Der Einzige, den wir gut genug kannten. Gerochen hat er es. Für jeden Gaul aber nur zwanzig Dollar. Ich hätte ihm eine Lektion erteilen sollen.
Aber sie haben nichts tun können.
So viele Pferde, eure Pferde, hat er gefragt, der schmierige Dean. Was denn, ich soll sie alle nehmen, dreißig auf einen Schlag? Und sofort, heute? Ihr seid verrückt, so viel Geld habe ich nicht im Haus, ich habe ganze fünfhundertsechzig Dollar hier.
Neunhundert müssen wir wenigstens haben, Dean. Neunhundert, verstehst du? Mach schon, rück das Geld heraus, so gute Pferde bekommst du nie wieder.
Gott der Gerechte, hat Dean gejammert. Was ist denn passiert, dass ihr auf einmal die Pferde verkaufen müsst, he? Da stimmt doch was nicht. Vielleicht werde ich sie los, he? Man nimmt sie mir weg, wie? Nein, nein, ich habe keine neunhundert Dollar im Haus, nur fünfhundertsechzig.
Er hat gehandelt, gefeilscht. Und gemerkt, dass ihnen die Zeit unter den Nägeln brannte, der Halunke. Am Ende sind sie sich einig gewesen – sechshundert Dollar! Er wollte mal nachsehen, vielleicht hätte seine Frau noch irgendwo ein paar Dollar, das könnte zutreffen. Hat er gesagt und sie seltsam angesehen, der Gauner. Natürlich hat er die Packen bemerkt, die jeder auf seinem Pferd gehabt hat und sich ausgerechnet, dass sie das Land verlassen wollten. Auch das muss ihm klar gewesen sein.
James blickt wieder zurück. Lispy kommt nicht schnell genug mit Bruce voran. Hinten reiten Dorrey und McDewey nebeneinander durch das Wasser. Keine Spur hinterlassen, wie? Wenn Tiffin ein Aufgebot mitbringt, dann sollen sie suchen müssen. Er wird nur eine verlassene Ranch finden.
»Verflucht«, sagt hinten Dorrey bissig. »Er liegt jetzt schon wieder auf dem Hals des Pferdes. Siehst du das? So schaffen wir es nicht vor übermorgen, wir kommen nie über die Grenze, wenn es so weitergeht, Mann. Ich würde abhauen, aber …«
»Ja«, zischt McDewey giftig. »James hat das Geld. Er wird genau das tun, was Bruce gesagt hat: Zusammenbleiben. Nur zusammen sind wir stark. Der rückt nichts heraus, keinen Dollar von unserem Anteil, der Bursche. Wenn ich könnte, wie ich wollte, ich wüsste, was ich täte, ich ja.«
James fällt zurück, reitet links neben Murdocks Pferd und sieht auf Bruce hinab.
»Bruce, wir müssen eine Trage machen, hörst du?«
»Noch nicht. Weiter, keine Trage. Erst oben in den Bergen. Hier gibt es keinen Aufenthalt, Joe. Noch vier Meilen, dann sind wir auf den Felsen. Verstanden?«
»Kannst du denn noch?«
Bruce Murdock richtet sich auf, sieht sich um und beißt die Zähne zusammen. Auf seinem Gesicht steht der Schweiß in dichten Tropfen.
»Was ist denn, warum so langsam, Lispy? Schneller, los, schneller!«
Es ist Wahnsinn, denkt Lispy. Er bildet sich ein, dass wir nicht merken, wie es um ihn steht, aber gut, schneller.
Ein Schlag mit den Zügelenden, die Pferde fallen in den Trab. Murdock sieht das Tal und die Wände sich biegen, heben und verzerren, aber er bleibt stocksteif im Sattel sitzen. 400 Yards reiten sie im Trab, verschwimmt alles vor Murdocks Augen. Verzweifelt kämpft er gegen seine Müdigkeit an, aber er schafft es nicht mehr. Ganz langsam rutscht er wieder nach vorn. Und die Pferde fallen in den stupiden Trott zurück.
»Bruce, der Narr«, sagt hinten Dorrey giftig. »Er will auf die Felsen. Ganz gut, aber das dauert ja drei Stunden, ehe wir dort sind. Wir haben einen ganzen Tag lang unsere Pferde getrieben. Sechsundzwanzig Stunden ohne Schlaf, bei James sind es sogar vierzig Stunden, aber der ist gesund, zäh wie Sohlenleder. He, Sid, was wolltest du vorhin sagen? Was tätest du, wenn du könntest?«
McDewey starrt ihn an, blickt dann wieder nach vorn und schweigt zu lange für Dorrey, der von Geburt an neugierig ist.
»Na, sag schon.«
»Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann«, antwortet McDewey leise. »Zu wem würdest du halten, zu diesen beiden Narren da vorn, die alles tun, was ein Todkranker ihnen sagt, oder zu mir, he? Ich denke, du bist nicht dumm, was, Dorrey? Rechnen kannst du vielleicht auch. Dann rechne dir doch einmal aus, was passiert, wenn der verdammte Tiffin nach Whitefish geritten ist und sich dort nach dem Brandzeichen erkundigt hat.«
»Mensch, male den Teufel nicht an die Wand. Dann könnte er jetzt schon auf der Ranch sein, was? Mann, mach mich nicht verrückt.«
»Will ich gar nicht«, zischt ihm McDewey zu. »Aber es könnte doch sein, was? Nimm mal an, er ist gerissen genug, und als Pferdejäger gibt es keinen besseren als ihn, festzustellen, dass wir mit den Pferden zu Dean sind. Nimm mal an, er stößt auf den Platz, an dem wir Lispy und Bruce zurückgelassen hatten. Was wird er sich sagen, he?«
Phil Dorrey stiert ihn wie gebannt an und leckt sich nervös über seine Lippen. Anscheinend kommen ihm erst in diesem Augenblick die Gedanken, die McDewey die ganze Zeit schon mit sich herumgetragen hat.
»Du, Sid, du meinst doch nicht, der könnte in der Nähe sein? Wenn er ein Aufgebot bei sich hat …«
»… dann ist es bald aus. Die kommen uns von Minute zu Minute näher, Mann. Plötzlich knallt es, du kippst aus dem Sattel und sagst nie mehr was. Und was dann? Vielleicht entkommt ausgerechnet James mit dem Geld, was?«
Dorrey sagt keuchend: »Mensch, wenn das so kommen kann, will ich mein Geld haben. Ich reite allein weiter. Den Weg kenne ich so gut wie James oder jeder von uns. Zum Teufel, wenn es so weit kommt, dann nichts wie weg.«
»Sag das mal zu James!«, erwidert McDewey der Zeit seines Lebens ein Intrigant gewesen ist. »Na los, reite hin, sage ihm, du willst sein Geld haben und allein reiten. Sag es ihm, versuche es doch mal.«
»Verdammt, er rückt es nicht heraus. Er weiß genau, dass ich dann nicht mehr bleiben würde«, knurrt Dorrey bissig. »Er wird mir eher seinen Revolver vor die Nase halten.«
McDewey lacht leise und höhnisch, als er Dorrey ansieht.
»Wie schön du das gesagt hast«, antwortet er hämisch. »Genau das wird er tun. Aber wer sagt denn eigentlich, dass es nicht umgekehrt kommen kann, he? Ich bin nicht so sehr für Partnertreue und Zusammenhalten in jeder Gefahr. Solange man nichts zu befürchten hat, na schön. Aber jetzt, mit einem Todkranken? Bruce wird vielleicht bald sterben. Und weil er vielleicht sterben muss, können wir alle an den Galgen kommen. Hast du Lust, einen kratzenden Strick an deinem Hals zu fühlen? Ich nicht, sage ich dir.«
Dorrey, der immer schwer von Begriff gewesen ist, der Zeit braucht, um etwas zu verdauen, ballt die Fäuste. Dann aber: »Alles oder nichts!«, fragt er gepresst: »Hör mal, wie hast du das gemeint, das mit dem umgekehrt kommen?«
»Wie ich es gesagt habe«, erwidert McDewey zischend. »Was will er machen, wenn wir ihn mit dem Revolver kitzeln, he? Lispy zählt nicht, Bruce merkt gar nichts mehr, der ist zu schwach. Bleibt nur James übrig, was? Bei der ersten besten Gelegenheit nehmen wir unseren Anteil und reiten los. Sollen sie doch sehen, wie sie mit Bruce zurechtkommen. Ich meine nur so, das ist nur eine Idee. Allein gegen James haben wir keine Chance, der ist zu schnell für einen von uns. Kapiert?«
Für mehr als eine Minute schweigt Dorrey. McDewey schielt von der Seite zu ihm hin und weiß, dass er eine Idee in Dorreys Kopf gepflanzt hat, die Wurzeln schlagen wird. Dafür kennt er Dorrey lange genug.
»He, Sid«, fragt Dorrey nach einer Weile. »Meinst du wirklich, wir können es schaffen?«
»Was denn sonst«, erwidert McDewey. »James wird halten und eine Trage bauen. Wenn einer hinter ihn tritt, ohne dass es ihm auffällt, haben wir eine Chance. Ich mache das schon, Mann.«
»Und wenn er schießt?«
»Du kleiner Witzbold«, sagt McDewey grinsend. »Lass mich machen. Ich trete hinter ihn und werde ihn austricksen. Und dann nehmen wir uns das Geld.«
»Unseren Anteil, was?«
»Weshalb denn nur unseren Anteil, Dorrey?«
Der stiert ihn einen Moment fassungslos an, dann aber beginnt er zu grinsen.
»Du meinst?«
»Ja, ich meine«, zischt McDewey.
*
Sie halten an. Dorrey schleppt zwei dicke Stangen herbei und legt sie ab. James kniet am Boden, hat mit seinem Messer Löcher in die Decke gestochen und zieht nun ein Seil dadurch.
»Halt fest, Dorrey«, sagt James brummig. »Das muss fest angezogen werden, sonst reißt die Decke noch aus, und er fällt zwischen den Pferden zu Boden. Halt den Stock hoch.«
»Ja, ist ja schon passiert.«
Sie knien nun beide. Dorrey James gegenüber. Er hält Decke und Stock hoch. Zwischen ihnen ist etwa ein Meter Distanz, mehr nicht.
Der Wind weht kühl über die Bergflanke. Von den dichten Büschen hat Dorrey mit McDeweys Hilfe zwei lange Stangen geschlagen.
Lispy aber ist dabei, dem völlig erschöpften Bruce Murdock etwas Wasser zwischen die Lippen zu träufeln. Sie haben ihn auf zwei Decken an einen Felsblock gelegt und ihn mit einer dritten zugedeckt, da er dauernd vor Kälte gezittert hat.
»Lispy?«, fragt er matt und blinzelt. »Danke, Lispy. Sind wir auf den Felsen?«
»Ja, Boss. Gleich ist deine Trage fertig, dann geht es schneller voran.«
»Schneller, ja, schneller. Noch was trinken, Lispy.«
Lispy hebt seinen Kopf vorsichtig an und setzt ihm die Flasche wieder an die Lippen.
Drüben, an der Kante dieses Felsplateaus, über dem Fluss, zieht Joe James das Seil durch die Deckenlöcher.
»Na?«, fragt McDewey und kommt von hinten, während Dorrey den Kopf senkt, auf James zu. »Geht es voran? Soll ich helfen, Joe?«
Er fragt es ganz ruhig, steht schräg hinter James und sieht auf ihn hinab.
Es ist reiner Zufall, dass sich Lispy in diesem Augenblick kurz umsieht. Lispy hört James’ Antwort: »Nicht nötig, ich bin gleich fertig.«
Und dann sieht er, wie McDeweys rechte Hand plötzlich den Revolver zieht.
»James, pass auf!«
Sein heller, scharfer, entsetzter Schrei dringt über das Plateau zu James.
Doch es ist zu spät für James.
Dorrey, der nicht hochzusehen gewagt hat, blickt nun erschrocken an James vorbei auf Lispy.
James aber zuckt zusammen, will sich noch drehen, kommt halb herum und sieht aus den Augenwinkeln gerade noch den Revolverlauf auf sich zukommen.
In der nächsten Sekunde trifft ihn die Waffe seitlich am Kopf. Er sieht Funken und Sterne, ist angeschlagen, aber noch nicht bewusstlos. Vor ihm wirft sich Dorrey mit einem Schrei auf die Hand, die James noch in die Nähe seines Revolvers bringt.
Es ist eine unerbittliche, hinterlistige und gemeine Sache. Während Dorrey James’ Hand festhält, schlägt McDewey noch einmal zu.
Diesmal erwischt der Hieb James voll. Mit einem erstickten Laut sinkt er nach vorn und bleibt auf der Decke liegen.
McDewey aber wirbelt mit dem Revolver herum, richtet den Lauf der Waffe auf Lispy, der erstarrt neben Murdock kauert, und spannt den Hammer.
»Nimm dem Narren den Revolver ab, Phil!«, sagt er zu Dorrey und sieht Lispy an. »Na, du Stotterkaiser, jetzt sperrst du die Augen auf wie ein blödes Kalb. Sitz still, sonst drücke ich ab! Vergiss nicht, ich habe noch eine Rechnung mit dir zu begleichen. Soll ich mal?«
Ich kann nicht sprechen …!, denkt Lispy und bewegt die Lippen, ohne auch nur einen Ton herauszubekommen. Meine Stimme …, ich kann nicht mehr reden …! Es ist wie damals – nur, dass es diesmal keine Indianer sind, sondern seine Partner.
»Hast du keine Worte?«, erkundigt sich McDewey höhnisch, während Dorrey James’ Revolver wegschleudert und sofort zu dessen Pferd rennt. »Da glotzt du aber prächtig, Kleiner, was? Nimm die rechte Hand herunter und zieh langsam deinen Revolver. Und dann wirf ihn her. Los, mach schon!«
Der schießt, denkt Lispy, der schießt wirklich. Er und Dorrey, sie machen uns alle fertig. Dorrey hat die Satteltasche, sie wollen mit dem Geld türmen.
»Wird’s bald?«
Er will etwas sagen, aber er kann nur schlucken. Ganz langsam senkt er die rechte Hand, erfasst den Revolverkolben und zieht vorsichtig die Waffe.
»Wirf sie her, schnell!«
Er gehorcht. Sein Revolver klappert auf den Felsen und rutscht bis dicht vor McDewey.
»Ich hab’s, Sid«, meldet sich Dorrey. »Was nun?«
»Schmeiß ihre Waffen über die Felskante, beeile dich.«
Er tritt vor den Revolver von Lispy. Die Waffe verschwindet in der Tiefe. Ihr folgen die beiden Gewehre von Lispy und James. Dorrey – die Tasche hat er liegen lassen – blickt kurz nach unten und kichert hämisch, als der Aufprall der Waffen hochschallt.
»Na also«, sagt er zufrieden, »jetzt haben wir ja alles! Dann bleibt nur bei diesem Halbtoten und lasst euch erwischen. Ihr verdammten Narren, dachtet ihr, wir würden hier in einem Leichenzug mitreiten? So verrückt könnt ihr auch nur sein. Wollen wir, Sid?«
»Sicher – sicher, gleich«, erwidert McDewey und senkt den Revolver, bis er auf Lispys Leib deutet. »Jetzt kommt nur noch mein Freund Lispy an die Reihe. Lispy, ich bin dir doch immer noch was schuldig, äh? Pass mal auf, was ich mache. Steh mal auf, du Schläger.«
»He, Sid, lass das doch, wir müssen weg.«
»Dafür würde ich sogar eine Minute in der Hölle zubringen«, antwortet McDewey giftig. »Los, komm, aber ganz langsam! Komm, Lispy, du Stotterkaiser, jetzt sollst du was erleben, wovon du noch in hundert Jahren träumst.«
Lispy ist aufgestanden, geht langsam drei Schritte vor und begreift es selbst kaum, als er sich plötzlich sagen hört: »Du verkommener, schmutziger Schurke! Ihr verdammten, dreckigen Banditen! Irgendwann werdet ihr es bezahlen! Ihr werdet es büßen müssen, denn seine eigenen Partner zu bestehlen und niederzuschlagen …«
Und dann stockt er – Lispy hat ohne jedes Stottern gesprochen.
Als der es selbst bemerkt, bekommt er einen derartigen Schreck, dass er schweigt. Er bleibt sogar stehen. Und er hört hinter sich McDewey heiser sagen: »Was ist denn das, he? Hast du das gehört, Phil? Der stottert ja nicht mehr. Mensch, Lispy, warum stotterst du denn nicht mehr? Mach mal den Mund auf, rede, los, schnell!«
»Gibst du schon wieder Befehle?«, fragt Lispy grimmig. »Du kleiner, erbärmlicher Schmutzfink, der das Anspucken nicht mal wert ist! Ja, ich stottere nicht mehr, ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Ich kann so reden wie jeder andere, ich kann wirklich reden, du verdammter Gauner!«
»Ich werde verrückt«, ruft Dorrey. »Wie ist denn das passiert? Er redet wie ein normaler Mensch.«
Und dann sagt er gar nichts mehr.
Sie haben einen Fehler gemacht: Niemand hat auf den Halbtoten geachtet. Für sie hat Bruce Murdock nicht mehr gezählt. Und doch ist er noch lebendig genug.
Ohne dass es einer bemerkt, der Mann liegt im Schatten des Felsens, zieht Murdock seinen Revolver. Er ist plötzlich nicht mehr müde, zerschlagen, fertig.
Bruce Murdock sieht James am Boden reglos liegen, blickt an Lispy vorbei auf den lauernden McDewey und hebt blitzschnell die Hand.
Dorrey, der durch die jähe Bewegung aufmerksam wird, erkennt es zu spät.
Ehe er auch nur schreien kann, drückt Bruce Murdock, der Mann, der mit einem Bein im Grab steht, ab.
McDewey sieht den Feuerstrahl, dann wird er mit großer Wucht herumgewirbelt. Er hört noch, dass Murdock irgendetwas brüllt, aber er versteht es nicht.
»Hinwerfen, Lispy.«
Lispy, der genau wie Dorrey die Bewegungen Murdocks verfolgt hat, reagiert sofort. Er wirft sich nach vorn. An seiner Seite faucht die Kugel vorbei. McDewey stößt einen seltsamen Laut aus. Und während Dorrey sich bückt, einknickt und seine Waffe hochreißt, erwischt Lispy einen der herumliegenden, kantigen Steine.
Am Felsblock aber liegt Murdock und hat nicht mehr so viel Kraft, den Hammer seines Revolvers schnell genug zu spannen. Er strengt sich an, aber es geht zu langsam. In der Sekunde, als er ihn nach hinten gezogen hat und feuern will, schießt Dorrey schon. Murdock spürt einen Schlag, sieht lauter Feuer und drückt doch noch ab. Dann kommt eine schwarze riesenhafte Welle auf ihn zu und begräbt ihn unter sich.
Hinter Lispy, der den Stein genommen hat, schreit in diesem Augenblick Dorrey gellend auf. Dorrey, der Murdocks Kugel ins rechte Bein bekommt, torkelt keuchend rückwärts. Er sieht, wie Lispy den Arm hebt und ausholt. Der Stein fliegt los. Ohne zielen zu können, denn dazu schwankt er zu sehr, feuert Dorrey aufs Geratewohl nach Lispy, verfehlt ihn jedoch. Dafür trifft ihn der Stein an der Hüfte.
Dorrey will dem nächsten Wurf ausweichen, dreht sich halb und stürzt über die Kante.
Lispy, den nächsten Stein in der Faust, stemmt sich ganz langsam hoch. Er sieht McDewey am Boden liegen, blickt ihm mitten in das vom Mondlicht beschienene Gesicht, in die starren Augen und sagt stockheiser: »Boss, Phil ist über die Kante geflogen. Bruce, hast du gesehen? Phil ist abgestürzt.«
Er dreht sich, sieht die schlaffe Hand Murdocks, den Revolver auf der Decke, und rennt zu ihm. Als er ihm ins Gesicht blickt, bemerkt er, dass Murdock tot ist.
»Mein Gott«, stößt Lispy entsetzt hervor und kauert einen Augenblick neben ihm. »Sie haben sich gegenseitig umgebracht.«
Er stürzt zu James, rüttelt ihn. Der kommt zu sich, und Lispy erzählt ihm alles.
James, der sich den Kopf hält und völlig entgeistert auf dem Plateau umherblickt, stöhnt leise.
»Joe, was machen wir denn jetzt? Sie sind alle tot. Was soll ich tun, sag es mir.«
»Schaff sie beide nach unten. Warte, ich brauche ein paar Minuten, bis ich klar im Kopf bin. Mensch, was ist das für eine fürchterliche Geschichte. Dieser verdammte Kerl McDewey, ich wusste doch, dass er nicht viel taugte. Mein Kopf, ich habe eine Beule, sage ich dir. Lispy, du musst mir helfen. Wir machen ein Steingrab.«
»Ja ich gehe nach unten und suche Dorrey. Ob die Schüsse gehört worden sind?«
Joe starrt ihn an, nickt dann bitter und sagt heiser: »Möglich ist es. Wir verschwinden so schnell wir können. Nimm Bruce mit.«
Lispy geht los. Joe starrt ihm nach und sagt plötzlich, als Lispy Murdock schon auf dem Pferd hat: »Lispy, hast du eben richtig geredet?«
»Ja«, erwidert Lispy seltsam gepresst. »Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber als der verdammte McDewey dir den Revolver von hinten über den Kopf schlagen wollte, es sah aus wie damals, als die Indianer meinen Vater erschlugen, ich stottere plötzlich nicht mehr, Joe.«
Joe James sagt nichts. Er blickt ihm nur nach und hält sich den Kopf. Und trotz aller Schmerzen, die ihm fast den Kopf sprengen wollen, denkt er an Tiffin.
Was ist, wenn Tiffin die Schüsse gehört hat?
*
»Rede«, sagt Joe und weiß, dass er im Sattel einschlafen wird, sobald nur noch das monotone Klappern der Hufe zu hören ist. »Du musst was sagen, Junge, sonst schlafe ich ein. Rede irgendetwas, erzähl von deinen Eltern, wenn du willst, aber rede.«
Sie haben sechs Pferde bei sich und kommen sehr schnell voran, weil sie alle Stunde die Pferde wechseln können.
Das Tal liegt weit hinter ihnen, aber in dem Gewirr der Berge können ihre Verfolger nahe sein.
Lispy sieht sich immer wieder um.
Sie reiten an einem Bach entlang, der in einem eingeschnittenen Tal nach Nordwesten fließt. Lispy sagt heiser: »Ich weiß nicht viel von meinen Eltern. Ich war sieben Jahre alt, als sie starben. He, hörst du?«
»Ja«, murmelt James. »Was war dein Vater eigentlich, Lispy? He, ich sollte wohl nicht mehr Lispy sagen. Du heißt eigentlich John, was?«
»Ja, John Glouster, genau wie mein Vater, er war Frachtwagenfahrer. Es passierte, als mein Vater einen besseren Job in Denver bekommen sollte. Wir fuhren von Norden durch Montana nach Wyoming und immer weiter südwärts. Mit uns noch zwei Familien. Die Sioux waren damals wild. Sie kamen eines Abends. Man hatte uns gesagt, Indianer griffen nie in der Nacht an. Es war ein Irrtum. Hörst du mir zu, Joe?«
»Ja, ja, ich höre. Es war ein Irrtum. Es gibt viele Irrtümer, und manchmal bezahlt man für einen Irrtum das ganze Leben lang. Hm, ich habe auch bezahlt.«
»Du? Du hast doch nie im Jail gesessen, oder doch?«
»Ja, früher mal. Da lernte ich Murdock kennen. Das war in Nebraska. Er hatte einige Rinder gestohlen, ich auch. Damals fassten wir den Plan, es mit Pferden zu versuchen und von den ersten Geldern eine Ranch zu kaufen. Wir fanden dann zuerst Dorrey. Das andere weißt du ja. Es hat sich nicht gelohnt, mit gestohlenen Pferden etwas aufbauen zu wollen.«
»Das sage nicht«, antwortet Lispy-John Glouster. »Wenn wir nur ein bisschen mehr Glück gehabt hätten und McDewey nicht auf der Treppe angehalten, sondern nach oben gegangen wäre, dann hätte auch Crane nicht zu sterben brauchen.«
»McDewey schoss schon immer zu schnell«, sagt James bitter. »Genau wie ich. Ich habe auch mal zu schnell geschossen und musste dafür bezahlen.«
»Du? Du hast doch nie geschossen, nicht, solange ich bei euch gewesen bin. Und wenn, nicht auf den Mann, Joe.«
»Vorher«, antwortet Joe James. Er redet wohl nur darüber, weil seine Müdigkeit jenen eisernen Willen, der ihn sonst auszeichnete, gelähmt hat. »Lange vorher. Ich – ich habe …«
Er hockt zusammengekrümmt auf seinem Pferd.
»Wen hast du denn erschossen?
Bruce sagte mal, du hättest was getan, aber du redetest nie darüber. Ist es das?«
»Ja«, erwidert Joe James gepresst. »Deinen Vater haben andere umgebracht, aber ich, ich tat es selbst.«
»Was?«, fragt John-Lispy Glouster und sieht ihn entsetzt an. »Was hast du getan? Joe, du redest Unsinn.«
»Nein«, erwidert Joe. »Weißt du, ich konnte nie darüber reden. Ich habe ihn natürlich nicht umbringen wollen, bestimmt nicht, das musst du mir glauben. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Und ich glaube, meine Mutter lebt auch noch.«
»Ich dachte, du hättest niemanden mehr, Joe. Mein Gott, wie ist das gekommen?«
Joe sieht ihn an und streckt die Hand aus, fasst nach seinem Arm.
»Du, John, ich habe seit fünf Jahren nicht mehr darüber geredet. Du bist nach Bruce der erste Mann, dem ich es erzähle. Sag es keinem. Versprichst du das?«
»Ja«, sagt er, bestürzt über den seltsamen Ausdruck in Joe James Augen. »Denkst du, ich rede? Du brauchst es ja nicht zu sagen.«
»Ich will aber, ich muss es erzählen, weil du in Ordnung bist, Junge … Da war ein Mann, der war total verrückt nach meiner Schwester. Sie hat blondes Haar, ganz hell, weißt du? Ein schönes Mädchen. Sie ist neun Jahre jünger als ich und sechs als mein Bruder. Ich war der Älteste zu Hause. Na ja, eines Tages versuchte der Kerl, sie mit Gewalt zu küssen, aber ich …«
Joe steckt sich seine Pfeife an, holt tief Atem und redet dann weiter. »Bei uns zu Hause ist das eine Sache, die einen umbringen kann, verstehst du? Meine Schwester, die immer mehr mit meinem jüngeren Bruder zusammenhing, erzählte es Bill. Das ist mein Bruder. Sie dachten, ich wäre nicht in der Nähe gewesen, aber ich hörte es. Ich nahm mein Pferd und suchte den Kerl. Als ich ihn in der Stadt stellte, verprügelte ich ihn zuerst und warf ihn auf die Straße. Dann forderte ich ihn auf, zu ziehen. Feige war er nicht, er stellte sich zum Kampf. Als wir ziehen wollten, rannte plötzlich mein Vater dazwischen. Lucy, meine Schwester, hatte ihm alles gesagt, weil sie wusste, ich würde den Kerl umbringen.«
Joe starrt vor sich hin, atmet schwer und klopft dann seine kaum angerauchte Pfeife wieder aus.
»Schmeckt nicht, Junge. Nun, ich schrie meinem Vater zu, er solle aus dem Weg gehen, aber er kam auf mich zu. Er streckte die Hand aus, um mir den Revolver zu nehmen. Und da ist es geschehen.«
Joe James fasst sich an den Hals.
»Der Revolver ging los. Ich weiß heute noch nicht, wie das passieren konnte«, sagt er dann dumpf. »Vielleicht hielt ich ihn zu fest, oder er zog zu sehr. Ich hatte den Daumen auf dem Hammer. Der Schuss löste sich, mein Vater fiel zu Boden. Ich weiß nicht mehr, was ich danach gemacht habe, ich weiß nur, dass die Leute alle um uns herumstanden und mich ansahen. Da bin ich weggerannt. Ich glaubte sie rufen zu hören und wurde halb verrückt. Sie schrien mir Vatermörder nach. Das habe ich gehört, ganz deutlich. Und doch hat keiner was gesagt. Verstehst du das! Junge?«
»Ja«, antwortet John-Lispy stockheiser. »Und später, bist du nie wieder nach Hause gegangen? Hast du nie geschrieben?«
»Nein«, murmelt Joe James. »Ich habe mal hier und mal da gearbeitet. Ich heiße auch gar nicht James. Das ist nur mein zweiter Vorname, weißt du? Richtig heiße ich Langley, Joe James Langley. In New Mexico, warst du da schon mal, Junge?«
»Nein, nie.«
»Ist schön da«, sagt Joe leise. »Zwischen Roseville und Fort Summer am Pecos, da musst du mal im Frühjahr hinreiten. Wir haben eine große Ranch, ich meine, mein Bruder hat sie. Elftausend Rinder hatten wir damals. Und meine Mutter, das ist eine gute Frau, kannst es glauben, Junge. Vielleicht hat sie manchmal an mich gedacht, aber auch an Vater und daran, dass ich …«
Er stopft sich seine Pfeife, schon wieder ganz in Gedanken.
»Wenn du da mal hingehst, kann ja sein, was, dann hör mal, was sie von mir denken. Versprichst du mir das?«
»Aber wir können doch beide hingehen, Joe.«
»Nein, ich nicht, ich werde auch nicht mit dir zusammenbleiben, es ist besser für dich. Such dir eine anständige Arbeit. Bestimmt findest du eine in New Mexico. Und dann schreib nach Spokane, Oregon. Ich sehe mal ab und zu nach. Irgendwo da im Westen werde ich bleiben, wenn wir hier herauskommen.«
»Wir wollen uns trennen, Joe? Warum denn?«
»Weil ich nichts für dich bin«, erklärt Joe James Langley bitter. »Ich bin ein Vagabund geworden. Und du bist der beste Reiter, den ich kenne. Du stotterst nicht mehr, du wirst in jeder Mannschaft bald den besten Platz haben, und keiner wird dich mehr beschimpfen oder aufziehen, Junge. Du musst deinen Weg allein machen, verstanden? Ganz allein, begreifst du?«
»Und wenn ich nicht will, Joe?«
»Du musst«, entgegnet Joe scharf. »Wenn wir drüben sind, dann trennen wir uns. Du hast etwas Geld, Junge. Halte es zusammen. Du kommst allein besser zurecht.«
Sie erreichen die Biegung des Tales. Links ist der Bach, rechts eine steile Halde, überall Geröll und ein ganz schmales Ufer. Joe James Langley sieht den Mann genau hinter der Biegung, keine 100 Yards entfernt halten, das Gewehr im Anschlag.
John-Lispy Glouster zieht jäh sein Pferd herum, als er den Mann erkennt.
»Zurück!«, ruft er. »Tiffin ist da, Joe, weg hier.«
Lispy treibt seinen Gaul an und sieht noch, wie Joe sich auf den Hals des Tieres wirft und sein Pferd zur Seite reißt.
Dann prescht er los, gibt dem Gaul die Hacken und will um die Biegung zurück.
Joe sieht den Mann, die beiden Pferde, das Gewehr, und reißt seinen Karabiner aus dem Scabbard. Er wirft noch einen Blick nach hinten, da rast der Junge weg.
Er visiert, sieht, wie Tiffin mit einem unheimlich geschickten Trick die Pferde auseinanderbringt und genau zwischen ihnen zu Boden fällt, und dann schießt er.
Joe James Langley weiß es in der Sekunde, in der er abdrückt und der Schuss herausjagt: Er trifft ihn nicht.
Genauso kommt es. Tiffin fällt zu Boden, seine Pferde rennen seitlich weg.
Nicht den Jungen, denkt Joe James Langley. Den bekommst du nicht, Mann, der hat nicht viel getan.
Er sieht den Blitz, spürt den Schlag gegen die rechte Brustseite und stürzt zu Boden. Aber im Liegen bringt er noch seinen Karabiner herum, zielt und drückt ab.
Roy Tiffins linker Arm bekommt einen Schlag, das Gewehr einen Ruck. Die Kugel fegt in den Hang.
Die Schleier um Joe werden immer dichter. Dann ist nichts mehr. Joe James ist tot.
Tiffin reitet, den linken Arm fest an den Körper gepresst, das Gewehr in der rechten Hand, hinter Lispy her.
Dann aber, und es ist Tiffin, als geschehe vor ihm etwas, was er nie mehr sehen wird, entdeckt er den Mann, der blond wie Kenneth Cord ist.
Der Mann ist schon fast 100 Yards entfernt, dreht sich jäh im Sattel und sieht ihn. Er sinkt so plötzlich nach links, dass Tiffin glaubt, er müsste aus dem Sattel stürzen. Aber dann, und Tiffin traut seinen Augen nicht, hängt dieser Bursche wie ein Indianer an seinem Pferd, hat die Hände völlig frei und zerschneidet blitzschnell die Longe der beiden anderen Pferde.
In der nächsten Sekunde fliegt er hoch, saust über den Sattel hinweg, verschwindet nach rechts und reißt sein Pferd herum.
»Großer Gott«, sagt Roy Tiffin entsetzt, »der ist wahnsinnig, das schafft kein Mensch. Er kommt nie den Hang hinauf.«
Er sieht es so deutlich und es ist so unglaublich, dass es ihm den Atem verschlägt, und er seine Pferde zügelt. Lispy, der letzte Mann, jagt sein Pferd im flachen Winkel den steilen Geröllhang hoch. Sein Pferd stampft, das Geröll gerät in Bewegung, prasselt in die Tiefe und wächst zu einer Lawine an.
Unglaublich, das Pferd stürmt weiter, obwohl bei jedem Satz, den es macht, das Geröll wegrutscht. Drei-, viermal sieht es aus, als würde das wegrollende Gestein das Pferd wie auf einem Rutschbrett in die Tiefe reißen. Aber der Mann dort im Sattel, der ohne Steigbügel reitet, der sich nur irgendwo am Sattel, an der Mähne oder manchmal an den Zügel klammert, dieser Mann beherrscht sein Pferd mit traumhafter Sicherheit.
Donnerwetter, denkt Tiffin und vergisst seine Schmerzen, vergisst, dass er diesen Mann verfolgen will. So einen Reiter gibt es nicht. Oder der Hang ist fester als es scheint. Es muss so sein, sonst würde er nicht hochkommen. Gleich ist er oben. Alle Wetter, wie der reitet.
Da ist John-Lispy Glouster oben, schwenkt seinen Hut und sieht herab.
»Du verdammter Kerl«, knurrt Tiffin und drückt seinem Pferd die Hacken ein. »Du denkst wohl, Roy Tiffin kann das nicht, was? Warte, dir werde ich zeigen, was ich mache.«
Weg mit der Longe, der Braune springt an. Tiffin rast auf den Hang zu, und blickt nach oben.
Der Bursche da oben blickt entsetzt auf ihn herab. Und dann hört er ihn laut rufen.
»Nein! Nicht, Tiffin, bleib unten!«
Umsonst, denkt Tiffin. Du denkst wohl, du kannst mich bluffen, was, Bursche? Roy Tiffin kann das auch, du wirst es sehen.
Steine prasseln, das Pferd stampft. Gewicht verlagern, auch wenn der Arm, den die Kugel aus Joes Gewehr getroffen hat, wie wild schmerzt. Das Gewehr hat er im Scabbard, die Hände frei. Er jagt hoch.
Da rutscht das Tier weg. Es kommt so plötzlich, dass er gar nichts mehr tun kann. Das Geröllfeld setzt sich in Bewegung, sein Pferd kippt seitlich weg und prallt auf den Hang. Er wird weggeschleudert, knallt auf das Geröll und sieht es rutschen. Es kollert über seine Beine, reißt ihn mit.
Mein Gott, denkt er und versucht auf die Knie zu kommen. Aber die ganze Wand bricht ein, ein riesiges Stück löst sich. Klickernd, tosend, als schütte man Steine aus einem Riesensack zu Boden, setzt sich das Geröll in Bewegung und hält ihn wie in einer Zange fest. Er schreit auf, als ihn Steine am Kopf treffen. Er sieht, herumrutschend und doch nicht freikommend, das Ufer des Baches und, über das Ufer hinwegrollend, das Geröll ins Wasser schießen. Zehn Yards bis nach unten, acht, sieben … Und es dreht ihn wieder. Durch die große Staubwolke sieht er, wie sich der halbe Hang löst und weiß nun, der Mann dort oben ist ein Reiter, den er nie in seinem Leben wiedersehen wird. Zu spät. Alles zu spät für Roy Tiffin, den das Geröll umklammert und in die Tiefe reißt. Der Bach, denkt er und liegt plötzlich unten, rutscht nicht mehr, will sich aus dem Geröll graben, schaufelt wie irr mit den Händen und sieht immer mehr nachrutschen. Der Bach ist zugeschüttet.
Ihn aber deckt nachkollerndes Geröll zu. Hinter ihm, und er sieht es voller Entsetzen, türmt es sich im Bach zu einer Wand auf, wächst anderthalb Meter über ihn hinaus.
Mühsam, die Kraft erlahmt, versucht er die Steine Handvoll für Handvoll abzutragen, aber sie rollen sofort nach. Und dann merkt er es. Er hört es am Glucksen, er sieht es unter sich in kleinen springenden Wellen gegen das Geröll klatschen. Das Wasser beginnt zu steigen. Er stiert aus herausquellenden Augen auf das Wasser, das stetig, gestaut durch die Riesenmasse Geröll, an den Steinen hochkriecht. Einen halben Meter ist es unter ihm, er kann es erreichen, als er den Arm ausstreckt. Und er fühlt, wie es stetig steigt. Es kommt höher, sucht seinen Weg und wird ihn überspülen.
Nein, denkt Tiffin entsetzt und schaufelt. Aber umsonst. Das nachrutschende Geröll schiebt ihn nur noch weiter dem Wasser zu. Er wird ertrinken.
Er liegt ganz still. Das Entsetzen in ihm lässt ihn keine Bewegung mehr ausführen, die doch sinnlos wäre.
Es ist aus, er wird hier sterben.
Immer höher steigt das Wasser. Er schreit nicht, denn die Angst schnürt ihm die Kehle zu. Verzweifelt blickt er sich um, sieht zum Hang hoch.
Der Reiter ist nicht mehr zu sehen. Der würde ihm auch nie geholfen haben. Dem kann es nur recht sein, wenn Roy Orwell Tiffin ertrinken würde.
»Lieber Gott«, sagt Tiffin stöhnend und weiß zum ersten Mal richtig, was Angst heißt, »lieber Gott, lass ein Wunder geschehen.«
Und dann hebt er jäh den Kopf.
Hufgeräusche dringen an sein Ohr. Da rast jemand heran. Direkt neben ihm, durch wegspritzendes Geröll, stiebt das Pferd an das Ufer.
Er blickt wie gebannt auf das Tier, das plötzlich steht, auf den Mann, der die Hände auf das Sattelhorn stemmt und auf ihn herabsieht.
Der Mann sagt nichts, sieht ihn nur an.
Ja, denkt Tiffin, er sieht zu, er kann ruhig zusehen und will sich überzeugen, dass ich ihm nie mehr nachkommen kann.
Lispy steigt ab, nimmt sein Lasso und springt in das Wasser. Dann schnallt er seinen Waffengurt ab und schlingt ihn unter Tiffins Armen durch.
Er bindet das Lasso an den Gurt, geht zu seinem Pferd, befestigt den Strick am Sattel und sitzt auf.
»Festhalten, Tiffin!«
Das ist alles, was er sagt. Dann reitet er vorsichtig an. Das Seil strafft sich, der Druck legt sich um Tiffins Brustkorb, presst unter die Arme. Aber er kommt langsam aus dem Geröll heraus, klatscht dann ins Wasser, taucht prustend auf, zieht sich am Lasso hoch und steht.
Der Bursche aber, der ihn herausgezogen hat, sieht ihn kaum an, macht das Lasso los, blickt kurz hoch, als er vor seinem Pferd steht und Roy ihm das Lasso samt Gurt hochreicht. Er nimmt nicht einmal seinen Revolver, dieser Kerl.
»Bist du Lispy?«, fragt Tiffin stockheiser, als der Mann immer noch schweigt. »Du hast Joe gesehen?«
»Ja«, erwidert John-Lispy Glouster. »Er war ein guter Mann. Er blieb, damit ich entkommen konnte. Ich werde ihn begraben, dann können wir reiten, Deputy. In meinem Packen sind zwei Hemden. Cord hatte wirklich nichts mit der Geschichte bei den Cranes zu tun, ich werde es beschwören.«
»Wo willst du es beschwören?«
»Nun, ich denke in Missoula, wie?«
»Du willst dich stellen? Mann, ich habe dich nie gesehen. Begreifst du nicht?«
»So?«, fragt Lispy verwundert. »Ich kann reiten, wohin ich will?«
»Was sonst? Warte, ich helfe dir, Joe zu begraben. Wer hat dir das Reiten beigebracht?«
»Keiner«, erwidert Lispy verblüfft. »Ich kann das eben, Tiffin.«
»Wenn ich jemals etwas gesehen habe, das ich nie vergessen werde, dann deinen Ritt den Hang hinauf. Hör mal, hast du eine Arbeit?«
»Arbeit – ich?«
Er sieht an ihm vorbei und blickt plötzlich nach Süden.
»Ja«, sagt er gedehnt und denkt an den Rio Pecos und daran, dass Joe sicher auf den Brief gewartet hätte. »Ja, ich habe eine. Ich muss nur tausend Meilen reiten.« Tausend Meilen und ein paar. Und nicht sechzig. Sechzig Meilen bis zum Galgen.
*
»Kenneth!«
Kenneth Cord bringt das Pferd zur Ruhe, reitet an den Corralzaun und sieht seinen Boss an, von dem er eine ganze Menge gelernt hat, auch über Rechthaberei.
»Ja, Boss?«
»Kenneth, du weißt, dass Miss Crane und ich in vierzehn Tagen heiraten, wie?«
»Ja, Boss, es hat sich herumgesprochen.«
»Dann ist es ja gut. Aber da ist noch etwas. Sie möchte, dass du unser Trauzeuge bist.«
»Ich?«, fragt Kenneth Cord verwundert. »Aber, Boss, ich bin doch nur der Zureiter. Die Cranes haben so viele große Freunde, angesehene Leute …«
»Sie will aber dich als Trauzeugen, Kenneth.«
»Hm, wenn sie unbedingt will. Aber ich habe gar keinen Anzug dafür, Boss.«
»Wir reiten nachher beide in die Stadt. Einverstanden?«
»Gut, Boss. Hier ist eine prächtige Mannschaft, lauter feine Partner. Ob Lispy wohl auch Freunde und gute Partner gefunden hat?«
»Das wird er, hoffe ich, das wird er wohl.«
Beide reden von dem Mann, der spurlos verschwand.
Ob er auch so prächtige Partner gefunden hat?
*
Ich habe gelogen, denkt Lispy, ich hab’s tun müssen, aber ich weiß, dass Joe es nicht anders gewollt hatte. Er ist gestorben, habe ich gesagt. Es war ein Unfall, habe ich gesagt. Die Geröllhalde, wir versuchten hinaufzureiten, da kam er unter das Geröll. Es war ein Unfall … Was sollte ich sonst sagen, Joe? Sollte ich ihnen erzählen, dass du die ganzen Jahre mit einem Irrtum geritten bist, dass er gar nicht tot war, dein Vater, dass er lebt und ganz gesund ist? Und dass deine Mutter einen ganzen Monat gebraucht hat, um darüber hinwegzukommen, dass du nie mehr hier sein wirst? Es gibt Dinge, Bruder Joe, die versteht kein Mensch. Wir sind wohl zu dumm, um all das zu begreifen, was das Leben so für uns aufspart.
Er isst instinktiv, sieht kaum hoch von seinem Teller. Sie haben mich hier aufgenommen wie einen Sohn, denkt er, wie einen richtigen Sohn. Ich habe alle Pferde bekommen, für die sorge ich. Und weil ich Joe’s Freund gewesen bin, weil ich seine Uhr und seine paar Sachen mitgebracht habe, darum lassen sie mich nicht weg. Ich gehöre zur Familie, ich, John-Lispy Glouster, der es bestimmt nicht verdient hat, weil ich sie belogen habe.
Als das Essen vorüber ist, geht er hinaus zum Pecos. Dort sitzt er sehr oft und redet mit dem Fluss, als wäre der Fluss sein Bruder Joe James Langley. Er nimmt ein paar kleine Kiesel und wirft sie in das ruhige Wasser, bis er die Schritte hinter sich hört.
»John, ich habe doch Geburtstag. Warum sitzt du wieder hier?«, fragt sie und setzt sich neben ihn. »Ich weiß, warum du hier sitzt und an wen du denkst. Und alle anderen wissen es auch, John. Du hast ihn sehr gemocht, ja?«
»Ja«, sagt er heiser. »Keiner weiß wie sehr. Schon gut, Lucy, ich habe niemanden daran erinnern wollen, verstehst du?«
»Manchmal denke ich, du wirst eines Tages fort sein, so einfach fort, als hätte es dich nie gegeben. Weißt du, dass es genauso schlimm für uns Langleys sein würde, als hätten wir Joe noch einmal verloren? Bill mag dich wie einen richtigen Bruder. Vater vergleicht dich mit Joe, Mutter liebt dich. John, du darfst uns nie verlassen.«
Er presst die Lippen zusammen und schweigt, bis ihre Hand kommt und sich über die seine legt.
»John, sie – sie haben gesagt, ich soll dich holen. Und John, ich muss dir etwas sagen. Ich mag dich noch mehr als die anderen. Ich glaube, sie wissen es alle, nur du noch nicht. John, ist es schlimm, wenn ich dich sehr mag?«
»Nein«, antwortet er verlegen. »Es ist nicht schlimm, ich meine nur, du kennst mich zu wenig. Ich habe nichts, ich bin nichts. Nur John Glouster, ein Fremder, den ihr aufgenommen habt wie einen von euch, der euch alle mag und dich besonders, Lucy. Wenn ich gewusst hätte, dass ich dich eines Tages so gernhaben würde, dann wäre ich wohl nie gekommen. Lass mir Zeit, Lucy, ich liebe dich, aber …«
»Kein Aber, John, bitte. Joe würde es so wollen. Glaubst du nicht, dass er uns vielleicht jetzt sieht und lächelt? Dass er zufrieden ist und alles so haben wollte? Sonst wärest du niemals hergekommen. Glaubst du das nicht auch? Es sollte alles so sein, John, du musst es nur glauben. Du und ich, das hat Joe so bestimmt, ich weiß es.«
Er legt den Arm um ihre Schultern und zieht sie an sich. Und während er über ihr helles Haar hinweg auf den Fluss blickt, ist es ihm, als lache irgendwo jemand im Glucksen der Wellen und dem leisen Rauschen des Büffelgrases, im Wispern der Blätter und Zirpen der Grillen.
Und er denkt, dass Joe es wirklich so gewollt haben könnte, denn er sitzt hier und es ist wieder Frühjahr geworden in New Mexico.
Dies ist Joe’s Land.
Und dies ist Joe’s Frühling.
Dies alles ist Joe James Langleys Wille.
Und so soll es bleiben, bis der letzte Hauch erlischt, wie Joe es gewollt hat, der immer bei ihm sein wird. Jeden Tag und jede Stunde, bis an sein
– E N D E –