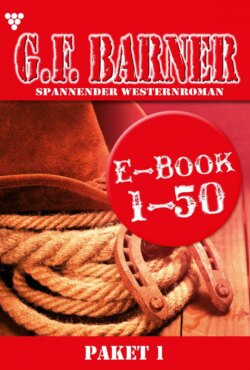Читать книгу G.F. Barner 1 – Western - G.F. Barner - Страница 9
ОглавлениеEs war ein Gefühl, das Clancy nicht beschreiben konnte. Vielleicht hatte dieses Gefühl Ähnlichkeit mit dem Druck eines Messers, das ihm jemand an den Hals hielt. Oder es war wie die Wucht eines Revolverlaufes, der sich in seinen Bauch preßte. Er hatte diese Ahnung schon öfters gehabt, und er hatte sie nun schon wieder. Sie kam und ließ den Schweiß aus den Poren perlen.
Clancy wendete den Kopf.
Dann sah er das Blinken auf dem Felsen, ebenso einen Hut. Im selben Augenblick warf er sich zur rechten Seite und wußte, daß der Knall kommen mußte. Ihm blieb keine Sekunde mehr. Ein Würgen preßte seine Kehle zusammen, und da war schon das Pfeifen über ihm. Es zerriß die Stille dieses Morgens und das leise Klappern der Hufe seines Pferdes auf dem moosigen Talboden.
Der brüllende, peitschende Knall folgte. Er ließ die Vogelstimmen verstummen und irgendwo am Hang ein Erdhörnchen in rasenden Sprüngen in seinen Bau flüchten.
Clancy flog an der Flanke des Pferdes herab, während die Kugel knapp über den Sattel strich. Sie feuerte dort vorbei, wo Clancys Rücken gerade gewesen war. Er fiel, aber seine Hand schnappte nach dem Gewehr. Es war ein Griff, den Clancy tausendmal geübt hatte. Mit einer zuckenden Bewegung erwischte er den Kolben seines Gewehres. Plötzlich wußte er, daß es nicht nur einer war, der ihn vorbeigelassen und dann auf seinen Rücken gefeuert hatte.
Noch im Fallen raste das krachende Tosen der beiden nächsten Schüsse durch das enge Tal und erfüllte die Luft mit wabernden, knallenden Stößen. Sie trafen seine Trommelfelle wie Hiebe mit einer flachen Hand.
Clancy hörte sein Pferd schreien. Er kannte den Schrei – ein seltsam hohes, schrilles Klagen, das ein Pferd immer dann ausstieß, wenn es starb.
Das Pfeifen der Kugeln strich an ihm vorbei, ehe er hinschlug. Mit dem Gewehr in der Faust schnellte er sich ab, kaum daß er am Boden lag. Aus den Augenwinkeln sah er, wie das Moos neben ihm hochflog. Es sah aus, als hätte jemand kleine Sprengladungen unter dem Moos in die Luft gehen lassen. Clancy rannte. Er lief, schlug einen Haken, noch einen. Das Fauchen war jetzt so nahe, daß er den Luftzug der Kugeln zu spüren glaubte und sich noch tiefer duckte. Etwas pfiff jaulend an seinem Kopf vorbei. Es schlug gegen den staubbedeckten Felsen rechts von ihm und riß eine kleine verpuffende Wolke empor. Zwischen den Steinen gähnte eine Lücke, ein Spalt, durch den er sich zwängen und den Kugeln entgehen konnte. Der Spalt war wie ein Loch. Clancy spürte in dieser Sekunde, daß sie jetzt alle drei, die von oben auf ihn feuerten, auf das Loch zielten.
Mit einem Ruck warf er sich nach links und sprang jäh in die Höhe. Es war die letzte Chance, die ihm blieb. Das erkannte er im Bruchteil eines Augenblicks. Lief er durch den Spalt hinter die Felsen, hatte er drei Kugeln im Rücken. Darum sprang er, höher als jemals zuvor in seinem Leben. Der Felsen war fast anderthalb Schritt hoch. Einen winzigen Moment lang packte Clancy die Furcht, daß er diese Höhe nicht schaffen würde. Dann drehte er sich in der Luft.
In der Luft lag plötzlich ein lauerndes Schweigen. Es verriet ihm, wie sehr sie darauf gewartet hatten, daß er durch das Loch fegte. In dieses Schweigen gellte ihr Schrei hinein.
Sie hatten keine zwei Sekunden gewartet. Er konnte sich ihre Gesichter und die Gier in ihren Augen vorstellen, mit der sie auf das Loch gezielt hatten. Jetzt mußten sie ihre Gewehre herumreißen, und sie taten es. Er sah nichts davon, aber er spürte jede ihrer Bewegungen.
Vor ihm war die schroffe, rauhe Kante des Felsblockes. Und dann schlug er gegen ihren oberen Rand. Wie ein Hieb traf es seine linke Hüfte. Schmerz schoß bis unter seine Achsel. In seinem Rücken war das schwere Brüllen der Gewehre. Es vereinte sich mit dem Klatschen der Kugeln, die am nackten Fels zerplatzten. Irgendwo an seinem linken Arm war ein Zupfen, aber in der gleichen Sekunde drehte sich sein Körper.
Rod Clancy fiel mit einem Schrei hinter den Felsblock. Er schrie einmal schrill und kurz. Er dachte an jenen Mann, den er in Wels erschossen hatte. Der Mann hatte genauso kurz und schrill aufgeschrien, ehe er zu Boden gesunken und klein wie ein Schatten geworden war.
Clancy hoffte einen Moment, daß sie seinen Schrei richtig deuten würden, daß sie ihn hörten. Aber sie schossen weiter. Er flog hin, knallte auf grobes Gestein, schlug sich das Knie auf und wälzte sich doch zurück hinter den Busch. Jetzt sah er, wie die Kugeln in die zitternden, bebenden Zweige der Espe jenseits des nächsten Felsblockes schlugen. Es war, als schüttelte jemand einen Baum, um Maikäfer aus seinem Blattgewirr fallen zu sehen. Clancy starrte auf die wegplatzende, von einer Kugel weggerissene Borke des Baumes. Dann lag er still, ein Brennen im linken Arm, ein Ziehen und Reißen im Knie.
Es wurde totenstill. Es war so still nach diesem irrsinnigen, wilden Feuer daß er glaubte, es wäre Sonntag und er hätte sich zu Hause auf der Bank unter den Baumwollbäumen ausgestreckt. Über ihm stand die Sonne, verdeckt vom Geäst der Espe. Durch die Zweige und Blätter tasteten ihre Strahlen nach Clancy. Die Männer schossen nicht mehr, auch das Echo war verrollt.
Roggers, dachte Clancy und hob sacht den linken Arm, Roggers, der Schurke. Ich hätte ihm nicht unter das Kinn schlagen sollen zum Abschied. Ich hätte weggehen sollen, still, heimlich und leise, aber nicht schlagen. Doch was macht man, wenn einen die Lumperei eines anderen Mannes anwidert? Schluckt man sie oder wehrt man sich? Roggers hat sie geschickt, dachte Clancy.
Nur er konnte die drei Burschen dort auf den Wänden des Tales bezahlen und auf seine Fährte gesetzt haben. Roggers, der mächtigste Mann aus Silver-City in Südwest-Nevada. Sie sollten ihn töten, weil er zuviel wußte.
Clancy betrachtete seinen linken Arm und das Loch im Ärmel der Jacke. Er spürte das Brennen unterhalb des Ellbogens. Langsam senkte er die Hand bis sie den Boden berührte. Danach sah er auf sein Handgelenk.
Als der rote Faden abwärts rollte, über das Handgelenk und den Ballen hinweg, erkannte er, daß sie ihn getroffen hatten. Es war nicht nur ein harmloses Loch im linken Ärmel der Jacke.
Das Blut besorgte irgend etwas in ihm. Wut kam in ihm hoch. Diese verdammte Wut hatte er schon oft gespürt, wenn ein Pferd ihm beim Zureiten die Knochen im Leib durchgeschüttelt oder ihn abgeworfen und gegen Corralstangen geschleudert hatte.
Die Wut verging, sie machte kaltem Zorn Platz. Roggers hatte also gleich drei Mann geschickt. Drei, weil einer für Clancy zu wenig gewesen wäre. Roggers kannte ihn zu genau. Der Schurke wußte, wie schnell Clancy mit dem Revolver und dem Gewehr war. Er kannte auch seine Härte und Kaltblütigkeit.
Clancy zog die Beine an. Ein Stein kam dabei in Bewegung. Ehe der Brocken umfallen und klappernd an andere Steine schlagen konnte, handelte Clancy. Seine Rechte legte schnell und sacht das Gewehr zu Boden. Dann griff sie nach unten und hielt den Stein fest.
Nur kein Geräusch! Tot spielen!
Clancy hob das Bein an. Dann erst drehte er sich, rutschte herum. Als er mit dem Gesicht zum Felsblock lag, nahm er sein Gewehr wieder auf.
Alles blieb still.
Wölfe, dachte er, Wölfe sind auch still, wenn sie die richtige Entfernung zu ihrem Opfer haben. Dann heulen sie nicht mehr. Sie kauern sprungbereit da und warten. Sie warten...
Er wußte, sie würden die Stille nicht so lang aushalten wie er. Sie waren bezahlte Killer. Sie mußten glauben, daß er tot war, oder aber schwer verletzt hinter den Steinen lag.
Sie werden es herausfinden wollen, dachte Clancy. Immer ruhig, ich habe Zeit, sie keine! Und da...
»Pfüüüt... püffft!«
Der Pfiff schwoll an und brach ab.
»Yeah?« fragte jemand ganz links. Nun begriff Clancy auch, warum sie hier gewartet hatten. Er hatte etwas außerhalb der Mitte drüben reiten und dann an die rechte Wand heran müssen. Hier erst war er wieder in die Mitte des Tales zurückgeritten, weil nur noch selten Felsblöcke in der Mitte lagen. Er hatte den freien Reitweg gewählt. Genau dort hatten sie ihn haben wollen, als eine Schießscheibe, aber eine menschliche. Rechts hätten sie nicht liegen können. Die Espen wuchsen hier am Hang des Tales. Blätter und Zweige hätten ihnen die Sicht verdeckt.
So war das also gewesen.
»He, paßt auf, ich sehe es mir an!«
»Vorsicht, der lebt vielleicht noch.«
»Das will ich ja gerade wissen, Mann!«
Die Stimme, dachte Clancy, diese Stimme! Dann erkannte er sie, und ein Schauer der Furcht kroch über seinen Rücken.
Links über dem Tal lag Jack Porter. Er war als Einzelgänger verschrien. Als Mann, der Menschen wie Tiere jagte. Vor allen Dingen solche, die irgendwo gesucht wurden. Die sich im Distrikt um Silver City nur zu oft blicken ließen, weil es dort immer etwas zu erbeuten gab.
Jack Porter, der Kopfgeldjäger, war da. Aber Roggers hatte auch Porter nicht zugetraut, die Sache allein zu machen. Porter schwieg jetzt. Dafür ertönte das Tacken von Hufen, das sich zum Galopp steigerte.
Er kommt, dachte Clancy, aber nicht im Talgrund. Er wird zur anderen Wand reiten und mich von oben sehen wollen. Nun gut, das kannst du haben, Mr. Kopfgeldjäger.
Clancy streckte langsam die Hand vorwärts. Er sah den Zweig, den eine Kugel glatt abgeschlagen hatte. Mit dem Gewehrkolben zog er ihn zu sich heran. Danach schob er das Gewehr nach links und drehte es um. Die Mündung lag jetzt bei ihm, der Kolben weit weg. Clancy wälzte sich auf die Seite. Seine rechte Hand zog den Colt. Er spannte den Hammer und nahm mit der Linken den Zweig hoch. Ihn schob er über die Hand. Der Revolver war nicht mehr zu sehen. Und Clancy lag nun auf der rechten Hüfte.
So wird das sein, Mr. Kopfgeldjäger, dachte Clancy. Du steigst jetzt nach oben. Zuerst siehst du mein Gewehr. Es liegt so am Boden, daß ich es niemals erreichen könnte. Bis zur Wandkante oben sind es dreißig Schritt.Was wirst du also denken? Du wirst denken, daß ich, selbst wenn ich den Colt in der Hand hielte, auf die Entfernung doch nicht viel machen könnte. Aber das ist nicht alles. Du siehst, daß ich auf meinem Revolverhalfter liege. Die Waffe ist folglich eingeklemmt. Jetzt kannst du kommen, Porter.
Seine Linke hob sich. Er nahm den Ellbogen hoch. Blut tropfte auf sein Gesicht herab. Er ließ es tropfen, bis es ihm über die Wange rann.
Fertig, dachte Clancy, komm nur, Mister...
*
Das Hufgeräusch war verstummt. Oben rührte sich scheinbar nichts. Und doch schlich sich Porter jetzt an. Er kam. Aber er war kein Narr, daß er sich durch große Geräusche verriet.
Clancy lauschte, bis er das leise Scharren hörte. Es war hoch über den zitternden Zweigen der Espe. Porter konnte ihn nicht gut sehen. Er mußte näher an die Kante, mehr über ihn, so daß er zwischen den Ästen den Blick frei hatte.
Warten, dachte Clancy eiskalt, warten. Er ist zu erfahren, er läßt sich nicht so leicht bluffen. Der Kerl soll mehr als dreißig Mann erwischt haben, die Hälfte davon von hinten. Was macht er jetzt?
Oben war nichts. Kein Scharren, kein Bröckeln von Erde oder jenen kieselähnlichen Steinchen.
Eine halbe Minute verstrich, eine volle ging herum. Und dann...
»Hugh, da liegt er!«
»Wo, Mann, wo?«
»Hinter den Steinen, Hugh. Blut an seinem Kopf und an seiner Hand, sein Arm ist auch getroffen. Wir haben ihn erwischt.«
»Bist du sicher?«
»Yeah, kann ihn genau sehen. Er ist hin, sage ich di...«
Zu mehr kam Jack Porter nicht. Er brach ab, ehe er den Satz vollenden konnte.
Clancy warf sich mit einem Ruck herum, der Zweig flog weg, die Hand stach steil nach oben.
In dieser einen Sekunde zwischen Leben und drohendem Tod sah er ihn über sich stehen. Er blickte auf dreißig Schritt in Porters längliches, schon von Altersfurchen gezeichnetes Gesicht. Er sah die lange, gebogene Nase und den schmalen Mund, dessen Lippen sich geöffnet hatten und nun schlossen. Er sah das Zucken von Porters leicht schrägstehenden Augen, wie sie sich weiteten. Und... er sah das Gewehr Porters herunterzucken, die Mündung auf sich zuschnellen.
In derselben Sekunde drückte er ab. Der schwere Fünfundvierziger in seiner Faust brüllte los. Einen fürchterlichen Moment lang hatte er das Gefühl, von Porters Kugel doch noch getroffen zu werden, denn die Mündung des Gewehres stieß einen Feuerball aus. Hart neben ihm jagte das Geschoß in die Steine.
Clancy feuerte noch einmal. Doch nun sah er, wie die Mündung des Gewehres sich hob und Porter irgendwohin auf die Mitte des Tales zielte. Er sah, wie die Hand des Kopfgeldjägers den Unterbügel nach vorn brachte und zurückriß. Dann brach der zweite Schuß aus der Waffe. Aber die Kugel jagte zwanzig Schritt weiter in das Moos des Talbodens.
Porter stand still. Sein Mund öffnete sich jäh zu einem Schrei. In derselben Sekunde erkannte Clancy, daß er genau getroffen hatte. Porter trug ein fahlgelbes Hemd, auf dem sich plötzlich ein roter Fleck zeigte. Die Kugel hatte Porter unter den Rippen getroffen.
Der Mann schwankte nur zwei Sekunden lang, als wolle er nach hinten kippen. Danach aber knickte er ein. Es sah aus, als wollte er eine abgezirkelte, höfliche Verbeugung machen. Seine Hände hielten immer noch das Gewehr fest. So neigte er sich nach vorn, bis das Übergewicht seines Körpers ihn vorwärtsriß. Er fiel wie eine Puppe, deren Glieder man verbogen hatte, auf die linke Espenkrone zu. Die Zweige und der spitze Stamm nahmen seinen fallenden Körper auf. Plötzlich überschlug sich Porter. Sein Gewehr wirbelte, von einem hochwippenden Ast getroffen, zurück.
Er fiel weiter. Er schrie noch, als er das letzte Stück auf die Felsen zustürzte.
Clancy verfolgte seinen Fall, bis Porter kurz vor den Felsen war. Dann machte Clancy die Augen zu und warf sich herum. Er erreichte sein Gewehr, riß sich den Hut vom Kopf und machte die Augen wieder auf. Hinter ihm war ein Klatschen. Der Schrei riß ab. Ein dumpfer Aufschlag brachte das spärliche Unterholz in knackende, splitternde Bewegung. Den Hut auf das Gewehr pflanzend, schob Clancy die Waffe hoch. Das Peitschen kam in der nächsten Sekunde. Der Hut erhielt einen Schlag, trudelte um die Mündung und fiel dann zu Boden.
Drüben schrie einer. Seine Stimme überschlug sich, sie kreischte nervös:
»Hugh, Hugh, er hat Jack erwischt! Hugh...«
»Halt das Maul!« brüllte jemand barsch. »Sei ruhig, John, den bekommen wir. Paß auf und schieß, er kann da nicht raus!«
Das Wummern setzte ein. Die ersten beiden Kugeln zischten gegen den Stein. Pferdehufe klapperten, Wiehern erklang. Und dann schrie noch einer, aber barsch und scharf:
»Halt, weg mit dem Gewehr, oder ich drücke ab! Laßt die Waffen fallen!«
Irgendwo drüben ertönte ein Fluch. Pferde jagten an, es waren mindestens zwei.
»Carter, das Gewehr weg, sonst schieße ich dich nieder!«
Claybran, dachte Clancy und blies den angehaltenen Atem aus. Claybran, der Sheriff von Silver City, Gott sei Dank. Nun gut! Roggers, du wolltest es nicht anders! Jetzt packe ich aus, und dann bist du fertig.
Er stemmte sich vorsichtig hoch und sah John Carter drüben stehen. Er sah nun auch Hugh Stacy auftauchen und die Hände hoch halten. Hinter ihm erschienen die Reiter. Es waren drei Mann. Biddells war dabei, Johnston, der Deputy. Sheriff Claybran hielt sein Gewehr in der Faust und zielte auf Stacy.
»Clancy?«
»Yeah«, brummte Clancy. Er wußte, Claybran war nicht gerade sein Freund. Aber er hatte verhindert, daß die Falle noch einmal hätte zuschnappen können. »Hier, Sheriff.«
Johnston und Biddells sprangen ab. Sie entwaffneten die fluchenden, wild protestierenden beiden Schurken, während Clancy die Deckung verließ.
»Wo ist Porter, der Hundesohn, he?«
»Hinter mir liegt er«, sagte Clancy kurz. Er sah sich um und sofort wieder weg. Porter war mit dem Kopf auf die Felsen geschlagen. Es war kein Anblick, derAppetit machen konnte.
»Ist er tot?«
»Yeah, Claybran, das ist er.«
»Dann schnall ab, Mister – das Gewehr hinlegen und herkommen!«
»Was ist?« fragte Clancy verwundert. »He, Claybran, was soll das heißen?«
»Hast du nicht gehört? Ich werde euch Burschen zeigen, wie das Gesetz aussieht. Das Gewehr weg und den Gurt ab, Clancy!«
»Verdammt noch mal!«
Was blieb ihm anderes übrig? Er legte das Gewehr zu Boden und warf Gurt und Revolver auf die Waffe, ehe er weiterging. Als er zehn Schritt entfernt war, passierte es. Es traf ihn wie ein Hieb in die Magengrube und mähte ihn beinahe um.
»Frag ihn gleich, wo er das Geld hat!« schrie Hugh Stacy schrill und wütend. »Na, los doch, Sheriff, jetzt frag den Hund mal! Er fing an, er schoß zuerst. Wir wollten nur mit ihm reden, klar? Mit dem Schießer hätten wir uns doch nicht eingelassen. Wir sind doch nicht irrsinnig genug, uns von ihm umbringen zu lassen, verstehst du? Frag ihn nur, wo er das Geld von Roggers hat.«
»Was, was ist das?« stotterte Clancy und bleibt jäh stehen. »Verflucht, was heißt das, Claybran, was sagt dieser Hundesohn und Herumtreiber?«
Er stand dicht vor seinem Pferd, aber zu weit von seinem Colt entfernt. Sie mußten einfach verrückt geworden sein. Der Sheriff zielte jetzt auf ihn, statt auf den stadtbekannten Herumtreiber und Schläger Hugh Stacy. Er zielte auch nicht auf John Carter, der genauso verrufen war. No, Claybran zielte auf seine Brust.
»Wo ist es?« fragte Claybran scharf. »Clancy, wo hast du die zweitausend Böcke gelassen, he?«
»Wa...was? Claybran, bist du verrückt?«
»Wo hast du die zweitausend Böcke – Dollar – Greenbacks oder Scheinchen, wo hast du sie gelassen? In der Satteltasche?«
Clancy hatte plötzlich das Gefühl, mit dem Kopf gegen einen riesenhaften gelbschimmernden Messinggong geschlagen zu werden. Das Dröhnen spaltete fast seinen Kopf. Er sah sekundenlang alles verschwommen.
Und dann – wie ein Blitz, der vor ihm in den Boden raste und ihm alles in blendender Helligkeit zeigte – sah er die Szene wieder vor sich.
Roggers, der ihm seinen Lohn nicht geben wollte. Roggers vor dem Geldschrank, dessen Tür er unter den drohenden Blicken Clancys aufzog.
»Da hast du dein Geld!« hatte Roggers bissig gesagt. »Zum Teufel mit dir!«
Aber es war kein Geld in der Hand, als er sie um die Tür herum ausstreckte. In der Hand lag der Bullcolt, das kleine, verfluchte, mörderische Ding, mit dem man einen Mann auf zehn Schritt noch erwischen konnte. Doch Clancy war nur zwei entfernt. Er sprang und schlug zu, knallhart gegen die Tür. Sie klemmte Roggers Arm ein. Er schrie und konnte nicht mehr schießen. Aber sein Kinn hielt er hin. Und an das Kinn krachte Clancys Faust. Dann nahm er sich sein Geld und ging hinaus. Er hatte noch die Scheine im Safe gesehen, aber nichts mehr als seinen Lohn genommen.
»So ist das?« keuchte Clancy. Danach bekam er keinen Ton mehr heraus. Er wußte plötzlich, daß Roggers ihm den Diebstahl von zweitausend Dollar angehängt hatte. Darum auch hatte er Porter ihm nachgeschickt. Das war ein guter Grund, wie?
»Yes, so ist das«, wiederholte Sheriff Claybran grimmig. »Ich erfuhr das erst ein bißchen spät, Mister. Roggers hatte schon Porter auf deine Fährte gehetzt, aber ich bin ja noch rechtzeitig gekommen, was? Nicht, daß ich was dagegen hätte, daß dieser Hundesohn Porter endlich ins Gras gebissen hat. Der war schon lange reif, dieser Schmarotzer. Aber ich habe etwas dagegen, wenn sich Leute wie Roggers anmaßen, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen, Clancy.
Du hast also das Geld, wie? Und du gibst es freiwillig heraus, eh?«
»Der hat ’n Trick, der hat immer noch ’nen Trick in der Westentasche!« kreischte Carter gellend. »Sheriff, ich sage dir, sei vorsichtig, sei bloß vorsichtig mit diesem Schnellschießer. Als er uns sah, tat er ganz freundlich und stellte sich dumm. Er sagte doch glatt, er hätte von dem Geld keine Ahnung. Und dann riß er die verdammte Flinte auch schon hoch und flog aus dem Sattel. Siehst ja, wie schnell der Lump ist. Sein Pferd trafen wir. Das opferte er kaltblütig, um uns auszutricksen. Weiß der Satan, ob er uns nicht alle geschafft hätte. Der fing an, der fing an, stimmt es, Hugh?«
»Und ob das stimmt!« schrie Stacy. »Sieh dich vor, Sheriff, der hat vielleicht noch einen Colt, der Strolch!«
»Halt du dein Maul, du bist selber ein Strolch – und was für einer!« fuhr Claybran ihn finster an. »Also, steh still, Clancy. Ich weiß zu gut, wie gefährlich du Satan sein kannst. Vielleicht erzählst du mir mal, warum du bei Roggers aufhörtest, he? Als Revolvermann und Oberaufpasser in seinen verdammten Spielhöllen bekamst du doch einen Haufen Geld, oder? Und so einen Job hast du aufgegeben? Warum, he?«
»Weil – weil der Lump Falschspieler beschäftigt und seine Roulettes und Wählerspiele alle getrimmt sind!« schrie Clancy. Die Wut packte ihn jetzt. »Darum, du verdammter Narr! Ich merkte, was los war, obgleich ich zu Anfang von den widerlichen Tricks nicht viel verstand. Hatte mich vorher nie für Karten interessiert. Aber gemerkt habe ich es schließlich doch. Darum sind sie hinter mir hergewesen, weil ich zuviel wußte. Ich habe keinen Cent genommen. Nicht einen mehr, als mir zustand.«
»Da hast du Pech«, kam die Antwort von oben. »Clancy, du kennst Biddells. Du weißt, daß er Aufpasser bei Horgany ist. Ich hatte den Verdacht, daß das nackte Spielhöllen waren und ließ Biddells die Saloons von Roggers überprüfen. Kein Falschspiel, keine getrimmten Roulettes, alles in Ordnung!
Und nun sag schon, warum du weggegangen bist, na?«
Es war wieder, als steckte Clancy in einer Gongschale. In diesem Augenblick erkannte er, daß er verloren war. Ein nie zuvor gekanntes Gefühl der Ohnmacht überkam ihn. Roggers hatte etwas geahnt und die Spielhöllen in harmlose Spielsäle verwandeln lassen Es gab keinen Beweis mehr für Betrug. Was blieb, waren zweitausend angeblich verschwundene Dollar. Auch wenn man sie nicht bei ihm fand, hatte er nicht einen halben Tag mindestens Zeit gehabt, das Geld irgendwo zu verstecken?
Allmächtiger, dachte Clancy entsetzt, das ist es. Sie werden sagen, ich hätte Zeit genug gehabt, es zu verstecken.
In diesem Moment brach ihm der Schweiß aus allen Poren. Es war nicht die Wärme der Sonne, die ihm den Schweiß aus der Haut jagte – es war die nackte Angst«
»Ich war es nicht!« schrie Rod Clancy entsetzt. »Sheriff, ich habe nicht gestohlen, ich war’s nicht, Mann. Ich bin unschuldig, ich bin unschul...«
»Clancy! Clancy!«
Die Fäuste packten ihn, sie warfen ihn zurück. Jemand drückte ihn nach hinten, während irgendwo Schritte hallten und jemand fluchte.
»Was – was ist?« keuchte Clancy. »Wo – ah, du, du bist das, Floyd? Was war?«
»Du hast geschrien!« sagte der riesenhafte Schatten vor ihm ächzend und hielt immer noch seine Oberarme umklammert. »Da, sie kommen schon! Warum hast du denn wieder geschrien, Clancy?«
»Ich, ich hab’s doch nicht getan«, stammelte Clancy. »Floyd, ich war’s doch gar nicht.«
»Verflucht noch mal, wer schreit denn da wie ein Irrer?« brüllte jemand im Gang. Dann fiel das grelle Licht der Blendlaterne in die Zelle. Die Stäbe des Gitters zeichneten sich wie drohende Finger an der getünchten kahlen Wand ab. »Clancy wieder mal, was? Du Hundesohn, ich komm rein und hau dir die Knochen in Stücke! Was hast du hier zu brüllen, du Saukerl?«
»Nichts, Mr. Kinsey«, antwortete Clancy gepreßt und stand auf. Auch Floyd stand jetzt in der schmalen Zwei-Mann-Zelle, die Hände wie bei der Armee an der Hosennaht. »Tut mir leid, Mr. Kinsey. Ich – ich muß geträumt haben.«
»So – geträumt, was? Du träumst verdammt oft, du Hundesohn!« gurgelte Kinsey und leuchtete ihm mitten ins Gesicht. »Ach, der arme, unschuldige Revolverschießer, dieser Zweitausend-Dollar-Dieb, der Killer vom Dienst. Der träumt, das Unschuldslamm träumt wieder mal, was? Du arbeitest nicht genug, he? Yeah, das ist es wohl. Du bist nicht müde genug, damit du richtig pennst und deine anderen Räuber- und Mördergesellen nachts in Ruhe läßt? Dir werde ich es morgen besorgen! Du schuftest morgen für drei, klar? Wollen doch mal sehen, ob du dann nachts dein gottverfluchtes Maul hältst, du Mörder! Die Knochen sollen dir knacken, dann wirst du filzen wie ’ne dreckige Ratte, die du bist, verstanden? Ob du verstanden hast, du Beutelratte?«
»Yes, Sir, verstanden!« sagte Clancy leise. »Verstanden, Sir.«
Kinsey starrte ihn an, blendete ihn voll mit dem Kegel der Blendlaterne, dieser Kinsey, der gemeinste Aufseher der Außenstation des Staatsgefängnisses von Idaho, verrufen und gefürchtet wegen seiner Brutalität bei allen neunzehn Mann, die hier arbeiteten.
»Du Drecksack, huste bloß einmal, fang noch mal an zu heulen, daß du unschuldig ins Jail gekommen bist, dann komm ich dich besuchen, verstanden?«
Er klopfte mit seinem Spezialstock gegen die Gitter. Der Stock war ein Bleirohr, das mit Leder umgeben war. Ein kräftiger Hieb damit genügte, um einen Mann zu töten.
»Verstanden, Sir.«
»Drecksack!«
Das sagte er zum Abschied. Dann ging er los, schlurfend wie ein Affe. Er sah auch wie ein Affe aus. Lange Arme, behaarte Hände, tiefliegende Augen und eine fliehende Stirn. Kinsey, das Urvieh, das Ungeheuer aus der Steinzeit.
Clancy sank auf die Pritsche. Er blieb sitzen, der Schweiß klebte an seinem Körper. Das Licht im Gang verlosch bis auf jene eine Lampe, die Dämmerlicht in ihn warf.
In diesem Zwielicht der Nacht bewegte sich Floyd Reegan, der Riese. Er war ein Brocken, ein gewaltiger Bursche, auch wenn er erst zweiundzwanzig Jahre alt war. Er war größer und breiter als alle anderen in der Außenstation von Richfield, Idaho.
Floyd legte sich wieder hin, und auch Clancy sank um. Sie konnten beide nicht einschlafen, jetzt kam der Schlaf nicht.
Dabei überfiel er sie jeden Abend wie ein Tier nach der verfluchten Arbeit im Lavagebiet. Dort brachen sie Lavabrocken heraus.
Lava riß die Haut auf, Lavastaub reizte die Lungen. Und doch mußte irgendwer Lava brechen. Schließlich brauchte man den Bimsstein zum Schleifen in der Industrie. Selbst Hausfrauen hatten den Stein in ihren Küchen. Und Arbeiter, die mit Teer umgingen, bekamen ohne Bimsstein ihre Hände nie sauber.
»Floyd«, flüsterte Clancy. »Tut mir leid, Junge.«
»Is’ schon gut, Clancy«, wisperte Floyd zurück. »Uns glaubt keiner – mir nicht, dir nicht! Unschuldige in ’nem Jail gibt es nie, verstehst du? Ich hab’ einen totgeschlagen, yeah, ich bin ja so groß, ich brauch nur mit der Faust zuzuhauen, dann fällt einer mit eingeschlagenem Schädel um, was?
Ich hab’ ihn nicht totgeschlagen, Clancy, bestimmt nicht, Clancy!«
»Sei ruhig, ich glaube dir doch«, murmelte Clancy tröstend. »Ich weiß, daß du keinen tothauen kannst. Schlaf mal wieder, Junge.«
Reegan schwieg, er seufzte nur einmal.
Armer Teufel, dachte Clancy, du bist noch ärmer dran als ich, Junge. Sieben Jahre haben sie ihm gegeben, mir wenigstens nur vier, aber – die sitz ich nicht ab, ich nicht, niemals! Der geht im Jail noch vor die Hunde, der Junge, der schafft das hier nicht. Die kräftigsten Burschen haben sie in den Lavabruch geschickt. Also gut, ich bin kräftig, aber so stark wie Floyd bin ich nie. Der läßt einen an der ausgestreckten Hand verhungern. So gewaltig er ist, er ist noch ein Kind. Ein Riese mit wenig Verstand. Er denkt dauernd an seine alte Mutter und seine Schwester. Faßt einer seiner Freunde seine Schwester an und zerreißt ihr die Bluse, will was von ihr, was sie nicht will. Und er haut ihn zusammen. Hätte ich auch getan als Bruder, wenn ich ‘ne Schwester hätte.
Nachher finden sie den anderen Burschen mit eingeschlagenem Schädel. Könnte Floyd jemand mit der Faust den Schädel einschlagen? Sie fanden einen Stein neben dem Toten. Aber Floyd schwört, er hätte gar keinen Stein genommen. No, der lügt nicht, der braucht keinen Stein, um jemand umzuschlagen, der nie!
»Floyd...«
»Ja, Clancy?«
»Floyd, über Winter habe ich den frommen Mann gemacht und nie was versucht«, wisperte Clancy. »Floyd, jetzt ist Frühling. Ich will hier raus.«
Es war ganz still drüben. Dann knarrte die Pritsche leicht. Reegan kroch wie ein Tier, ein Riesenbär, über den Boden und setzte sich an Clancys Pritsche hin.
»Du, Clancy, das schafft keiner.«
»Vielleicht doch?«
»Mensch, Clancy, willste ehrlich weg? Warum hast du nie was davon gesagt, warum nicht?«
»Ich bin nicht sicher, ob ich es allein schaffen kann, Junge«, flüsterte Clancy. »Aber – wegkommen kann man, ich sag’s dir. Ist mein Ernst, kein Spaß, Junge.«
Er war ganz still, der große, breitschultrige Floyd Reegan, nur das Würgen saß ihm plötzlich im Hals. Er konnte minutenlang nichts sagen.
»Clancy, sie ketten uns doch an, die Schlösser bekommt man nicht auf«, würgte er endlich. »Und dann – die Hunde. Und die Wachen. Das haben schon mal zwei versucht.«
»Ich weiß, wie man entwischt, Junge. Man kann es nur mit ein paar Tricks erreichen, und man muß sich verstellen können. Kannst du dich verstellen, wenn es sein muß?«
»Weiß nicht, Clancy, aber hier lernt man das ja. Maul halten und grinsen, wenn man kocht. Vielleicht schaff ich das. Clancy, du und ich, aber ich weiß nicht wohin.«
»Ich weiß, wohin. Ich kenne jemand, der würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um mir zu helfen. Und dir sicher auch. Wenn wir erst ‘raus wären, kämen wir auch davon. Floyd, du müßtest alles tun, was ich sage und dich verstellen können wie noch nie in deinem Leben, dann schaffen wir es.«
»Hier kommt keiner ’raus. Die anderen beiden haben sie auch nach sieben Meilen gehabt, Clancy«, flüsterte Reegan. »Die hatten das Gitter ’raus, aber…«
»Nicht hier. Draußen auf der Arbeitsstelle.«
»Waaas? Unmöglich, das geht nie!«
»Doch, Junge, doch.«
»Angekettet – das geht nicht.«
»Ich sage dir, daß es geht.«
Reegan kauerte am kühlen Boden und stützte den Kopf in die Hände. Drei Zellen weiter lag Carpenter, ein Totschläger wie die meisten Männer hier. Carpenter kannte Clancy, er war erst im Winter hier eingeliefert worden und hatte Clancy in Idaho City gesehen. Als Carpenter hergekommen war, hatten die anderen auch bald gewußt, was Clancy für ein Mann war.
Du lieber Gott, dachte Reegan und spürte, wie sein Pulsschlag zu hämmern begann. Carpenter hat von Clancy erzählt und von diesem Porter. Clancy soll ein ganz gefährlicher Kerl gewesen sein, der beinahe drei Kopfgeldjäger in die Hölle jagte. Er soll ‘ne Menge Tricks kennen. Wenn ich hier ’rauskommen könnte, ich täte alles dafür, bloß ’raus aus dem Käfig.
»Clancy, du hast bestimmt nicht gestohlen?«
»No, Junge. Ich weiß, du denkst manchmal, ich hätte die zweitausend Dollar versteckt, was?«
»Ja, manchmal denke ich das, Clancy. Aber was machen wir ohne Geld?«
»Aah, daran hast du gedacht? Daß wir ohne Geld nicht durchkommen könnten? Floyd, ich hab’ das Geld nicht versteckt, ich hab’s nie genommen, ehrlich. Wir kommen so durch, Junge. Und wenn wir am Ziel sind, dann wirst du begreifen, daß ich es nie nötig gehabt hätte, zweitausend schäbige Dollar zu nehmen.«
»Aber keinen umbringen, das mach’ ich nicht, Clancy!«
So ist das, dachte Clancy, keinen umbringen. Da macht er nicht mit, der
Junge. Und der soll einen seiner Freunde erschlagen haben, der? Er will keinen umbringen müssen, und er wird es auch nicht tun. Ich auch nicht, wenn das klappt, was ich mir überlegt habe.
Vielleicht klappt es doch, was?
*
Clancy blickte einen Augenblick lang nach hinten. Die Balkenhütte lag unter ihnen in etwa achtzig Schritt Entfernung. Kinsey saß auf der Bank. Er machte Pause und rauchte wie jeden Vormittag gegen neun Uhr. An einem der Wagen lehnte Gould, ein anderer Aufseher. Auch er war weit genug entfernt.
Langsam nahm Clancy den Kopf wieder herum. Er hielt den Brechmeißel, ein gut meterlanges Ding, das sie zwischen die Lava gejagt hatten. Der Lavabruch lag in einem Kessel, umgeben von jenen bizarren Formen des toten Magmagesteins, das eine riesenhafte Mulde bildete. Sie arbeiteten alle an der nach Norden liegenden Wand auf einem Brettergestell. Seit Tagen waren sie in Zweiergruppen eingeteilt und brachen das Gestein in Platten aus der Wand. Das Bohlengestell befand sich mit der obersten Plattform gut acht Schritt über dem Boden. Die Leitern standen dicht nebeneinander, so daß sie mit zwei Mann, jeder auf einer Leiter, hochsteigen und herabklettern konnten. Ihre Armeestiefel, über denen sie die Hosenbeine aufgekrempelt trugen, zeigten jene typischen Spuren der Fußschellen. Selbst bei der Arbeit wurden sie angekettet. Immer zwei Mann an eine Kette. Jeder hatte eine Schelle um ein Bein. Taten sie etwas, gingen sie, rollten sie oder trugen sie einen Brocken Lava, mußten sie mit den angeketteten Beinen zugleich jeden Schritt machen.
Clancy stand links, sein rechtes Bein war angekettet. Reegan war rechts, sein linkes Bein wurde von der Schelle umschlossen. Die Schellen lagen so eng um das Leder des Stiefels, daß es unmöglich war, den Fuß aus dem Stiefel zu ziehen. Ein Blockschloß aus Stahl hielt die Schelle und die Kette zusammen.
Unter Clancy lagen gut neuneinhalb Schritt. Sie arbeiteten auf der obersten Plattform und nur wenig unter der Oberkante der Lava. Beide Posten, die auf der Oberkante in einiger Entfernung standen, konnten jede Einzelgruppe sehen und überwachen. Ihnen fiel die kleinste Bewegung, die nicht zur Arbeit gehörte, sofort auf.
Links neben Clancy arbeiteten zwei andere Sträflinge, sie waren keine drei Schritt entfernt.
»Ssst!« zischte Clancy. »Paß auf, nimm die Spitzhacke. Und dann...«
Er wechselte einen kurzen Blick mit Floyd. Einen Moment fürchtete sich Clancy vor dem, was jetzt kommen mußte. Wenn sich Floyd nicht beherrschen konnte oder irgendeine Spur von Unruhe zeigte, war alles vorbei.
Floyd sah ihn jedoch kalt und gelassen an. Ihm war nichts anzumerken, als er den letzten Schlag mit dem schweren Hammer tat. Danach legte er den Hammer auf die Bohle und griff zur Spitzhacke. In der Lava klaffte jener zackige kleine Riß, der sich beim ersten Platzen des Gesteins immer zeigte.
»Ich wußte«, sagte Clancy laut. »Schlag genau in den Riß, dann bricht die Platte aus. Vorsicht, da unten!«
Vier Mann waren unter dem Gestell. Sie sammelten die herabfallenden Brocken auf und brachten sie weg. Als Clancy seine Warnung rief, traten sie einen Schritt zurück.
Im nächsten Moment schlug Floyd mit aller Gewalt zu. Die breite Schneide der Spitzhacke fuhr knirschend in den Riß hinein. Und dann fraß sie sich fest.
Es war genau das, was Clancy geplant hatte. Floyd hatte mit derartiger Gewalt zugeschlagen, daß sich die Scheide festkeilen mußte. Der Riß verbreiterte sich etwas, aber die Platte brach nicht aus. Auch das hatte Clancy sich ausgerechnet.
»Hölle!« knurrte Floyd, scheinbar verstört. »Die Hacke sitzt fest, Clancy. Mann, ich zieh mal.«
Er bückte sich, stemmte die Arme unter den Hackenstiel und krümmte den Rücken. Sein breiter Rücken, nur von einem alten Armeehemd bedeckt, zeigte bereits einige Schweißflecken.
Es war nur ein Ruck, mit dem Reegans Oberkörper in die Höhe zuckte. Im nächsten Moment knackte es häßlich. Der glattgewachsene, langadrige Stiel der Hacke brach genau hinter dem Hackenmaul ab.
Floyd schoß mit dem Ruck nach vorn.
Er blieb nach einem heiseren Schreckenslaut mit der Brust über der Lavakante liegen, aber er hatte den Stiel in der Faust.
»He, was habt ihr denn?« knurrte Gates, der eine Posten, mürrisch. »Schon wieder was zerbrochen? Mensch, Reegan, kannst du deine Kräfte nicht woanders lassen? Der Kerl zerbricht einfach alles!«
»Ich – ich konnte nichts dafür«, stotterte Floyd und stemmte sich hoch. »Tut mir mächtig leid, Mr. Gates. Das verdammte Ding! Wie konnte es abbrechen!«
Jetzt kam es, und Clancy beobachtete mit angehaltenem Atem, wie Floyd wütend mit dem dicken Stiel der Hacke ausholte. Dann sauste der Stiel herunter.
Er krachte mit der breiten Fläche, also quergehalten, auf die Vierkantspitze der Hacke. Der Stahl splitterte den Stiel haargenau in der Mitte auf, aber der Spalt führte nicht bis zum Stielende durch.
Nur ein klaffendes Stück, das Ähnlichkeit mit einer riesengroßen Wäscheklammer hatte, öffnete sich.
Oh, verflucht, dachte Clancy und atmete aus, der Junge kann zuschlagen – auf den Zentimeter genau.
»Du verdammter Idiot, jetzt hast du den Stiel ganz verdorben!« fluchte
Gates bissig. »Jetzt kann man nicht mal mehr einen Hammerstiel aus ihm machen. Wo du mit deinen Kräften hinlangst, du Totschläger, bricht alles entzwei, was? Perry, he – hol eine neue Hacke her! Dieser Gorilla hat eine zerschlagen!«
Perry, der einzige Mann, der sich allein bewegen konnte, dafür aber an den Händen gekettet war, ging unten los.
»Tut mir leid. Sir, ehrlich leid«, versicherte Floyd zerknirscht. »Ich wollt’ bestimmt nichts kaputtmachen, ehrlich nicht, Sir.«
»Los, ihr Narren, nehmt einen Keil und bringt die Hacke irgendwie raus!« fluchte Gates barsch. »Paß nächstens auf, du nachgemachter Mensch!«
Danach ging er zurück, während Floyd sich bückte und den Stiel neben sich auf die Bohle legte. Im Aufrichten griff er nach dem schweren Hammer und einem anderen Keil. Sein kurzer Blick traf Clancy. In Floyds braunen Augen stand ein Funkeln.
Der erste Teil von Clancys Plan war erfüllt. Er hatte jetzt eine überdimensionale Wäscheklammer.
Hinter der Blockhütte unten lagen mehrere zerbrochene Stiele, aber keiner war so gesplittert wie dieser hier. Andere waren wegen der Schrägmaserung wie Dolche abgebrochen. Einige hatten einen kurzen, schrägen Bruch, der handlange Splitter abgefetzt hatte. Einen dieser Splitter hatte Clancy bereits gestern beiseitegeschafft. Außerdem besaß er Hosenriemen.
Diese drei Dinge brauchte er, um sich das zu besorgen, was die nächste Stufe des Planes bedeutete. Eine riesengroße Wäscheklammer, ein Hosenriemen und ein handlanges Splitterstück von einem anderen Stiel.
Niemand hätte hinter diesen drei Dingen den Beginn eines Fluchtversuches vermuten können. Und doch, er war es!
*
Kinseys dunkle Augen hefteten sich auf den zusammengekrümmt auf einem Lavabrocken kauernden Clancy. Auch Beecham, der Küchenfahrer, der ihnen jeden Tag das Essen herausbrachte, glotzte zu Clancy herüber.
Clancy würgte so laut, daß es auffallen mußte.
»Was hast du denn, he?« fragte Kinsey schmatzend.
Es gab Suppe mit Schaffleisch. Aber während die Sträflinge die dünne Brühe erhalten hatten, löffelten die vier Posten das Dicke.
»Mir is’ schlecht«, brachte Clancy mühsam heraus und würgte stöhnend.
Er stellte den Blechtopf zur Seite. Neben ihm saß Quinton, ein dicker, großer Mann, Sträfling wie die anderen. Clancy sackte noch mehr zusammen. Beide Hände auf den Bauch gepreßt, schien er nach vorn kippen zu wollen.
»Ich – ich glaube, ich muß mal!« ächzte er.
»Was ist?« brummte Gates, in dessen Gruppe sie arbeiteten. »Mensch, kann man nicht mal in Ruhe essen?«
»Laß ihn sich doch die Hose vollmachen«, brüllte Kinsey und lachte tosend los. »Stell dir vor, wenn er so arbeiten muß, hähähähä!«
Sie lachten nun alle. Nur Gates fluchte, stand auf, als Clancy stöhnte und kam zu ihm. Er brachte seinen Fußschellenschlüssel mit.
»Los, steh auf, Mensch!« sagte er barsch. »Geh schon, Mann.«
»Tut mir leid, mächtig leid, Sir«, ächzte Clancy. »Mir ist so schlecht... Die Schmierwurst gestern...«
Er stand auf, hob das Bein an, und Gates schloß ihn los. Kinsey beobachtete ihn mit halbgeschlossenen Lidern. Die Latrine, ein Bretterhäuschen, war hinter der Hütte. Die Wächter saßen vor der Hütte auf der Bank, und dort stand auch Gates’ Eßnapf.
»He, Gates«, knurrte Kinsey scharf. »Geh mit!«
Gates holte fluchend seinen Eßnapf, nahm sein Gewehr und folgte Clancy, der schon das Bretterhäuschen erreicht hatte. Clancy setzte sich stöhnend auf die Brille. Er hatte die Tür halb geöffnet, und er konnte Gates beobachten. Gates hockte sich mit dem Gewehr zwischen den Knien auf ein paar Lavahöcker.Von den übrigen Sträflingen war nichts zu sehen.
Verdammte Geschichte, fuhr es Clancy durch den Kopf. Das geht nicht gut. Gates sitzt hart links neben der Ecke der Hütte. Wenn er doch zwei Schritt machen würde, dann könnte er mich nicht mehr sehen. Floyd muß anfangen. Oder verpatzt uns auch Quinton das Spiel?
Floyd Reegan hockte mit gesenktem Kopf auf dem Lavavorsprung. Wenn er auch in seinen Napf zu blicken schien, so schielte er doch zu dem von Clancy abgestellten Topf hinüber.
Einen Moment begann der große blonde Floyd Reegan zu frieren. Es war unheimlich, wie genau bisher Clancys Vorhersagen eingetroffen waren. Niemand hatte etwas hinter dem Zerbrechen des Hackenstiels vermutet. Keiner sich etwas dabei gedacht, als Floyd mit einem geschickten Wurf den gesplitterten Stiel zu dem Haufen der anderen Stiele geschleudert hatte, nachdem sie die Mittagspause begonnen hatten.
Und jetzt war die Hand da, Quintons klobige Faust stahl sich zu Clancys Eßtopf. Sie erreichte ihn, packte ihn blitzschnell und zog ihn weg.
Quinton, der ungeheure Vielfraß, hatte tatsächlich Clancys Essen geklaut und löffelte sofort schmatzend und voller Hast weiter.
Floyd hob langsam den Kopf. Der Topf stand schon wieder am alten Platz, und Quinton, dieser Vielfraß, tat so, als hätte er ihn nie in der Hand gehabt.
»Quinton, du Drecksack!« schrie Floyd jäh los, so daß sämtliche Wächter erschrocken zusammenfuhren. »Du Hundesohn, du verkommener, du hast ja Clancys Fressen gestohlen! Ah, du Satansbraten, kippst du es sofort zurück?«
Quinton löffelte wie ein Schaufelbagger, brummte nur und tat gar nichts.
»Du sollst es zurückschütten, du verfressenes Ungeheuer!« brüllte Floyd los. »Das ist Clancys Essen, du Mißgeburt. Hölle und Verdammnis, der Saukerl frißt weiter wie ein Schaufelbagger, der denkt nicht… Dir werde ich!«
Floyd warf sich, daß die Kette klirrte, mit einem Wutschrei auf Quinton. Seine Faust schlug unter den Eßtopf Quintons. Die Suppe schwappte hoch empor. Sie klatschte dem losheulenden Quinton mitten ins Gesicht. Der Topfrand knallte Quinton auf die Nase, und er fiel schreiend hintenüber.
»Ich bring dich um, du Mißgeburt!« brüllte Floyd voller Grimm. »Bestiehlt seine Partner, dieser Vielfraß, dieser widerliche Fettkloß! Dir werde ich die Zähne einschlagen, du Stinktier!«
Er packte Quinton am Hals. Quinton quiekte wie ein fettes Schwein beim Transport auf das Schlachtgestell. Dann kippte er hintenüber, und Floyd wälzte sich über ihn, mit einer Hand seine Kehle packend und mit der anderen auf ihn einschlagend.
»Gates, Mensch!« schrie Kinsey wütend. Er sprang auf und starrte auf die beiden am Boden liegenden Sträflinge. »Gates, machst du bald was?«
Gates rannte schon los. Es war seine Aufgabe, für Ruhe zu sorgen.
Im gleichen Moment riß Clancy den Riemen aus den Schlaufen der Armeehose. Er stieß die Tür ganz auf, machte einen langen Sprung und flog auf die Rückfront der Hütte zu. Noch im Laufen bückte er sich nach dem gesplitterten Stiel. Dann erreichte er den an der Hütte liegenden kleinen Holzkeil. Seine Hand fuhr unter das schäbige Arbeitshemd. Dort steckte eines jener fetten Fleischstücke. Er hatte es in den Mund genommen, als er zu essen begonnen hatte. Danach hatte er es, sich zum Mund fassend, in die hohle Hand gespuckt und bei dem nächsten Griff an den Magen unter das Hemd geschoben. Noch im Laufen riß Clancy den Splitterkeil hoch. Er schob ihn drei, viermal durch das fette Schafsfleisch. Danach steckte er das Fleisch in die Hosentasche.
All das geschah im Verlauf von kaum sieben Sekunden. In der zehnten Sekunde stand Clancy genau neben dem rückwärtigen vergitterten und winzigen Fenster der Hütte. Er hörte Gates’ Flüche und Floyds tobsüchtiges Gebrüll.
Mit einem Zucken jagte Clancy den Splitterkeil durch die Verschlußöse seines Hosenriemens. Danach nahm er den Hackenstiel hoch. Er preßte ihn mit Gewalt in den Spalt hinein. Dieser öffnete sich wie ein Fischmaul, wie eine große Wäscheklammer. Nun führte Clancy den Hosenriemen nach hinten. Er beugte sich vorwärts, seine Hände stießen den Hackenstiel durch das winzige Gitterfenster.
Unter dem Fenster, aber so weit entfernt, daß kein Mensch sie jemals mit einem Arm erreicht hätte, steckten die kurzen, scharfgeschliffenen Stahlkeile zwischen zwei Leisten über dem Werkzeugtisch.
Clancy achtete jetzt nicht mehr auf Kinsey. Seine ganze Aufmerksamkeit konzentrierte sich nur auf einen der flachgeschmiedeten Keile. Der Schaft des Keils war rund. Als Clancy die riesenhafte Wäscheklammer vorwärtsschob, glitten ihre Schenkel mit Leichtigkeit am runden Schaft des einen Keiles vorbei. Den Stiel nun mit aller Kraft festhaltend, zog Clancy an seinem Hosenriemen. Der Riemen spannte sich. Der eingefettete Keil bog sich nach hinten. Und dann schnellte der Keil aus dem Spalt. Die großeWäscheklammer schloß sich, die beiden Schenkel legten sich wie die Backen eines Schraubstockes mit leichtem Druck um die Rundung des Stahlkeilschaftes.
Jetzt erst hob er den Kopf.
»Hau ihm das Gewehr an den Schädel!« schrie Kinsey heulend vor der Hütte. »Gates, hau ihn um, der würgt Quinton noch ab, der Bulle!«
Im gleichen Moment zog Clancy behutsam beide Hände hoch. Der Stiel schwang nach oben. In seinem Spalt steckte der Keil, er wanderte auf das Gitter zu, Clancy packte ihn und bog ihn etwas um. Eine Sekunde später hielt Clancy den Keil in der Faust. Er duckte sich blitzschnell, dann riß er den Keil aus dem Spielspalt und legte den Stiel zu den anderen.
Clancy flog in fünf wilden Sätzen auf die Latrine zurück. Seine Pulse hämmerten, sein Atem ging jetzt wirklich keuchend. Der kleine Holzsplitter flog durch die Brille nach unten. Noch hatte sich Clancy nicht gesetzt. Den Arm durch die Brille steckend, tastete er über die Vorderkante des Sitzgestelles. Dort war ein Vierkantbalken, an den die Bretter angeschlagen worden waren.
Den Stahlkeil jetzt auch durch die Brille bringend, stieß Clancy ihn mit aller Macht zwischen Bretter und Vierkantholz. Der Keil saß so fest, daß ihn keine Erschütterung aus seiner Lage bringen und in die Tiefe fallen lassen konnte.
Einen Augenblick später zog Clancy den Hosenriemen wieder durch die Schlaufen. Er saß nun, krümmte sich zusammen und hörte nur noch Gates wildes Gefluche.
»Was ist denn los?« schrie Clancy. »Floyd, laß den fetten Molch doch fressen, bis er platzt. Oh, ist mir schlecht – nur kein Essen mehr – mir ist so elend...«
Gates kam jetzt zurück, warf ihm einen finsteren Blick zu und knurrte:
»Nichts als Ärger hat man mit euch Unschuldsvögeln! Bist du bald fertig?«
»Gleich«, versicherte Clancy stöhnend. »Mr. Gates, es tut mir leid. Ich glaube, ich bin krank.«
»Krank oder nicht. Du hast zu arbeiten, Kerl!«
Yeah, dachte Clancy spöttisch, und wie ich gearbeitet habe, Mister. Ihr werdet euch noch wundern!
Sie sollten sich wundern – ehe noch der Abend kam!
*
Kinseys brüllender Schrei durchbrach das Poltern der in den Wagen krachenden Lavabrocken.
»Aufhören!« schrie Kinsey wild. Er kam von seinem bequemen Sitzplatz auf der Bank an der Hütte auf das Holzgestell zugestürmt. Clancy hatte die Katastrophe kommen sehen, als Kinsey in die Hütte gegangen war. Kinsey war nachdenklich wieder herausgekommen, hatte sich auf die Bank gehockt, war aber sofort erneut aufgestanden. Nach einem Blick in die Hütte rannte er nun auf sie zu.
»Schluß da oben!« brüllte Kinsey grimmig. »Alles aufhören und runterkommen. Los, runter, ihr Hundesöhne! Gates – Gould, auch runterkommen treibt diese Halunken vom Gestell. Los, runter mit diesen verschlagenen Banditen!«
»He, was ist los?« fragte Gould erschrocken. »Kinsey, ist was passiert?«
Kinsey schwieg, er wartete, bis alle neunzehn Mann in einer Reihe vor ihm standen. Der stiernackige Mann mit den langen Armen und der fliehenden Stirn wippte auf den Stiefelspitzen.
»So, da steht ihr jetzt«, begann er drohend. »Gould, geh los, geh in die Hütte und zähle mal die Keile nach! Los, Mensch, hau ab und zähl die geschliffenen Stahlkeile!«
Kinseys lauernder Blick flog über die Sträflinge, jeden Mann sah er an. Clancy stand genauso reglos da wie alle anderen. Floyd hatte gerade noch rechtzeitig erfahren, was passieren mußte, und auch Floyd war vorbereitet.
»Na?« lauerte Kinsey. »Nichts zu sagen, keiner was zu sagen, he?«
»Nein?« schrie Kinsey voller Wut. »Na, Gould, wieviel Keile?«
»Hol mich der Teufel«, schnaufte Gould. Er war für das Material verantwortlich. Es wurde am Morgen und am Abend gezählt, um das Verschwinden irgendeines Hammers, Meißels oder sonst eines Gegenstandes, mit dem sich jemand vielleicht befreien konnte, sofort festzustellen. »Verdammt, ich habe zweimal gezählt! Ein Keil fehlt!«
»Ein Keil fehlt, wie?« fragte Kinsey und trat langsam auf den alten Perry zu. »Perry, Hundesohn, wo ist der Keil?«
Der alte Perry erbleichte. Sein Gesicht wurde so grau wie seine Haare.
»Ich weiß nicht«, stöhnte der Alte verstört. »Mr. Kinsey, ich weiß das nicht, bestimmt nicht, ich weiß nicht!«
»Kinsey, warte«, brummte Gould hastig. »Er kann ihn nicht genommen haben. Ich stand dabei, als er sie ausgab. Wir sollten erst die heute früh ausgegebenen Keile nachzählen. Wer hat einen bekommen?«
Die Sträflinge meldeten sich der Reihe nach. Gould stieg auf das Gestell, zählte nach und kam auf acht Keile und keinen mehr
»Fehlt immer noch einer!« brüllte Kinsey, er zitterte vor Wut am ganzen Leib. »Wo ist der Keil, verflucht?«
Sie blickten sich an, alle erschrocken und verstört. Keiner meldete sich.
»Das war doch dieser alte Hundesohn Perry!« schrie Kinsey wild. »Perry, du hast ihn gestohlen, gib es zu!«
»No, no, ich war’s nicht, ich hab’ keinen nehmen können!« stöhnte der Alte. »Mr. Gould...«
»Er konnte weder einen nehmen, noch hätte sich einer der anderen einen stehlen können!« knurrte Gould verwirrt. »Kinsey, ich sah ihm genau auf die Fmger, und ich stand vor der Werkzeugbank. Keiner konnte an sie heran, Kinsey!«
»Und wie ist der Stahlkeil verschwunden?« tobte Kinsey. Schaum sammelte sich in seinen Mundwinkeln, und es sah aus, als wollten ihm die Augen aus den Höhlen quellen. »Verflucht noch mal, der Keil ist weg, oder nicht? Liegt er vielleicht hinter der Bank?«
»Wie sollte er ’runtergefallen sein?« fragte Gould. »Ich sehe noch mal nach.«
Er rannte davon, und Clancy sah ihm mit dem gleichmütigsten Gesicht der Welt nach.
Sie konnten zwar nicht sehen, was Gould hinter der Hütte tat, aber Clancy hörte, daß Gould über die Stiele trampelte. Gleich darauf kam Gould zurück. Er sah verstört aus und schüttelte den Kopf.
»Das verstehe, wer will«, fluchte er. »Die Hölle – er ist nicht zu finden, Kinsey. Einen Moment dachte ich, jemand könnte durch das hintere Fenster geangelt und einen Keil erwischt haben aber so lang ist kein Arm. Alle vortreten, die einen Keil bekamen!«
Kinsey nahm sich jeden Mann vor. aber obgleich sie suchten und sogar unter dem Holzgestell die Lavabrocken umdrehten, der Keil fand sich nicht.
»Die Hölle, einer von euch hat einen Keil geklaut!« brüllte Kinsey. »Gould du kannst dich doch wohl nicht verzählt haben?«
»Jetzt bleibt es auf mir hängen, was?« schrie Gould wütend. »Es waren neunzehn und keiner weniger! Stimmt es, Percy?«
»Sie haben neunzehn gezählt, Mr. Gould!« bestätigte Percy.
»Und du hast einen geklaut!« brüllte ihn Kinsey an. »Du oder einer dieser Galgenvögel. Euch zeige ich noch, hier was zu versuchen. Also, ihr wollt nicht reden? Einer von euch verkommenen Strolchen hat den Keil gestohlen. Und da er sich nicht melden will – die Handschuhe ’runter – alle Mann!«
Wer die Lavabrocken schleppen mußte, bekam Fausthandschuhe aus dickem Rindleder. Die Dinger waren unförmig, schützten aber vor den scharfen Lavakanten. Insgesamt sechs Mann zogen jetzt ihre Handschuhe aus.
»So«, sagte Kinsey, seine Stimme wurde immer leiser und gemeiner. »Und jetzt wollen wir mal sehen, wer die längere Puste hat, ihr Saukerle. In einer Reihe los zum Wagen!«
Er holte mit dem Stiefel aus und trat Carpenter, dem ersten Mann der Reihe, voll ins Gesäß. Carpenter, der Totschläger, der in den Saloons von Idaho City mit einem Eisenstab gearbeitet und manchem Mann den Schädel gestreichelt hatte, taumelte und fiel hin. Er raffte sich, Kinsey wie ein wildes Tier anstierend, auf und hinkte los. Sie trotteten zum Wagen.
»Jetzt bildet ihr Schakale und Wüstenhunde einen Halbkreis um das Endbrett. Los, formiert euch, ihr Schweinetreiber!«
Er lachte hämisch, als sie sich in einem Halbkreis aufstellten. Carpenter stand an der linken Kastenwand des fast vollgepackten Transportwagens, der die Lavabrocken wegschaffte. An der rechten Kastenwand und dem Ende der Sträflingsreihe hatte der alte Perry seinen Platz.
Der Schweinehund, dachte Clancy und wechselte einen stummen, jedoch bedeutungsvollen Blick mit Floyd Reegan. Jetzt schleift er uns, aber wie will er das machen?
Im nächsten Moment wußte er es.
»Well, recht ordentlich, recht ordentlich, ihr Satansgeschöpfe!« knirschte Kinsey finster, Carpenter, du nachgemachter Mensch, jetzt greifst du auf den Wagen und nimmst einen Brocken herunter. Und dann wirfst du ihn deinem Nachbarn zu. Und so geht es weiter, bis ihn Perry, dieser alte Schurke, hat. Perry, du wirfst ihn auf den Wagen zurück, begriffen? Und so arbeitet ihr mal sauber und schnell – schnell, habt ihr gehört?«
Dieser Hundesohn, durchfuhr es Clancy, das ist der Höhepunkt seiner bisherigen Gemeinheiten. Die scharfen Kanten reißen uns die Haut in Fetzen, ehe wir eine Stunde das verdammte Spiel gemacht haben. Einen Stein vom Wagen, was? Und einen anderen wieder hinauf. So laden wir ewig ab und wieder auf. Das ist der Gipfel der Gemeinheit!
Er hatte eine Ahnung...
*
Perry keuchte, als ihm der schwere Brocken in die Arme flog. Der Alte wankte, taumelte, fand dann aber doch noch Halt.
Sie hatten jetzt eine knappe Stunde Kinseys verfluchtes Schinderspiel getrieben, und er war abwechselnd hinter sie getreten, um ihnen den Gewehrkolben in den Rücken zu donnern. Es gab niemanden mehr, dem das Blut nicht von den Händen tropfte. Mancher Lavabrocken sah wie angemalt aus, nur daß es keine Farbe war.
Der Brocken, den der alte Perry jetzt hielt, wog gut vierzig Pfund. Er war schroffkantig. Perry, der als letzter Mann jeden Brocken in die Höhe stemmen mußte, hatte den schwersten Teil der Schinderei erwischt.
»Kannst du nicht mehr?« erkundigte sich Kinsey höhnisch. »Hast du den Keil nun genommen, du Hundesohn?«
»No, ich – ich habe ihn nicht... Ich schwöre…«
»Du Lügenbeutel« fluchte Kinsey giftig. Sein Gewehrkolben pendelte, und als er ihn nach vorn schlug, landete die Kolbenkappe in der Kniekehle des alten Perry. Perry stand steifbeinig und mit durchgedrückten Knien am Wagen. Als ihn der Kolben traf, knickte er ein, stieß einen Schrei aus und brach zusammen. Der Brocken fiel aus seinen Händen. Er schlug zuerst gegen sein Knie. Dann fiel er das letzte Stück und landete auf Perrys linkem Fuß.
Im nächsten Augenblick schrie der alte Mann gellend auf. Er stieß den Brocken schreiend weg, umklammerte seinen Fuß und begann, sich auf dem Boden hin und her zu wälzen.
»Mensch, Kinsey!« keuchte Gould verstört. »Mann, sein Fuß!«
»Was denn?« fragte Kinsey hämisch und doch auch drohend. »Kann ich was dafür, wenn der Narr so ein leichtes Ding fallen läßt, he? Soll er besser beim Aufladen aufpassen. He, verflucht... Clancy, du Halunke!«
Er riß die Waffe hoch und richtete den Lauf blitzschnell auf Clancy. Clancy hatte den nächsten Lavabrocken gereicht bekommen. Als er sah, was dem alten Perry passierte, erstarrte Clancy für den Bruchteil einer Minute. Der wilde, grimmige Zorn, den er von seinem Vater geerbt hatte, schlug wie eine Flamme in ihm empor. Den Brocken anhebend, holte er aus. Aber ehe er ihn werfen und Kinsey den Brocken mitten ins Gesicht feuern konnte, zuckte Kinseys Gewehr hoch.
»Na, los, versuch es doch mal?« forderte ihn Kinsey mit glitzernden, mordlustigen Augen auf. »Wirf ihn, Clancy, wirf doch, du Feigling!«
Sie erstarrten alle. Gould schnappte nach Luft, trat dann aber keuchend zwischen Clancy und Kinsey.
»Mach keinen Unsinn, Kinsey!« zischte er. »Nicht schießen. Das gibt zuviel Ärger, Mann. Was wolltest du mit dem Brocken tun, Clancy?«
Clancy hatte sich bereits wieder in der Gewalt.
»Nichts«, sagte er bissig. »Gar nichts, Mr. Gould. Ich weiß gar nicht, was Mr. Kinsey gedacht haben kann.«
»Du verdammte Ratte!« fauchte Kinsey. Er schob Gould zur Seite und trat dicht vor Clancy. »Ich weiß, was du tun wolltest, du Mißgeburt. Und jeder andere hier weiß es auch. Wirf ihn auf den Wagen, los!«
Clancy gehorchte. Kaum war der Brocken polternd auf dem Wagen gelandet, als Kinsey ihm das Gewehr mit voller Wucht in den Bauch stieß. Clancy knickte ein, sein Mund öffnete sich, und er brach auf der Stelle zusammen. Einen Augenblick bekam er keine Luft mehr.
»Das nächste Mal blase ich dich um!« schwor Kinsey und zeigte sein Affengebiß. »Euch zeige ich noch, wer hier was zu sagen hat! Los, zieht dem alten Heuler da den Stiefel aus. Und du stehst auf, Clancy, hoch mit dir, sonst mache ich dir Beine! Das war ein Arbeitsunfall, kapiert? Er hat den Brocken auf seinen Fuß fallen lassen. Und wehe euch, einer redet jemals etwas anderes über die Sache. Hast du verstanden, Floyd, du Unschuldslamm?«
»Yeah, Mr. Kinsey«, würgte Floyd. Er war kreidebleich geworden und sah Kinsey nicht an. In dieser Minute hätte sich Floyd vergessen können. Er hatte noch nie jemanden getötet, aber er wußte jetzt, daß er einen Mann wie Kinsey kaltblütig mit dem nächsten Stein hätte erschlagen können.
Der Schurke, dachte Floyd, und der Stahlkeil fiel ihm ein. Zwei Mann müssen den Wagen immer bis zur Verladestelle am Snake River begleiten, um ihn dort abzuladen. Wenn Kinsey zufällig in acht oder zehn Tagen mit uns diese Fahrt macht, dann...
Es waren immer zwei Sträflinge, die mit zwei Wächtern hinfahren mußten.
Es waren immer verschiedene Wächter.
Darauf baute Clancy. Das gehörte zu seinem Plan. Niemals hatten die Wächter auf jenem Wagen die Schellenschlüssel. So war es ausgeschlossen, daß ein Sträfling weit kam. Niemand konnte mit einer Kette am Bein weit laufen. Er brauchte etwas, um die Kette abzuhacken, einen Stahlkeil. Und den hatten sie jetzt. Den Preis dafür aber hatte der alte Perry bezahlen müssen.
Man zog ihm jetzt den Stiefel herunter. Sein Fuß war schon geschwollen und blau unterlaufen. Vielleicht waren auch einige Zehen gebrochen.
Der Hundesohn, dachte Clancy, während er sich aufraffte und Floyd ihm unter die Arme griff, wenn doch O’Mallon hier gewesen wäre! Der hätte Kinseys Teufelei niemals zugelassen.
Henry O’Mallon war der oberste Aufseher des Jails. Er verwaltete die Außenstation und duldete keine Übergriffe der Wächter, solange er im Dienst war. Aber O’Mallon war nicht da – er hatte Urlaub. Dieser Mann war gerecht, aber unerbittlich, klug, listig und ein menschlicher Fährtenhund. Jeder Sträfling wußte – war O’Mallon einmal auf einer Fährte, gab er niemals auf. Dieser Mann hatte noch zwei Wochen Urlaub.
Sie mußten ausbrechen, ehe O’Mallon wiederkam.
*
Clancy wurde unwillkürlich blaß. Der Rippenstoß Floyds hatte ihn getroffen, und als er Floyds verzerrtes Gesicht und dessen Kopfbewegung sah, blickte er sich um.
Der Küchenwagen, den wie immer Beecham fuhr, rollte vor die Hütte. Neben Beecham saß jedoch noch ein Mann, der einen Ölumhang trug.
Es war Henry O’Mallon, der irische Oberaufseher.
Im Nieselregen, der seit gestern vom Himmel herabfiel, verschwamm der Eingang des Tales. Sämtliche Sträflinge waren bis auf die Haut naß, aber die Arbeit mußte weitergehen.
»Allmächtiger!« stieß Clancy leise hervor. »Floyd, O’Mallon! Wir sind dran, Junge, heute sind wir dran – und er kommt eine ganze Woche zu früh zurück. Dabei haben wir Regenwetter. Kein günstigerer Tag hätte es sein können.«
»Aus... Alles aus«, würgte Floyd entsetzt. »Clancy...«
»Reiß dich zusammen!«
Das war alles, was Clancy noch flüstern konnte.
Dann ertönte der schrille Mittagspfiff, und sie kletterten von den leicht glitschigen Bohlen des Gestells herunter. Die Ketten rasselten und klirrten, als sie an den Wagen traten, unter dessen Plane der Essenkessel stand. O’Mallon, er war nicht groß, aber breit und stämmig, blieb an der Hütte stehen.
Clancy hatte sich wieder gefangen. Sein Blick zuckte zu Kinsey hinüber. Der Aufseher kam langsam und mit einem Grinsen auf dem Affengesicht zur Hütte.
»Hallo, O’Mallon, schon wieder zurück?« erkundigte er sich. »Zuviel Regen auf Ihren Feldern?«
»Vielleicht«, erwiderte O’Mallon düster. Er hatte eine tiefe, rauhe Stimme und blickte zu den anderen drei Posten, die nun auch herankamen.
»Gates, was war hier vorige Woche los, he?«
Es hieß, daß O’Mallon Kinsey nicht leiden konnte. Deshalb sprach er jetzt Gates an, der noch der ruhigste aller Wächter war.
»Ich weiß nicht, Mr. O’Mallon«, antwortete Gates achselzuckend. »Was soll denn los gewesen sein, Sir?«
Der Oberaufseher schob plötzlich seinen schweren, massigen Kopf vor und starrte Gates durchbohrend an.
»Gates, ich habe was gefragt und erwarte eine anständige Antwort!« knurrte O’Mallon scharf. »Was war mit dem alten Perry?«
»Nichts. Ein Unglücksfall, Sir«, stotterte Gates erschrocken. »Er hatte Pech, Sir.«
»So, Pech?« zischte O’Mallon leise. »Es ist doch verdammt seltsam, wie schnell Gerüchte von hier zum Statejail und von dort wiederum zu mir dringen. Gerüchte, die unseren Boß veranlaßt haben, mich herzuschicken. Nun gut, ich mache die letzte Woche Urlaub später. Gates, wie war das mit dem verschwundenen Keil?«
»Es ist keiner verschwunden gewesen. Es war ein Irrtum«, meldete sich Gould hastig. »Ich hatte mich verzählt, Sir.«
»Und wer hat die Männer diese idiotischen Auf- und Abladerei tun lassen?« flüsterte O’Mallon drohend.
Er fuhr jäh herum und sah nun Kinsey an, dessen Gesicht erstarrt war.
»Mr. O’Mallon, ich... Es war ein Unfall, bestimmt. Strafe mußte sein, aber konnte einer ahnen, daß der Alte den Brocken fallen lassen würde?«
»Fallen lassen?« knirschte O’Mallon. »Es war also ein Unfall? Es waren ja auch nur zwei Zehen, die es dem alten Perry kostete, was? Kinsey, passen Sie auf, Mann, wenn so was noch mal passiert, dann ist einige Unruhe irgendwo, und danach fliegt jemand, verstanden? Es war also ein Unfall?«
»Sicher, Sir«, erwiderte Kinsey hastig. »Nur ein Unfall.«
O’Mallon schien das breite Grinsen Kinseys so zu reizen, daß er plötzlich losfluchte und sich umdrehte. Mit wenigen Schritten war er bei den auf den nassen Steinen kauernden Sträflingen und trat vor den ersten Mann.
»Hingman, was ist passiert?«
»Es – war ein Unfall«, antwortete Hingman gepreßt.
»Carpenter!«
»Sir, es war so!«
»War es so?« knirschte O’Mallon. Er rannte plötzlich die ganze Reihe entlang und schrie jedem zweiten Mann ins Gesicht: »Es war ein Unfall, was? Ich werde euch sagen, was es war. Der Alte hätte das Bein verlieren können! Was es dann gewesen wäre, brauche ich euch Halunken wohl nicht zu sagen, was? Ah, dir auch nicht... Clancy, ich rede mit dir!«
Clancy senkte den Löffel und sah hoch. Dann stand er langsam auf.
»Clancy, war es ein Unfall?«
Clancy wendete langsam den Kopf. Er sah zu Kinsey hinüber, der ihn drohend anstarrte.
»Sehen Sie mal, Mr. O’Mallon«, sagte Clancy dann träge. »Nun sehen Sie mal, wie mich Kinsey ansieht.«
O’Mallons Kopf flog herum. Er kniff die Lider zusammen und sah genau, daß Kinsey sich vergeblich bemühte, wieder schnell zu grinsen.
»Kinsey, was sehen Sie Clancy so an?« schrie O’Mallon grimmig. »He, Sie – was bedeutet dieser Blick?«
»Nicht viel, er will mir nur Angst machen«, murmelte Clancy eiskalt. »Er denkt, ich rede vielleicht Dinge, die nicht wahr sind – sie sind doch nicht wahr, wie, Kinsey?«
Kein Löffel klapperte mehr am Blech der Freßtöpfe. Es war totenstill geworden.
»Clancy, werde nicht frech!« stieß Kinsey heraus. »Ich sage dir...«
»Was?« fragte Clancy eisig. »Daß mir was passiert, wenn ich rede? Es war kein Unfall, Mr. O’Mallon. Er hat dem alten Perry den Gewehrkolben in die Kniekehle geschlagen. Perry mußte umfallen, weil er steifbeinig dastand und sich unmöglich halten konnte. Das ist alles, Mr. O’Mallon.«
Kinsey wurde leichenblaß. Gould und Gates sahen entsetzt zu Clancy.
Die Sträflinge duckten sich unwillkürlich.
Clancy aber setzte sich ganz ruhig wieder hin und nahm seinen Topf zwischen die Knie.
O’Mallon stand einige Sekunden reglos im Schweigen der Männer vor Clancy.
»Danke, Clancy«, sagte er dann dünn. »Kinsey, kommen Sie mit!«
Kinsey drehte sich um. Er folgte O’Mallon in die Hütte, deren Tür
O’Mallon hinter ihm schloß.
»Dafür bringt er dich um«, flüsterte Floyd entsetzt, als das Geklapper der Löffel wieder einsetzte. »Clancy, was hast du gemacht? Das vergißt der Schuft dir nie.«
Clancy sah ihn an und lächelte sanft.
»No«, wisperte er. »Der wird es versuchen, aber er schafft es nicht. Wetten, daß er den letzten Wagen heute abend fährt?«
Allmächtiger, dachte Floyd bestürzt, Clancy hat recht – Kinsey fährt den Wagen. Und dabei denkt er sich eine Schurkerei aus, um sich an Clancy zu rächen. Wenn wir ihm dann an den Hals gehen, haben wir einen Grund gehabt, uns zu wehren und danach zu fliehen.
Aber diesmal stimmte Clancys Rechnung nicht!
*
Der Wagen war längst fort und mit ihm O’Mallon, nach dessen halbstündigem Gespräch in der Hütte Kinsey bleich herausgekommen war.
Jetzt näherte sich Gates Clancy und Floyd. Er blieb neben ihnen stehen, blickte Clancy an und murmelte:
»Jemand hat gesagt, du solltest nicht geschunden werden. Ich mach’ dich jetzt los, Clancy. Du kannst das Gestell um eine Bohlenlänge weiterbauen. Aber bilde dir nicht ein, daß Kinsey dir das jemals vergißt, Mann!«
Clancy antwortete nicht, er nickte nur stumm und sah zum Rand empor. Dort, hoch oben über dem Gestell und auf der Wand aus Lava, stand Kinsey.
Er wird sich rächen, dachte Clancy. Die letzte Fuhre heute, da versucht er es.
Gates bückte sich. Er schloß Clancy los. Die Kette blieb an Floyds Schelle hängen, und Clancy ging davon.
Manchmal, wenn Clancy hochsah, war Kinsey verschwunden. Aber er kam im Verlauf der guten halben Stunde, die Clancy brauchte, um das Schrägkreuz des Bohlengestells zusammenzunageln und vier Schritt weiterzurücken, immer wieder an den Rand. Das Gerüst wuchs. Clancy brachte die Querverstrebungen an. Danach kamen die einzelnen Bohlenlagen an die Reihe. Das Gerüst hatte zwei Bühnen, eine in etwa drei Schritt Höhe, die nächste Bühne auf der vollen Höhe von acht Schritt.
Diese letzte Bühnenbohle hob Clancy gerade ein, als er den Blick Kinseys wieder im Rücken spürte. Clancy, die feuchte, glitschige Bohle über der Schulter, hob langsam den Kopf. Kinsey trat hart an die Kante. Dann stieg er auf die alte Bühne herunter. Er blickte von dort aus dem die Leiter hochsteigenden Clancy entgegen. Clancy stemmte die Bohle hoch, legte sie auf die Querstreben und schwang sich auf sie. Er mußte nach rechts zur anderen Seite gehen und die Bohle festnageln. Vorsichtig schritt er über die schwankende, noch nicht festliegende Bohle. Er war genau in der Mitte, als er ein Scharren hörte.
Im nächsten Moment wendete er sich um.
Der schwere Hammer, mit dem die Keile in das Lavagestein getrieben wurden, lag auf der alten Bühne. Und dann sah Clancy es, aber es war bereits zu spät.
Kinsey hielt den Hammer in beiden Fäusten.
»Schieb die Bohle nächstens genau in die Mitte«, sagte Kinsey. Seine Stimme klang völlig ruhig und ermahnend. Aber seine Augen funkelten wie die eines wildenWolfes, als er mit dem Hammer ausholte. »In die Mitte. Clancy, was?«
In derselben Sekunde schlug er zu.
Die schwere Bohle, auf jenen des alten Gerüstes liegend, bekam einen wilden Schlag von der Seite auf das Hirnholz. Glitschig wie sie war, rutschte sie mit ihrem Ende von den alten, feuchten und schmierigen Bohlen hinunter und fiel in die Tiefe.
Mit einem Schrei warf Clancy sich im letzten Augenblick nach rechts. Jetzt erst erkannte er, mit welcher teuflischen Absicht Kinsey Gates befohlen hatte, Clancy das Gestell verlängern zu lassen. Kinsey hatte sich etwas einfallen lassen, um Clancy zu töten. Diesmal konnte es wie ein Unfall aussehen.
Clancy schaffte es, sich zu drehen, während die schwere Bohle polternd unter seinen Füßen nach unten wegsauste. Binnen einer Sekunde warf sich Clancy gegen die schroffe, rauhe Lavawand. Seine Hände krallten sich in das Gestein, seine Knie schlugen hart gegen die Lava, und seine Stiefel schrammten über die Wand, ohne jedoch einen Halt zu finden.
Unter Clancy war nichts mehr. Der freie Fallraum von fünf Schritten lag jetzt zwischen Clancys Beinen und der unteren Bühnenbohle. Diese Bohle aber befand sich einen Schritt von der steilen Wand entfernt.
Selbst wenn es Clancy gelang, sich abzustoßen und nach unten zu springen, er mußte auf der glitschigen Bohle abgleiten und die vollen acht Schritt auf die zackigen, schroffen Lavabrokken stürzen.
»Clancy!« hörte er Floyd schreien. »Eine Leiter, schnell, die Leiter an die Wand. Er kann sich nicht halten, er stürzt ab!«
Sie rannten jetzt mit drei Mann zur Leiter. Aber ehe sie die Leiter erreichten, sprang Kinsey mit einem Satz von der Bühne herunter.
»Verdammt noch mal!« schrie Kinsey scheinbar erschrocken. »Mann, wie hast du denn die Bohle aufgelegt gehabt? Warte, ich helfe dir!«
Clancy spürte, wie seine Haut an den Fingern an den scharfen Kanten aufriß. Seine Finger hielten den Körper noch, glitten aber langsam ab.
Unter ihm erreichten sie die Leiter, vor ihm aber tauchte nun Kinsey auf. Kinsey stürmte heran, er hockte sich hin, nahm den linken Stiefel hoch und stellte ihn auf Clancys rechte Hand. Der Druck der Sohle quetschte Clancy die Finger. Aufschreiend vor Schmerz sah er das höhnische, fratzenhaft verzerrte Gesicht Kinseys über sich.
»Halt still!« brüllte Kinsey, als wollte er ihm tatsächlich helfen. »Ganz ruhig, ich ziehe dich herauf, ich halte dich fest, Clancy. Verdammtes Pech!«
Kinseys Hände schossen vorwärts. Sie griffen nach Clancys linkem Unterarm.
In dieser Sekunde begriff Clancy, daß er verloren war. Kinsey würde ihm jetzt den linken Arm in die Höhe reißen. Clancys verzweifelter Griff um die Kante mußte sich lösen, und Clancy mußte abstürzen.
In derselben Sekunde, in der Clancy es wußte und Kinsey seinen Arm in die Höhe riß, sagte jemand etwas.
Der Mann hinter Kinsey, aufgetaucht wie aus dem Nichts und den triefenden Ölumhang nun offen, hob nur den Arm. In seiner Hand lag der schwere Dienstrevolver. Die Mündung schnellte vorwärts und mitten in Kinseys Nacken hinein.
»Laß ihn los, dann drücke ich ab, du Satansbraten!« sagte Henry O’Mallon peitschend. »Laß ihn nur los, Hundesohn, und du hast keinen Kopf mehr!«
O’Mallon war wie aus dem Nichts aufgetaucht. Er stand leicht geduckt hinter Kinsey, und sein düsterer Blick richtete sich auf die Spitze der langen Leiter. Die Enden der Holme stießen gegen die schroffe Wand. Es war Floyd Reegan, der die Leiter wie ein Spielzeug so unter Clancys Beine schob, daß er die Stiefel nun auf eine Sprosse stellen konnte.
Kinsey spürte die kalte Mündung des Revolvers in seinem Genick. Er hörte die scharfen Atemzüge O’Mallons, und er wußte, daß es jetzt vorbei mit ihm war. Seine Hände ließen Clancys Arm endlich los. Die Leiter zitterte, als Clancy langsam Sprosse für Sprosse hinabstieg.
»Steh auf«, sagte O’Mallon eisig. »Los, du Schuft, runter auf die Bühne – runter mit dir, Mann!«
Dann schwieg er. Er blieb hinter Kinsey, als der über das Gerüst hinabkletterte. Stumm deutete O’Mallon zur Hütte, und genauso stumm wies er danach auf Kinseys Pferd.
Sie arbeiteten nicht, sie standen alle herum, ihr Werkzeug in den Händen und O’Mallon mit Blicken verfolgend, als er neben dem Pferd herging.
O’Mallon verschwand mit Kinsey aus dem Talkessel. Die Männer schwiegen. Aber sie sahen sich an, als gleich darauf Schreie zu ihnen herüberschallten.
»Zum Teufel!« knirschte Gates heiser. »Was steht ihr da und glotzt, he? An die Arbeit, macht weiter!«
Die Schreie verstummten. Zwei Minuten vergingen, bis sich wieder etwas am Talausgang zeigte. Es war O’Mallon, er kam barhäuptig und den Hut in der Hand auf sie zu.
»Gates«, sagte O’Mallon finster. »Das nächste Mal sagt ihr mir gleich die Wahrheit. Ich wußte doch, daß der Hundesohn sich irgend etwas ausdenken würde. Er kommt nie wieder, zum Teufel mit dem Kerl. Ich bleibe jetzt hier. Wer hat die letzte Fuhre?«
»Ich«, meldete sich Gould gepreßt. »Mr. O’Mallon, wir hatten keine Ahnung, daß Kinsey das tun würde, wirklich keine.«
»Schon gut«, knurrte O’Mallon. Er warf Clancy einen Blick zu. »Bau dein Gestell wieder auf, Clancy! Ich fahre den Wagen zum Fluß.«
Clancy wechselte einen stummen Blick mit Floyd. Reegans Gesicht war bleich geworden. Jetzt wußten sie, wer den Wagen und sie beide an diesem Abend zum Verladeplatz am Snake River fahren würde. Ausgerechnet O’Mallon...
*
Es geht schief, dachte Clancy beklommen. Warum mußte er Carpenter mitnehmen, warum einen dritten Mann, nur damit wir schneller abladen konnten?
Clancy schloß die Augen. Das Rütteln des Wagens, der über den unebenen Weg nach Richfield holperte, schüttelte ihn durch. Sie saßen im Kasten, hatten längst abgeladen und hockten nebeneinander angekettet, wie O’Mallon es befohlen hatte. Ganz hinten am Endbrett kauerte Carpenter. Dann kam Floyd. Die Kette, die die beiden Männer verband, war von O’Mallon unter dem Seitenbrett des Kastens durchgezogen, und dann um den hinteren Holm gewunden worden. Jeder Versuch loszukommen, war damit vereitelt. Sie hätten erst das seitliche Kastenbrett hochstemmen müssen. Vorn jedoch lag das Sitzbrett von einer Kastenwand zur anderen. O’Mallon mußte es sofort merken, wenn sich das linke Seitenbrett hob.
Carpenter hing dösend, den Kopf gesenkt, in der Ecke hinten. Sie hatten jeder einen Ölumhang bekommen, ehe sie losgefahren waren. Der Regen wurde nun stärker, er prasselte auf die Umhänge und ihre schäbigen Hüte herab.
Als Clancy an die Latrine dachte, packte ihn der Wunsch zu lachen. Auch das war schiefgegangen. Sicher, er hatte den dort versteckten Keil jetzt auf dem Bauch – auf der nackten Haut unter dem Hemd. Aber er hätte ihn gar nicht zu holen brauchen. O’Mallon trug Gates’ Schellenschloßschlüssel in der Hosentasche. Den Keil hatte Clancy sich ganz umsonst geholt.
Clancy stieß Floyd leicht an. Floyd hatte sich, so weit er konnte, von Carpenter fort und nach vorn auf O’Mallon zugeschoben. Jetzt beugte sich Floyd Clancy entgegen und wisperte:
»Es hat keinen Zweck, Clancy. Wir kommen nicht an ihn heran. Wirf den Keil weg!«
Clancy schüttelte stumm den Kopf. Ohne O’Mallon aus den Augen zu lassen, hob er den Umhang leicht an. Seine Hand fuhr zu der Schnalle seines Hosenriemens. Er öffnete ihn, sah dann Floyd an und flüsterte kaum hörbar:
»Mach deinen ab. Schiebe ihn mir herüber. Es geht auch anders.«
Floyd dachte seit einer halben Stunde, die sie nun schon zurückfuhren, an den Snake River. Floyd Reegan war kein guter Schwimmer. Der Snake River führte Hochwasser.
Es hat alles keinen Sinn, dachte Floyd bedrückt. Großer Gott, wir schaffen es nicht. Und Carpenter, was tun wir mit Carpenter, diesem Totschläger?
Clancys Ellbogen stieß ihn an, und er begann hastig unter dem Umhang seinen Hosenriemen aus den Schlaufen zu zerren. Als er ihn zusammenrollte und ihn zu Clancy schob, nahm O’Mallon jäh den Kopf herum.
»Sitzt ihr ruhig?« fragte O’Mallon mürrisch. »Ich fahre jetzt schneller, der Weg wird besser. Wir müssen vor Dunkelheit im Jail sein.«
Clancy war der kalte Angstweiß ausgebrochen. Er wußte, wie eiskalt O’Mallon war. Der Mann fürchtete sich vor nichts. Er wäre auch allein mit zehn Sträflingen an den Snake River und zurück zum Jail gefahren. Die Luft einsaugend, griff Clancy nun nach den beiden Hosenriemen. Er schob die Spitze von Floyds Gürtel durch die Schnalle seines Gurts und legte sie mit dem Dorn fest. Einen Blick zu Carpenter schickend, sah Clancy in das angespannte, lauernde Gesicht des Berufstotschlägers. Carpenters Kopf ruckte zweimal in Richtung O’Mallon. Clancy nickte kurz, und um Carpenters Mundwinkel huschte ein hämisches Lächeln.
Einen Augenblick später rutschte Clancy bis auf weniger als einen Dreiviertel Schritt an O’Mallon heran.
Carpenter öffnete den Mund, seine Augen stierten auf Clancys Hände. Und dann wußte Carpenter es genauso wie Floyd Reegan. Auch mit weit vorgestreckten Händen kam Clancy nicht an O’Mallon heran.
In der folgenden Sekunde sah Carpenter, wie der Riemen von Clancy gepackt und unter dem Umhang hervorgezogen wurde.
Clancys Arme wanderten jetzt in die Höhe. Clancy kniete am schwankenden, rütteln den Kastenboden und hob die Hände, zwischen denen die beiden zusammengeschnallten Hosenriemen baumelten, weit nach hinten über seinen Kopf. Dann zog er sie auseinander. Der Riemen straffte sich.
Es passierte im gleichen Moment.
Henry O’Mallon, der Oberaufseher, dem man einen tierhaften Instinkt nachsagte, wendete den Kopf.
In derselben Sekunde schnellten Clancys Hände und damit der Hosenriemen blitzartig nach vorn...
*
Der Riemen klatschte rechts und links von O’Mallons Hals auf die Ölhaut. Clancy stieß einen kurzen, scharfen Schrei aus. Dann warf er sich hintenüber. Wie ein Würgeseil zuckte der Riemen zurück. Er fuhr O’Mallon unter das Kinn.
Clancy riß mit einem wilden Ruck seine Arme zurück. O’Mallon kippte von der Sitzbank. Seine Beine fuhren steil in die Höhe, sein Körper krachte von der Sitzbank in den Kasten hinein. Während der Oberaufseher auf den Rücken schlug, warf sich Floyd Reegan schreiend nach vorn. Der große, riesenhafte blonde Mann streckte seine Hände aus, so weit er nur konnte.
»Clancy, reiß ihn zurück!« schrie Reegan. »Seine Rechte, achte auf seine Rechte, Clancy.«
In diesem Moment bekam er auch schon O’Mallons Schultern zu packen.
Floyds große Hände krallten sich in die Ölhaut, die Jacke und O’Mallons Hemd. Der Aufseher flog haltlos über den regennassen, glitschigen Boden des Wagens.
Sekundenlang glaubte O’Mallon, daß sein letzter Augenblick gekommen war. Der Überfall hatte ihn vollkommen überrascht. O’Mallons Hand erreichte den Revolverkolben. Kaum aber wollte er die Waffe ziehen, als Clancy mit der linken Hand die Ölhaut O’Mallons in die Höhe fegte. Gleichzeitig schnappte Clancys Rechte zu. Sie schloß sich wie eine Zange um O’Mallons Handgelenk. Mit einem Fluch drehte Clancy dem Oberaufseher den Arm so hart um, daß O’Mallon vor Schmerz aufschrie. Er mußte den Revolver fahren lassen. Seine Hand zuckte, von Clancy hochgerissen, über die Hosentasche hinweg. Aus der Hosentasche hing jene Schnur heraus, an der Gates’ Schellenschlüssel baumelte.
Ehe Clancy erkannte, was passierte, riß O’Mallons hochstehender Daumen die Schnur und damit den Schlüssel aus der Tasche. Die Hand des Oberaufsehers flog in die Höhe, und glänzend schoß der Schlüssel im Bogen über die Kante des Wagenkastens hinweg.
»Der Schlüssel!« schrie Clancy entsetzt. »Verflucht, der Schlüssel! O’Mallon, du Narr!«
Seine Linke packte zu. Sie riß O’Mallons Colt aus dem Halfter. Die Waffe schwang hoch, und während O’Mallon auf seine Waffe stierte, hörte er Clancy finster sagen:
»Tut mir mächtig leid, Mann!«
Dann traf der Hieb O’Mallons Kopf und löschte sein Bewußtsein mit einem Krachen aus.
Die Pferde liefen immer noch. Der Wagen fuhr noch weiter. Irgendwo am Rand des Weges war der Schlüssel für die Schellen verschwunden.
*
»Der Schlüssel!« keuchte Clancy, als der Wagen stand. »Verdammt noch mal, der Schlüssel!«
Er blickte auf die am Wegrand liegende Seitenwand des Wagenkastens. Sie hatten sie hochgestemmt und einfach hinabgeworfen. Nur dadurch war es ihnen gelungen, die Kette vom Holm zu zerren. Sie waren frei, sie konnten vom Wagen springen, aber sie würden dann hintereinander durch Schellen und Ketten aneinandergefesselt, die Suche beginnen müssen.
»Und der da?« stieß Carpenter schrill durch die Zähne. Er blickte mit wachsender Panik auf den wie tot im Kasten liegenden O’Mallon hinab.
Clancy sah ihn kurz an. Dann tastete er O’Mallon ab und fischte ein stabiles Schnappmesser aus der Hosentasche des Oberaufsehers.
»Die Peitschenschnur«, knurrte Clancy. »In zwei Minuten ist er gebunden.«
Während sie ihn banden, fiel der Stahlkeil polternd zu Boden.
Sie stiegen ab. Clancy band die Pferde an einen Busch, ehe sie in einer Linie losrannten. So schnell sie konnten kehrten sie zurück zu der Stelle, an der O’Mallons Schlüssel liegen mußte.
»Er flog im Bogen weg«, erinnerte sich Clancy laut. »Wir knien uns hin, nebeneinander. So arbeiten wir uns vorwärts. Faßt in jede kleine Wasserlache, tastet das Gras vor euch genau ab!Also los!«
Sie krochen, sie bogen das Gras auseinander, sie fuhren in jede kleine Pfütze, suchten jeden kleinen Busch genau ab. Nach zwanzig Schritten hatten sie ihn immer noch nicht, und zehn Minuten waren vergangen.
»Wir finden ihn nie!« stöhnte Carpenter furchtsam. »Clancy, wenn jetzt ein Reiter kommt – oder ein Wagen? Mann, wo ist der verfluchte Schlüssel denn? War es bestimmt hier – bestimmt?«
Floyd kroch plötzlich los und riß sie mit, daß sie fast hinschlugen. Und dann sahen sie ihn.
Der Schlüssel hing an einem Buschzweig. Es dauerte keine drei Minuten, dann liefen sie, der Schellen und Ketten endlich ledig, auf den Wagen zu.
»Carpenter, du kannst auch mal was tun!« zischte Clancy. »Das Kastenbrett mitbringen, mach schon, Mann! Wir fahren den Wagen in die Büsche.«
Carpenter gehorchte wortlos. Clancy band die Pferde wieder los, stieg auf den Kasten und beugte sich zu O’Mallon.
»Sie sind also munter«, stellte er kurz fest. »Nun gut, O’Mallon, ich wollte Sie nicht niederschlagen, aber Sie griffen zum Revolver. Liegen Sie ruhig, Ihnen passiert nichts!«
»Er ist munter – was ist er?« ächzte Carpenter. Er rammte das Seitenbrett fest und beugte sich zu dem auf dem Bauch liegenden O’Mallon hinab. »Clancy, was willst du mit ihm machen, he? Der Kerl ist gefährlich wie ‘ne Horde Klapperschlangen. Die Hunde und er, sie stöbern uns auf, wo immer wir sind.«
»No!« antwortete Clancy knapp. »Los, wir fahren!«
Er brachte den Wagen vom Weg herunter. Sie fuhren etwa drei Minuten, bis sie in einer kleinen Mulde anhielten. Obgleich der graue Dunst den Weg drüben nun verdeckte, wußte Clancy doch, daß man denWagen vom Weg aus niemals sehen konnte.
»Vom Wagen mit O’Mallon!« befahl er.
»Ich schirre die Pferde aus, wir brauchen sie. Floyd, sieh dir die Mutter vom linken Hinterrad genau an, ob man sie losdrehen oder den Splint herausbekommen kann! O’Mallon kommt an ein Rad. Tut mir leid, O’Mallon, ich habe keine andere Wahl. Irgendwann werden sie dich schon finden.«
»Clancy, Mister, du machst einen Fehler«, sagte O’Mallon bitter. »Morgen früh spätestens bin ich wieder frei. Und was dann kommt, brauche ich dir nicht zu sagen, was?«
»Drohst du noch?« brüllte Carpenter wild. »Mensch, ich schlage dich tot, wenn du jetzt immer noch ein großes Maul hast. Clancy, laß dir gesagt sein, der Kerl ist besser für alle Zeit stumm.«
»Du bist ruhig«, knurrte Clancy scharf. »Wenn du losgekommen bist, dann verdankst du es uns, Mann. Behandle ihn anständig, runter mit ihm.«
Er schirrte die Pferde aus, als er Floyd schreien hörte und herumfuhr. Floyd stand vor O’Mallon. Er hob langsam die Arme an.
»Zur Seite!« keuchte Carpenter. »Scher dich weg, Floyd, sonst hast du ein Loch im Bauch. Ich mach’ keinen Spaß, verdammt, ich drücke ab! Zur Seite, sage ich! Der menschliche Bluthund muß weg, sonst erwischt er uns doch wieder!«
Floyd zauderte, aber da stieß ihm Carpenter mit voller Wucht den Gewehrlauf unter die Rippen. Reegan knickte ein, stöhnte und krachte zur Seite um. Carpenter hob das Gewehr an, zielte und...
»Drück ab, und du bist in derselben Sekunde in der Hölle«, sagte Clancy träge. »Laß fallen, Carpenter!«
Das Knacken des Hahnes in seinem Rücken ließ Carpenter steif vor Schreck werden.
»Na, los, drück ab!« forderte Clancy Carpenter eiskalt auf. »Mehr als sterben kannst du nicht, du verdammter Schurke! Laß fallen!«
»Du verfluchter Idiot!« schrillte Carpenter. »Der holt jeden ins Jail zurück. Deine Narrheit bringt uns um. Du Idiot!«
Er drehte sich um, starrte Clancy entgegen und wich langsam zurück.
»Hast du Angst?« fragte Clancy, als Carpenter mit dem Rücken am Wagen stand. »Mann, du hast die Nerven verloren, das kann jedem mal passieren. Schon gut, Carpenter. Hilf Floyd auf die Beine, aber versuche nie wieder einen krummen Trick mit mir. Ich kenne auch einen – diesen!«
Carpenter, besänftigt durch Clancys friedliche Rede, bückte sich. Erst im letzten Augenblick erkannte er, daß Clancy nicht die Absicht gehabt hatte, ihm den Gewehrrammstoß in Floyds Leib zu verzeihen. Clancy zog den Colt blitzschnell hoch und schlug eiskalt zu. Carpenter brach auf der Stelle zusammen.
»Das war es«, sagte Clancy ohne Mitleid. Er bückte sich, riß Carpenters Arme auf dem Rücken überkreuz und sah Floyd an, der sich ächzend aufrichtete. »Floyd, ich denke, es wird verdammt eng für seine beiden Unterarme werden, aber gib die Schelle her!«
»Allmächtiger, was – was hast du vor, Clancy?« stotterte Floyd ächzend.
»O’Mallon kann ihn gleich wieder mit ins Jail nehmen«, antwortete Clancy kalt. »Da gehört der Schweinehund auch hin. Wir sind quitt, O’Mallon, denke ich. Oder denkst du anders darüber?«
Er zwängte die Schelle über Carpenters Handgelenke, legte die Kette um die Radachse und führte sie wieder durch den Schloßbügel. Dann schnappte das Schloß zu.
»Du sagst es«, gab O’Mallon düster zurück. »Dennoch, Mann, ich erwische euch beide. Ich schnappe euch eines Tages.«
»Kann sein, O’Mallon, aber du solltest etwas nachdenken«, erwiderte Clancy kopfschüttelnd. »O’Mallon, ich habe Porter nicht zuerst beschossen. Ich habe auch niemals Geld gestohlen. Glaube was immer du willst, aber ich bin unschuldig, und Floyd ist es auch. Roggers ist tot, das weiß ich. Jemand hat ihn erschossen, nur wenige Wochen, nachdem man mich ins Jail brachte. Ich werde also kaum jemals beweisen können, daß ich ihn nicht bestohlen hatte.«
O’Mallon schwieg. Er ließ sich anketten und hockte nun ein Rad weiter am Wagen als Carpenter.
»Du denkst, daß ich lüge, was?« knurrte Clancy zornig. »Nun gut, denke was du willst, Mister. Noch etwas, mein Freund, das Floyd betrifft. Ich weiß, er kann niemanden umbringen. Er hat mir erzählt, daß einen Tag, bevor er die Prügelei mit Bartley hatte, die Bank in Twin Falls überfallen wurde. Es waren vier Mann, O’Mallon. Und aus dem Corral, an dem Bartley erschlagen gefunden wurde, fehlten später genau vier Pferde. Floyd hat vergeblich beteuert, daß er Bartley nur verprügelt, aber niemals einen Stein gesehen oder genommen hätte. Vier Bankräuber, vier gestohlene Pferde – und ein Toter, neben dem ein Stein lag. O’Mallon, du solltest wirklich nachdenken. Von mir wirst du nichts mehr hören, fürchte ich. Clancy geht fort und wird sterben.«
O’Mallons Kopf ruckte hoch. Er sah Clancy durchbohrend an. Um seinen Mund kroch ein sparsames, grimmiges Lächeln.
»Du bist höllisch schlau«, murmelte er dann. »Clancy, du hast angegeben, du wärest als Waisenkind aufgewachsen. Ich kenne deine Akten, Mister. Ich bin darüber gleich gestolpert, weil ich auch ein Waisenkind gewesen bin. No, Mister, du warst kein Waisenkind. Clancy, du wirst sterben, wie? Ich verstehe. Du verschwindest und tauchst irgendwo als ein ganz anderer Mann wieder auf. Wer bist du wirklich, mein Freund?«
»Das«, sagte Clancy und grinste dünn, »wirst du nie erfahren, Mister. Und jetzt mach den Mund auf. Ich muß dir dein Taschentuch zwischen die Zähne stopfen. Tut mir leid, wenn ich dich in so verdammt schlechter Gesellschaft zurücklassen muß, aber das überstehst du, wie?«
O’Mallon sah ihn an, seine Augen funkelten, aber er sperrte den Mund auf.
»Komm«, sagte Clancy trocken zu Floyd. »Wir haben zwei Pferde, und unser Freund hier wird uns suchen wollen. Er wird sich wundern, wenn er uns nicht findet. Adios, mein Freund!«
Er lachte, als er zu den Pferden ging und aufstieg.
Den Keil hatte er wieder vom Wagen genommen. Er hatte eine Ahnung, daß er ihn noch würde brauchen können.
O’Mallon blickte ihnen nach. Er sah sie im grauen Schleier des Regens verschwinden...
*
Floyd Reegan fuhr mit einem leisen Schrei in die Höhe. Seine Hand zuckte zum Gewehr, aber er hatte die Waffe noch nicht hoch, als Clancy kühl sagte:
»Das bin nur ich, Junge. Nicht so nervös, Floyd. Sie können unsere Fährte niemals gefunden haben, auch mit zwanzig Hunden nicht. Alles, was sie vielleicht nach einigen Tagen entdecken werden, wird ein angeschwemmtes totes Pferd an irgendeinem Ufer des Snake River sein. Daß wir durch den Fluß gekommen sind, glaubt keiner.«
Floyd hatte fest geschlafen. Halb benommen saß er nun am Boden. Es schüttelte ihn, als er an die Nacht dachte, das reißende, gurgelnde Wasser und ihre ängstlichen Pferde, die vor dem Fluß zurückgescheut hatten. Es war passiert, als sie in der Mitte des Flusses gewesen waren. Irgendein Baumstamm hatte sein Pferd gerammt. Wenn Clancy den abtreibenden Floyd nicht in letzter Sekunde gepackt hätte, wäre Floyd todsicher ertrunken.
Clancy war am Abend davongeritten. Er wollte zwei Pferde, Verpflegung und andere Kleidung beschaffen. Der Mond stand hoch am Himmel. Es mußte weit nach Mitternacht sein, und Floyd wurde nun völlig munter. Verstört sah er sich um, fuhr dann zusammen und…
»Großer Gott, Clancy, woher..., was...«
»Die Pferde?« murmelte Clancy träge. »Ich sagte dir doch, ich würde welche besorgen. Mein lieber Mann, drei Tage ohne Essen. Das mußte ein Ende haben. Kein Regen mehr, schön klarer Himmel und eine niemals zu findende Fährte. Na gut, da hast du was!«
Floyd starrte auf das Brot, das Schinkenfleisch und würgte schwer, ehe er es annahm.
Floyd aß hastig. Erst als er den ersten Hunger gestillt hatte, fragte er wieder:
»Clancy, traust du mir nicht? Warum sagst du mir nicht, von wem du die Sachen bekommen hast?«
Clancy war dabei, einen Packen zu öffnen. Er hielt ein Hemd hoch und warf es jetzt Floyd Reegan zu.
»Well«, murmelte er. »Könnte dir passen, zieh es mal an, Junge. Kein Vertrauen zu dir? Das ist es nicht, Junge. Es ist nur so, daß ich Freunde habe. Wenn man uns erwischt, dann weißt du besser nicht, woher ich die Sachen bekam, klar?«
»Ich würde nicht reden, Clancy. Du hast gesagt, wir waren Freunde in Ketten und würden das auch ohne bleiben«, preßte Floyd hervor. »Ich würde dich doch nie verpfeifen. Oder jemand, der uns hilft, Clancy.«
Clancy schwieg einige Sekunden. Dann sah er weg und sagte leise:
»Ich hab’ versprechen müssen, den Namen der Leute nicht zu nennen, verstehst du? Als ich hier wegritt auf dem Gaul, was dachtest du, Floyd? Keine Antwort, was? Du dachtest, ich käme nicht wieder, na? Siehst du, soviel Vertrauen hattest du zu mir. Oder war es nur die Angst, allein bleiben zu müssen? Na gut, Floyd. Ich habe all diese Sachen von ziemlich armen Leuten, denen ich mal einen Gefallen tun konnte. Ich kam bei ihnen vorbei, kurz nachdem – jemand ihnen Pferde gestohlen und den Sohn schwer angeschossen hatte. Ich ritt den Kerlen nach. Es waren zwei. Den einen mußte ich erschießen, der andere gab verwundet das Spiel auf. Ich brachte den Leuten ihre Pferde wieder, und weil der Sohn zwei Monate nicht arbeiten konnte, half ich seinem Vater etwas. Ich ritt Pferde zu und machte Rancharbeit. Umsonst, wenn du das wissen willst.«
»Aber sie wußten doch, daß du aus dem Jail...«
»Sicher«, gab Clancy leise zurück. »Sie halfen mir dennoch. Sie haben nicht viel, verstehst du? Zwei Pferde sind für diese Leute eine Menge wert. Brauchst nicht nach einem Brandzeichen zu suchen, sie sind ungebrannt, diese beiden Pferde. Ich habe ihnen versprochen, ich würde sie ihnen bezahlen. Yeah, wenn das Mädchen nicht gewesen wäre...«
»Ein Girl?«
»Yeah«, murrte Clancy. »Ich bin weggegangen, damals, weil ich merkte, daß sie mich mochte. Ich sagte zu ihr, eines Tages käme ich wieder. Irgendwann, wenn ich etwas erreicht hätte. Sie meinte, ich brauchte nichts zu besitzen. Es war verdammt nicht ganz einfach, jetzt hinzureiten. Ich sagte ihnen, wo ich gewesen wäre und was ich angeblich getan hätte, verstehst du. Sie glaubten mir, Junge.«
Er sah zum Himmel und lächelte verwischt. Floyd blickte ihn an. Er hatte ihn noch nie so nachdenklich gesehen.
»Du, Clancy, ist das Girl hübsch?«
»Denke schon, Junge«, seufzte Clancy. »War nicht ganz so leicht, wieder wegzureiten. Aber es mußte sein. Bin schließlich nicht drei Tage lang mit dir nach Südwesten geritten, um dann meinen Plan aufzugeben. Jetzt hör zu, Junge, wir reiten noch einige Stunden bis zum Morgengrauen. Dann rasten wir den Tag über. Von hier aus geht es nach Süden. Dann reiten wir durch das nördliche Nevada, stoßen am Owyhee nach Norden hoch und kommen schließlich über den Warfield Creek in die Nähe von Silver City. Nach Möglichkeit soll uns niemand sehen. In einer Woche dürften wir am Ziel sein.«
»Und dann?« erkundigte sich Floyd gepreßt. »Clancy, meine Mutter und meine Schwester! Sie werden zu ihnen reiten und sie verhören. Wenn ich ihnen doch Nachricht geben könnte.«
»Du kannst weder hin noch ihnen schreiben, nicht jetzt«, beruhigte ihn Clancy. »Niemand wird ihnen etwas tun, keine Sorge, Junge. Du bist frei.
Und vielleicht kannst du eines Tages beweisen, daß du Bartley doch nicht erschlagen hast. Ich will nach Silver City. Hugh Stacy, der Kerl, der damals für Roggers arbeitete und gegen mich schwor, wird noch in der Stadt sein. Roggers war damals der mächtigste Mann. Heute wird das Horgany sein. Er war immer der erbittertste Gegner von Roggers, und vielleicht hat er Roggers Freunde aus der Stadt jagen lassen. Kann sein, daß Stacy dann nicht mehr in Silver City ist. Er hatte jedoch eine Freundin, ein Girl aus der Tanzhalle. Finde ich Stacy nicht, dann ist sicher das Girl da. Und ist auch das weg, muß ich mit Horgany reden.«
»Der holt den Sheriff, Clancy«, sagte Floyd besorgt. »Bist du sicher, daß er es nicht macht?«
»Eben nicht«, knurrte Clancy finster. »Das wäre die letzte Möglichkeit, begriffen, Floyd? Nur keine Angst, niemand wird uns auf zwei ungebrannten Pferden in Cowboytracht vermuten. Eher hält man uns für Wildpferdjäger. Rasieren werden wir uns nicht. Und wenn wir uns in Silver City bewegen, dann vorsichtig. Nur keine Angst, Floyd, wir kommen hin. Wir finden entweder Stacy, John Carter oder das Girl.«
Und wenn er niemand mehr findet, dachte Floyd Reegan bedrückt. Wenn nun niemand mehr da ist?
*
Floyd rührte sich nicht. Nur seine Augen wanderten langsam nach rechts. Vom Zaun her drang ein leises Schaben an Floyds Ohren. Jemand kam, bog geduckt um die Stallecke und schob sich dann in die Nische neben ihn. Floyd atmete aus. Zwei Stunden hatte er hier gewartet, während Clancy auf die Suche gegangen war.
»Dauerte lange, was?« flüsterte Clancy leise. »Tut mir leid, Floyd. Ich habe sie...«
Floyd, der wenig Hoffnung gehabt hatte, hob den Kopf.
»Was – bestimmt?«
»Yeah«, erwiderte Clancy düster... James Horgany hat alle Tanzhallen und Saloons übernommen nach Roggers’ Tod. Er warf die meisten Leute von Roggers aus der Stadt, darunter auch Stacy und Carter.«
»Großer Gott!« stieß Floyd erschrocken heraus. »Clancy, warst du etwa bei diesem Horgany?«
»Ich bin doch nicht verrückt«, gab Clancy grinsend zurück. »Genausogut hätte ich auch gleich zum Sheriff Claybran gehen können. No, ich bin zum Frachthof drüben gegangen. Ein paar Fremde, die ich fragte, kannten Stacy und Carter gar nicht. In der Frachtstation versorgt ein alter, halbblinder Mann die Pferde. Er erkannte mich nicht. Ich tat so, als wäre ich vor zwei Jahren mal hiergewesen. Stacy und Carter sind verschwunden und seit drei Monaten nicht mehr in der Stadt gesehen worden.«
»Teufel, wenn sie weg sind!« preßte Floyd hervor. »Weißt du, wohin?«
»No«, antwortete Clancy knapp. »Aber das Girl, Madeleine Crouchot, ist da. Der alte Stallhelp in der Station erzählte mir, sie ritte manchmal weg. Wahrscheinlich trifft sie sich mit Stacy. Der Kerl und sie steckten immer zusammen. Das Girl hat jetzt die Aufsicht über alle Tanzhallengirls drüben im Silver-Star-Palast. Die Girls, es sind sieben, wohnen in einem Bretterhaus hinter der Tanzhalle. Wir müssen hin. Nach Mitternacht schließt die Tanzhalle. Gewöhnlich ist es so, daß die Crouchot länger bleibt. Sie hat die Aufsicht und muß abrechnen, was die Girls den Männern aus der Nase gezogen haben. Sie kommt immer später und muß über den dunklen Hof.«
»Allmächtiger, du willst sie dir greifen?« schluckte Floyd. »Clancy, wenn sie schreit? Eine Frau schreit alles zusammen.«
»Die schreit nicht«, sagte Clancy grimmig.
Er zog sein Messer und fuhr mit dem Daumen über die Klinge. Floyd stierte auf das Messer und die Klinge. Ihm wurde schlecht...
Floyd brach der kalte Schweiß aus. Vor ihm fiel das Licht aus den drei Fenstern in den Hinterhof. Er hörte die Mädchen lachen, durch ein offenes Fenster jetzt Schritte auf einer Treppe.
»Sieben«, sagte Clancy hinter ihm träge. »Drei wohnen oben, vier unten in den beiden Zimmern. Paß auf, Junge...«
»Clancy, du kannst doch nicht ins Haus, du kannst nicht einfach...«
»Sie wohnt im Anbau«, erwiderte Clancy ungerührt. »Bleib hier stehen und paß nur auf. Kommt sie nicht allein, gehst du nach rechts hinter den Schuppen. Dann bist du in der Gasse und pfeifst, verstanden? Ich verschwinde dann.«
»Du schaffst es nicht, wenn sie einen Mann mitbringt«, ächzte Floyd. »Welches Fenster ist offen?«
»Das hintere von hier aus«, gab Clancy gleichmütig zurück. »Ein Schiebefenster.«
Er glitt davon, huschte um die Büsche an der Veranda. Als er sich auf der Veranda zum hinteren Seitenfenster des Anbaues bewegte, knackten die Dielen leicht. Dann stand Clancy am Fenster. Er zwängte die Klinge seines Messers unter den Rahmen, stemmte es hoch und schloß danach die Augen, um sie an die Dunkelheit des Raumes zu gewöhnen. Als er die beiden Töpfe vom Fensterbrett genommen hatte, stieg er in den Raum. Rechts stand ein Sofa. Davor war ein Tisch mit zwei kleinen Sesseln. Neben der Tür leuchtete eine helle Vase vom Vertiko herab.
Mit drei Schritten war Clancy am Fenster. Er sah hinaus und Floyds Schatten am Schuppen reglos stehen. Ohne jede Hast griff Clancy nach den Vorhängen. Er zog sie zu, hatte nun jedoch nur noch wenig Licht im Raum durch das hintere Fenster.
Sie wird es nicht merken, daß der Vorhang zugezogen ist, dachte er. Wenn sie hereinkommt, greift sie nach der Lampe. Also dreht sie sich der Wand zu. Sie kann gar nicht zum Vorderfenster sehen.
Clancy zog das Schiebefenster wieder herab, bis es fast geschlossen war.
Dann schlich er durch den Raum zum Vorhang, öffnete ihn etwas, sah hindurch und...
Im selben Augenblick sah er sie auch schon kommen. Ihr Schatten hob sich hell von der grauen Wand des Schuppens ab. Von Floyd Reegan war nichts mehr zu erkennen. Er hatte sich bereits um den Schuppen verdrückt.
Clancy glitt neben die Tür. Er preßte sich an die Wand und ließ die Klinge des Messers ausschnappen.
Die Schritte kamen, die Dielen auf der Veranda knackten.
Clancy stand still, das Messer in der rechten Hand...
Die Tür vor ihm war wie eine Wand, um die er nun glitt. Clancy kam lautlos herum wie ein Geist. Er schlich auf Socken. Seine Stiefel hatte Floyd draußen.
Die Frau seufzte leise. Er roch ihr Parfüm, den Duft ihres Puders, ehe er am Türschloß vorbei war. Dann sah er sie unmittelbar vor sich stehen. Der Lampenzylinder klirrte, das Ratschen des Streichholzes kam, die Flamme zuckte hoch.
Clancy bewegte sich nicht mehr. Jetzt konnte er nichts tun. Wenn sie den Lampenzylinder fallen ließ, mußte das Klirren von den sieben Girls drüben gehört werden. Er wartete, er sah mit angehaltenem Atem über ihre Schulter hinweg auf das Streichholz und ihre Hand, die Finger, die beiden Ringe.
Die Flamme kroch nun über den schwarzen Dochtrand der Lampe, das Licht breitete sich aus. Madeleines brünettes, hochgestecktes Haar schimmerte, als sie den Kopf zur Seite bog, sich auf die Zehenspitzen stellte und den Zylinder aufsetzte. Dann glitt ihre Hand abwärts – und Clancys Linke schoß blitzartig über ihre Schulter hinweg. Vielleicht sah sie seine Hand, vielleicht hörte sie, wie sich der Stoff seines Hemdes rieb. Sie zuckte zusammen, aber sie schrie nicht. Er war zu schnell mit der Hand, deren Daumen und Zeigefinger zupackten. Die Finger krallten sich blitzschnell um ihre Kehle. Danach zuckte sein Messer hoch und blieb unmittelbar vor ihrem Gesicht stehen.
Im vollen Licht der Lampe sah Madeleine Crouchot jetzt die funkelnde Klinge in der schwieligen Faust. Sie öffnete den Mund, sie glaubte ersticken zu müssen.
»Wenn du schreist«, sagte Clancy leise, »passiert dir was, klar? Das ist kein Bluff, Madeleine, ich bringe dich um.«
Er wußte, was sie jetzt dachte. Sie war viel zu kalt, um ihre Chancen nicht genau abzuwägen. Eine Frau wie Madeleine handelte nicht kopflos, sondern kalt durchdacht nach dem ersten Schreck.
Seine linke Hand glitt von ihrem Hals. Er hörte, wie sie saugend Atem schöpfte. Dafür nahm er die Rechte etwas herum, die Klinge wanderte nun auf ihre Kehle zu.
»Ich würde nichts versuchen«, murmelte Clancy. »Auch wenn die Klinge weg ist, Madeleine, mehr als einen Ton bringst du nicht über die Lippen. Leise reden, wenn du schon etwas sagen willst, verstanden?«
Einen Moment nahm er die Klinge herum, aber nur, um das Messer in die linke Hand zu wechseln. Dann zuckte die Klinge wieder zurück, und seine Rechte glitt zu ihrer Hüfte.
Seine Hand griff den Stoff ihres Kleides zusammen.
Er faßte fest zu, bis sich seine Finger um den Kolben des Derringers schlossen, der in einem Flachhalfter an ihrem rechten Oberschenkel steckte Clancy hob ihr den Rock leicht an. Mit dieser Bewegung zog er den Derringer aus dem Halfter.
Danach öffnete er die Hand. Die Waffe fiel zu Boden.
»Wer bist du?« fragte sie. Etwas wie Furcht schwang in ihrer Stimme mit. »Teufel, woher hast du das gewußt?«
Sie meinte den Derringer.
Clancy lächelte in ihrem Nacken. Er griff jetzt in die Brusttasche, seine Hand entfaltete das zusammengelegte Taschentuch.
»Ich nehme dich mit«, sagte er eisig. »Deine Augen werden verbunden. Solltest du schreien, stirbst du, begriffen?«
Sie wurde steif vor Furcht, aber sie schrie nicht, als er ihr die Augen mit dem Taschentuch verband.
»Wir gehen«, murmelte Clancy. »Ich führe dich schon, keine Sorge. Dir passiert nichts, wenn du vernünftig bist.«
Er wußte, daß sie vernünftig bleiben würde.
Sie kommt mit, dachte er, sie hat jetzt etwas Angst, aber sie kommt mit, wetten?
*
Die Pferde standen auf der Lichtung neben dem Weg von Silver City zum Silver Creek. Bis zur Stadt brauchte man von hier zu Fuß gut eine Stunde.
Clancy griff zu, er riß ihr das Tuch herunter und stand vor ihr, angeschienen vom Mond.
»Wir sind da«, sagte er kühl, als sie blinzelte und den Kopf nach ihm wendete. »Nun, Madeleine...«
Sie schrie nicht mal. Nur ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Es waren dunkelbraune Augen in einem noch schönen Gesicht.
»Clancy!«
»Yeah«, sagte er träge. »Ich, Lady. Nicht an der Stimme erkannt, was?«
Madeleine sah sich um, und er wußte, was sie suchte. Sie hatte sofort an Floyd gedacht, mit dem er eigentlich zusammensein mußte. Aber sie sah ihn nicht, sie hatte keine Ahnung von Clancys Plan. Floyd war zwar hier, aber so weit entfernt, daß sie ihn weder sehen noch sein Pferd schnauben hören konnte.
»Du weißt es also«, murmelte er. »Ganz Silver City weiß davon, denke ich. Es spricht sich herum, was, wenn jemand aus dem Statejail türmt. Weiß Stacy das auch?«
Ihre Lider zuckten, aber sie hatte sich sofort wieder in der Gewalt.
»Stacy?« fragte sie achselzuckend. »Sicher hast du dich erkundigt, Clancy, was? Er ist schon vor Monaten verschwunden. Horgany mochte ihn und Carter nicht mehr als Rauswerfer beschäftigen. Ich weiß nicht, wo er ist.«
Er lächelte nur, als er das Messer hob, die Sperrfeder drückte und die Klinge herausschnellte.
»Du erinnerst dich?« fragte er sanft und leise. »Da war dieser Lopez, und da war Marita, das Halbblut aus dem Alhambra-Saloon. Sie ließ sich mit einem anderen Kerl ein, als Lopez unterwegs war. Weißt du noch, wie wir sie fanden und wie ihr Gesicht aussah? Was ist eigentlich aus ihr geworden? Mit dem Gesicht konnte sie Männer nur noch erschrecken, wie?«
Sie wurde kreidebleich und stierte auf das Messer.
»Das… das tust du nicht!« stammelte sie. Jetzt packte sie wirkliche Furcht.
»Nein?« fragte er leise und zischend. Er sprang auf sie zu und griff nach ihrem Haar. »Du glaubst nicht, wie gleichgültig einem gewisse Dinge werden, wenn man lange genug im
Statejail gesessen hat.«
Er lachte leise und spürte, wie sie zu zittern begann. Ihr Gesicht und ihre Figur waren ihr Kapital. Ohne Gesicht nützte ihr auch die Figur nichts mehr.
»Clancy, du bringst ihn um.«
»No«, sagte er eisig. »Du liebst Stacy, was? Er sieht gut aus, ich weiß. Nun, ich könnte mich mit Carter zufriedengeben. Carter braucht nur die Wahrheit zu sagen, verstehst du? Vielleicht lasse ich Stacy ganz heraus, wenn du klug bist.«
Sie schluckte schwer, dann nickte sie.
»Also gut«, sagte sie gepreßt. »Sie sind beide in der Nähe von Trentonville. Da liegt die alte Sägemühle von Blake. Ein gewisser George Paine hat sie übernommen. Stacy und Carter arbeiten für ihn. Du kennst doch Trentonville, das Nest, in dem man mal Silber fand?«
»Ich war mal da«, gab er zurück. »Es ist lange her. Wie war das mit dem Weg nach dem Nest, he? Mußte man nicht mitten durch die Berge reiten?«
Madeleine Crouchot nickte heftig.
»Ja, Clancy, mitten durch die Berge. Kurz vor Trentonville geht es hoch zum Nordarm des Owyhee River. Es sind sechs Meilen von Trentonville bis zur Sägemühle.«
»Stacy arbeitet?« fragte er mißtrauisch.
»Ich weiß, du glaubst das nicht, aber es ist so«, versicherte sie hastig. »Paine und die anderen schlachten die alten Minenanlagen da oben aus. Sie verkaufen Schienen und das andere Zeug. Dabei verdienen sie nicht schlecht. Ich schwöre dir, sie arbeiten wirklich.«
Sie lügt, dachte er, sie lügt wie immer, das falsche Biest. Der Weg führt zwar mitten durch die Berge nach Trentonville, aber es gibt einen, den man gut zwei Stunden schneller reiten kann.
Dieser andere Weg führt von Osten her durch die Täler, und man muß dann nur einmal in die Berge hoch, um in das Nest zu kommen. Warum lügt sie mich an? Es paßt nicht zu Stacy und Carter, daß die beiden Halunken richtige Arbeit tun sollen. Dazu taugen die Schurken nicht.
Er brummte: »Hast du gelogen, passiert dir was. Ich finde dich überall. Und rennst du zum Sheriff, verlaß dich darauf, daß ich Stacy umblase. Los, verschwinde!«
»Was ist, ich soll laufen?«
»Dachtest du fliegen?« knurrte er barsch. »Du schenkst mir eine Stunde Vorsprung, Lady.«
Er lachte kalt, als er aufstieg und anritt. Er trieb das Pferd zum Galopp, jagte davon und wußte, was sie jetzt tun würde. Nachdem er weit genug geritten war, hielt er an. Im leichten Trab und im weiten Bogen kehrte er zurück. Keine dreihundert Schritt von jenem Platz entfernt, an dem er sie einfach zurückgelassen hatte, fand er Floyd.
»Sie hat geredet«, sagte er kurz.
Clancy riß sein Pferd herum. Dann jagten sie durch die Nacht davon. Clancy wußte, was passieren würde. Und er sollte sich nicht irren!
*
Floyd Reegans Mund war so trocken, daß er mit rauher Stimme sprach. Alles, was Clancy vorhergesagt hatte, war eingetroffen Madeleine Crouchot hatte Silver City in weniger als einer Dreiviertelstunde erreicht. Aber sie war nicht zum Sheriff’s Office gelaufen, sondern zum Mietstall.
»Das falsche Biest!« keuchte Floyd, als Clancy sein Pferd zurückriß. »Clancy, bist du sicher, daß Ferris, der Mietstallbesitzer, gleich kommt?«
Clancy brummte finster: »Wir sind hier am Ostweg, rechts und links ist Buschgelände. Der Kerl kommt hier entlang, darauf verwette ich meinen Kopf. Er wird allein kommen, wahrscheinlich mit zwei Pferden, um schnell zu sein. Los, drüben hin. Dem Pferd die Nüstern verbinden und dein Lasso nehmen. Ich hole den Kerl aus dem Sattel du fängst seine Pferde ein, klar?«
Floyd nickte, riß sein Pferd herum und trieb es in die Büsche. Clancy verschwand hinter einigen hohen Büschen hart am Wegrand. Es dauerte keine fünf Minuten, dann hörten sie den trommelnden Hufschlag.
Augenblicke später tauchte das Pferd im Mondschein über dem Weg auf. Der Reiter saß vorgebeugt im Sattel, und das zweite Pferd lief im donnernden Galopp kurz hinter dem ersten an einer Longe. Es trug einen Sattel, aber keinen Reiter.
Clancy lag fast auf dem Hals seines Pferdes. Er schwang jetzt schon das Lasso, hob die Hacken an und hatte sein Pferd nach Süden gewendet. Ein kurzer, scharfer Blick flog dem Reiter entgegen. Es war Ferris, der Mietstallbesitzer. Der Bursche war groß, hager und ritt seine besten Pferde.
Im nächsten Moment raste Ferris auch schon auf die großen Büsche zu. Er war noch nicht an ihnen vorbei, als Clancy seinem Pferd die Hacken einschlug. Das Tier sprang mit einem wilden Satz vorwärts. Clancys Lasso flog hoch. Die Schlinge sauste auf Ferris zu, der erschrocken den Kopf herumriß. Der Mann schrie schrill auf! dann warf er sich nach vorn, aber Clancy hatte damit gerechnet. Sein Lasso berührte fast den Hals des Pferdes von Ferris. Die Schlinge zuckte zurück, und Ferris fiel das Seil um die Schultern.
Clancy riß sein Pferd zur Seite und zügelte es. Er sah noch, daß Ferris nach seiner Hüfte griff. Aber dann kam der Ruck. Der heulende, furchtsame Schrei von Ferris hallte gellend über die Büsche hinweg. In einem weiten Bogen flog der Mietstallbesitzer rücklings vom Pferd herunter. Er prallte mit voller Wucht auf den Weg. Aus seiner Hand wirbelte der Revolver einige Schritt weiter.
Kaum zwanzig Schritt von Clancy entfernt kamen jetzt die beiden Pferde schrill wiehernd zum Stand. Floyd hatte dem ersten Pferd die Schlinge um den Hals geschleudert und riß es zurück.
Ferris lag wie tot am Boden. Aber kaum stand Clancy neben ihm und stieß ihm den Stiefel in die Seite, schrie er auf.
»Totstellen hilft dir gar nichts, du Hundesohn!« fauchte Clancy grimmig. »Auf die Beine, Mister. Noch Waffen?«
Er tastete ihn ab, fand jedoch nichts außer einem Messer, das er in die Büsche schleuderte.
»Was willst du?« schrie Ferris. »Was soll das? Ich bin ein friedlicher Mann.Wer bist du?«
»Das fragst du?« grimmte Clancy. Er riß Ferris am Kragen in die Höhe.
»Du solltest die beiden Hundesöhne also warnen, was?« erkundigte sich Clancy eisig. »Also, warum sollst du sie warnen, he? Was machen die Burschen im alten Sägewerk – was für dreckige Geschäfte?«
Ferris wurde aschgrau vor Angst und hob die Hände über den Kopf.
»Clancy, ich weiß nicht, ich..., sie stehlen manchmal Pferde.«
»Und kaufst sie ihnen ab, was?« knirschte Clancy. »In Ordnung, Mister. Ich wußte doch, daß diese Halunken nicht zur Arbeit geboren sind. Los, hoch mit dir und in den Sattel. Du kommst mit, Mister.«
»Clancy, wenn die merken, daß ich sie verpfiffen habe, legen sie mich...«
»Das ist dein Risiko!« knurrte Clancy. »Sie werden sich mächtig freuen, wenn sie dich sehen.«
*
Clancy sank blitzschnell herunter. Floyd warf sich hinter ihm zu Boden und kroch dann bis zur Ecke der steilen Schlucht, durch die der Bach rauschend strömte.
»Der verfluchte Schurke Ferris!« knirschte Clancy halblaut. »Ich hätte den Hundesohn nicht mitten in den Bergen zurücklassen sollen. Bleib unten, Floyd. Da vorn auf der linken Wand über dem alten Wassertrog ist eine Hütte, eine Art Turm mit einem schäbigen, verfaulten Schöpfrad. Vor der Hütte sitzt ein Kerl und beobachtet das Tal.«
Floyd schnappte nach Luft vor Grimm. Ferris’ Beschreibung des Tales stimmte, nur von dem Wächter hatte der Schurke keinen Ton gesagt. Er hatte sie in eine Falle rennen lassen wollen. Irgendeine Ahnung hatte Clancy die Pferde in einem Seitental anbinden und zu Fuß bis an die Ecke zum Haupttal schleichen lassen.
»Wie weit ist sie entfernt?« keuchte Floyd. »Kommen wir dorthin, Clancy?«
Clancy äugte vorsichtig um die Ecke. Er sah die Kantholzstelzen des Turmes.
Sie standen zu beiden Seiten des Baches. In etwa sechs Schritt Höhe befand sich jener turmartige Hüttenaufbau. Ein halb verfallenes Trogsystem führte zum Schöpfrad. Der untere Bogen des Rades war abgefault. Weiter hinten erhob sich der nächste Bock mit noch einem Rad, zu dem das Trogsystem führte. Um die Hütte lief eine Art Plattform mit einem teilweise zerbrochenen Geländer. Im Abstand von dreißig Schritten standen Pfähle wie Stangen einer Telegrafenleitung. Auch ein Draht war zu erkennen. Er lief durch Haken und hing etwas durch. Der Draht endete an der Wand der Hütte.
»Floyd«, zischte Clancy. »Da ist ein Draht, der bis um die Biegung des Haupttales führt und dort verschwindet. Zieht der Posten an ihm, klappert todsicher etwas irgendwo hinter der Talbiegung, und dann sind die Kerle dort alarmiert. Floyd, wir müssen auf die Wand hier, im Bogen an die andere Wand am Haupttal und versuchen, mit dem Lasso einen Pfosten des alten Geländers zu erwischen. Ich könnte mich am Lasso auf die Plattform ziehen.«
»Und wenn der Posten etwas hört?«
»Der Bach rauscht, der hört nichts«, knurrte Clancy. »Komm schon, wir müssen hier hoch und uns den Kerl schnappen.«
*
Floyd hielt mit seinen Bärenkräften das Seil fest. Die Schlinge war von Clancy um einen der Eckpfosten, an dem das Geländer abgebrochen war, geschleudert worden. Sie hatten beide mit aller Macht am Seil gezogen, doch der Pfosten hatte sich nicht gerührt.
Er hangelte sich in regelmäßigen Schwüngen langsam dem Eckpfosten entgegen, während Floyd schwitzend auf die linke Ecke der Hütte stierte. Kam der Posten jetzt jenseits der Hütte von der Bank hoch, und marschierte er auch nur drei Schritt über die Plattform, war alles aus. Er mußte Floyd sehen, das Seil und den am Seil hängenden Clancy.
Dann aber erreichte Clancy die Ecke. Sein linker Stiefel fand einen Halt auf einer Querverstrebung des Turmes aus Kanthölzern. Clancys linke Hand umklammerte den Eckpfosten. Und dann zog sich Clancy mit einem Schwung auf die Plattform. Einen Moment blieb er bäuchlings liegen, ehe er sich nach Floyd umsah und heftig winkte. Floyd ließ das Lasso fahren. Zwei Schritt weiter lag ein Felsbrocken, hinter dem er Deckung nahm und Clancy beobachtete. Ohne Hast schob sich Clancy jetzt nach rechts. Er kam jenem blinkenden Draht näher, duckte sich leicht und stand auch schon an der Ecke.
Der Draht, das wußte Clancy, endete direkt neben der Bank auf der der Posten hockte, an einem Haken in der Hüttenwand. Clancy schob den Kopf um die Ecke, hielt den Colt erhoben und flog dann blitzschnell vorwärts. Der Posten hatte sich erhoben. Er gähnte lauthals. Sein Kopf fuhr herum. Er sah Clancy und wollte schreien. Mit einem wilden Satz flog Clancy auf den Mann zu. Der Bursche wollte an die Wand springen, streckte schon die Hand aus und griff nach dem Draht.
Ehe er ihn jedoch erreichen konnte, schlug Clancy zu. Der Hieb traf den Mann über den Hut, und der Bursche kippte mit einem heiseren Aufschrei zur Seite. Seine ausgestreckte Hand verfehlte den Draht nur um einige Zoll. Er fiel in die nur angelehnte Tür der Hütte hinein.
»Alle Teufel«, ächzte Clancy. Seine Arme schmerzten noch von der Hangelei am Seil. Er schüttelte sie jetzt aus und drehte den Mann dann um. »Ferris, der Strolch, sagte etwas von fünf Mann, die hier hausen sollen. Jetzt wären es nur noch vier.«
Zwei Minuten später hatte Clancy den Mann mit dem Lasso gebunden. Floyd kam jetzt unten im Haupttal angerannt, und Clancy ließ den Posten am Seil in die Tiefe schweben. Über die steile, alte Leiter, die zur Hütte hochführte, hätte Clancy den Mann nicht heruntertragen können.
»Du großer Gott, was machen wir jetzt?« fragte Floyd. »Clancy, wohin mit dem Kerl?«
»Wir nehmen ihn mit«, gab Clancy kurz zurück. »Bring die Pferde her, Floyd.«
Floyd rannte davon. Jetzt besaßen sie jeder einen Revolver und ein Gewehr.Wenig später stiegen sie auf, den gebundenen und geknebelten Mann vor Clancys Sattel.
Das sind Pferdediebe, dachte Floyd beklommen. Sie werden schießen, wenn sie uns sehen...
*
Clancy hielt sein Pferd zurück. Sein Blick flog über den Bach hinweg und heftete sich auf den großen Schuppen, an dem der Bach vorbeigurgelte. Das Wasser wurde neben dem Schuppen von einer halbrunden Steinmauer gestaut. Über ihr erhob sich das Gerüst eines Wasserrades, das sich jedoch nicht bewegte. Das Wasser floß unten aus einem aufgezogenen Schieber in das tiefer gelegene Bachbett. Man hatte den Bach hier gestaut. Ein kleiner See wurde von einer Mauer am Schuppen begrenzt und breitete sich etwa vierzig Schritt breit und sechzig lang nach Nordosten aus. Weiter hinten stieg das Gelände an. Clancy konnte den Lauf des Baches bis zu einer Felswand verfolgen, über die er rauschend hinabfiel.
Das Rauschen schien das breite Tal auszufüllen. Links lag ein flaches, aber langes Bretterhaus. Die Tür stand offen. Zu sehen war kein Mensch. An der Nordflanke des großen Sägeschuppens erhob sich ein kleineres Blockhaus vor einem zweiten, offenen Schuppen. Dort lagerten Bohlen und Balken. Einige sahen neu aus. Eine Lore stand vor dem dunklen Hintergrund des Sägeschuppens, dessen breites Flügeltor halb geöffnet war. Schienen führten in den Sägeschuppen. Einige Baumstämme lagen rechts, und einer ruhte auf der Lore.
Es sah nicht aus, als ob man hier arbeitete. Dafür standen im Corral hinter jenem flachen Bretterhaus fünf Pferde.
Clancy hob das Gewehr leicht an. Er sah sich nach Floyd um, der sein Gewehr umklammerte. Floyds Gesicht war angespannt. Seine Augen huschten vom Sägeschuppen zu dem flachen Haus hinüber.
»Wir reiten dicht an der Wand«, zischte Clancy in das Rauschen hinein. »Sie müssen in dem flachen Bau sein. Los, Junge!«
Er ritt an, hielt das Gewehr schußbereit und blieb unter der linken Talwand. Langsam kamen sie vorwärts, bis Clancy jäh an den Zügeln riß. In diesem Moment sah er den ersten Mann, und sein Atem stockte vor Schreck.
Clancys Blick fuhr zwischen dem Holzlagerschuppen und dem kleinen, festen Blockhaus durch. Jetzt erst erkannte er, daß der Stausee mit einer Bucht bis hinter den Sägeschuppen reichte. Dort lagen einige flache Felsbrocken, auf denen ein Mann kniete. Der Mann wusch etwas aus. Er wendete Clancy den Rücken zu
Es war Hugh Stacy!
Drei Sekunden genügten Clancy, um Stacy genau zu erkennen, dessen dunkles Haar sich gelockt im Nacken kräuselte. In der vierten Sekunde ließ Clancy sein Pferd angehen, und in der fünften lag der Holzschuppen mit seinen gestapelten Bohlen wieder zwischen ihm und Stacy.
Floyd kam nun nach. Auch er blickte nach rechts, sah den Mann und ließ sein Pferd schneller gehen.
»Verdammt, wer, Clancy?«
»Hugh Stacy!« flüsterte Clancy. »Weiter, weiter, Junge. Das Rauschen schluckt das Tacken der Hufe. Noch zwanzig Schritt, dann sind wir weit genug.«
Keine zehn Sekunden später hielten sie knapp vor der Giebelwand des Flachbaues. Hier lagen ein paar alte, grau gewordene Balken, und Clancy stieg ab. Er legte den Mann neben die Balken und band die Pferde an.
»Stacy kann uns nicht sehen«, zischte er Floyd zu. »Floyd, die Tür des Blockhauses ist zu. Ich denke, dieser Paine wird dort hausen. Wir müssen in den Langbau und unter zwei Fenstern durchkriechen, ehe wir an der Tür sind. Ich springe zuerst hinein, du kommst nach. Hör zu, ich will die Kerle lebend und möglichst ohne Lärm. Stacy ist gefährlicher als Carter. Er soll nichts hören, wenn es geht. Traust du dir zu, jemanden zu Boden zu schlagen?«
Floyd grinste breit und streckte stumm seine Riesenhände aus.
»Dort können drei Kerle drin sein. vielleicht nur zwei. Aber ungefährlich sind die nicht«, warnte Clancy. Doch Floyd grinste nur und dehnte die Arme. Dann schlichen sie los.
*
Floyd Reegan lehnte sein Gewehr sacht neben der Tür an die Wand. Sein funkelnder Blick traf Clancy, der hart an der Tür kauerte. Auch Clancy hatte sein Gewehr zu Boden gelegt und den Colt gezogen. Aus der Tür drang das Gemurmel von Männern, etwas klopfte dumpf. Der dröhnende Schlag fiel mit den scharfen Worten eines Mannes zusammen.
»Hol dich der Teufel, du Mißgeburt, du hast schon wieder gewonnen. Mit dir spiele ich nicht mehr, du Trickser. Ich habe genug.«
Etwas schurrte, und im gleichen Moment stieß sich Clancy ab.
Clancy flog mit einem wilden Satz zur Tür herein. In der nächsten Sekunde sah er den Mann unmittelbar vor sich. Der Bursche ragte förmlich vor dem geduckt in den Raum hechtenden Clancy auf. Clancy blieb keine Zeit, sich aufzurichten. Seine Rechte mit dem Colt stieß rammend vorwärts und mitten unter die Rippen des großen, hageren Mannes. Der Bursche flog zurück. Er schrie dumpf, taumelte und kippte im zweiten Rammstoß von Clancys linker Faust glatt um. Clancy sah ihn quer über einen Hocker stürzen und schwer auf die Dielen schlagen.
Clancy warf sich über den zu Boden gekrachten Mann und glaubte, irgendwo links noch undeutlich einen Schatten auszumachen. Sein Colthieb ließ den stöhnenden Mann am Boden verstummen. Aus der Hocke flog Clancy hoch, und dann sperrte er den Mund auf.
Floyd Reegan stand breitbeinig am Tisch. Er hatte den Mann dort mit beiden Händen am Hals gepackt. Jetzt hob er den Burschen hoch, der strampelnd zappelte. Floyd drehte sich mit dem Mann zur Wand. Seine gewaltigen Arme hoben den Burschen an, und dann stieß er ihn mit dem Kopf gegen die Wand. Es dröhnte einmal kurz.
Floyd öffnete die Hände, der Mann fiel zu Boden und lag still. Sofort aber warf Floyd sich herum. Doch seine Blicke suchten genauso vergeblich wie Clancys nach noch jemand. Bis auf die beiden nun am Boden liegenden Burschen war der langgestreckte Raum leer.
»Hölle und Pest«, keuchte Clancy verstört. »Floyd, ich möchte nie mit dir kämpfen müssen. Teufel, sieh dich um, da sind noch vier Pritschen mit Decken außer den beiden hier!«
»Alle Teufel, tatsächlich!« stieß Floyd heraus. »Ferris, der Hundesohn – Clancy, er hat gelogen. Hier sind sechs Mann gewesen. Der Halunke!«
»Yeah«, knirschte Clancy. »Sechs, mit Paine sicher sogar sieben. Floyd, da hängen Sättel an der Wand, Lassos sind auch da. Binde die Burschen zusammen, ich besuche Stacy! Den kaufe ich mir allein.«
Er huschte aus der Tür, griff nach O’Mallons Gewehr und lief geduckt auf das Blockhaus zu. Es war nicht verschlossen. Er stieß die Tür mit einem Ruck auf, sprang hinein, sah zwei Pritschen, aber nur eine, auf der eine Decke lag.
Ohne die Tür wieder zu schließen, hastete Clancy hinaus. Mit wenigen Sprüngen stand er hinter den Bohlen im Holzschuppen. Kurz hochtauchend sah er nun Stacy auf jenen flachen Steinen kauern.
Es war typisch für Stacy, dem man alles, nur keine Unsauberkeit nachsagen konnte. Stacy trug ein Hemd nie länger als zwei Tage. Er zog auch nie eine ungebügelte Hose an. Wenn der brutale Zug um Stacys Mund nicht gewesen wäre, hätte man ihn für einen gutaussehenden, anständigen Burschen halten können. Er hatte jetzt ein Stück Kernseife und rieb eins seiner Hemden auf dem flachen Stein ein.
Lautlos und Schritt für Schritt näherte sich Clancy seinem Rücken. Das Wasser rauschte hier nicht so stark. Ganz langsam legte Clancy das Gewehr hin, ehe er sich bis unmittelbar hinter Stacy schob. Dann wanderte seine Rechte behutsam bis über den weit nach außen und hinten ragenden Revolverkolben Stacys. Gleichzeitig hob er die Linke.
Und dann stieß er sie jäh vorwärts.
Während sich seine Rechte um den Revolverkolben schloß, gab er Stacy einen kurzen, heftigen Stoß. Im nächsten Moment schrie Stacy schrill auf. Er kippte haltlos nach vorn. Seine Hände glitschten auf dem eingeseiften Hemd weg und fuhren über die Steinkante ins Wasser.
Clancy hielt Stacys Colt in der Faust. Er sah kaltblütig zu, wie Stacy kopfüber im Wasser verschwand. Die Spritzer jagten hoch, Stacy war fort. Clancy warf den Colt nach hinten, beugte sich vor, stemmte die Stiefel fest ein und sah Stacy hochkommen. Stacys Kopf war noch nicht aus dem Wasser, als Clancy ihm in das dichte, gelockte Haar griff.
»Du verdammter Hundesohn!« knurrte Clancy voller Grimm. »Du sollst mir das Jail bezahlen. Jede Nacht habe ich daran gedacht, was ich mit euch tun würde, wenn ich euch hätte. Du lausiger, verdammter Lügner, ‘runter mit dir!«
Seine Faust schlug zu. Er fegte mit einem Hieb Stacys hochfahrende Arme zur Seite, während er den Burschen unter Wasser drückte. Stacy wollte heraus, er krallte seine Finger in Clancys Arm. Aber Clancy bog sie ihm weg und schlug ihm mit voller Wucht auf die Oberarmmuskel, nachdem er Stacy etwas aus dem Wasser tauchen ließ. Der nächste Schub stieß Stacy wieder unter Wasser. Luftblasen stiegen blubbernd empor. Stacys Bewegungen wurden immer matter, und Clancy riß ihn knurrend auf die Platte.
Neben Stacy stehend, zog er jetzt seinen Colt. Er wartete, bis der Mann gurgelnd Atem schöpfte und die Augen aufriß. Im ersten Moment erkannte ihn Stacy nicht. Das Wasser lief ihm aus den Haaren und über die Stirn in die Augen. Dann aber stieß Stacy einen dumpfen, entsetzten Laut aus. Er erstarrte vollständig.
»Das bin nur ich«, sagte Clancy voller Grimm. »Euer Posten hat euch auch nicht geholfen, du verdammte Ratte!«
Der Revolver wanderte mit der Mündung herum, bis er auf Stacys Stirn zeigte.
»Clancy, schieß nicht!« schrie Stacy los. Sein Gesicht verzerrte sich vor wilder Angst, und seine Augen stierten auf die drohende Revolvermündung. »Clancy, nicht schießen! Ich tue alles, was du willst. Aber schieß nicht. Ich tue alles!«
Mit einem Knurren trat Clancy zu. Er stieß den Stiefel vor Stacys Schulter, und der Mann flog hintenüber ins Wasser.
»Komm ’raus, du Stinktier!« befahl ihm Clancy dann finster. »’raus mit dir, du Lump. Du kommst mit nach Silver City. Und dort singst du deine Melodie, du Hundesohn, sonst bist du tot, das schwöre ich dir. Los, ’raus und vor mir her gehen!«
Stacy kletterte mit angstschlotternden Gliedern und frierend aus dem kalten Wasser. Dann schwankte er vor Clancy her, der seinen Colt aufhob und ihn zu dem langgestreckten Haus trieb.
»Clancy, hör zu«, wimmerte Hugh Stacy. »Ich gebe alles zu. Ich sage aus, daß wir dich in Roggers’ Auftrag tricksten, aber – lege mich nicht um. Ich schwöre dir, ich sage alles, Clancy!«
Floyd trat aus dem Bau und starrte den vor Angst schlotternden Mann düster an.
»Mann!« knirschte er. »Dann gab es diese zweitausend Dollar nie?«
»No, no«, beteuerte Stacy eilig. »Wer ist das, Clancy? Ist das der, mit dem du aus dem Jail entwischt bist?«
»Yeah«, gab Clancy zurück. »Bleib stehen, du Strolch! Floyd, schaff die beiden Kerle zu den Pferden, binde sie quer über den Sätteln an. Hole noch zwei Gäule aus dem Corral, auf die wir den Posten und diesen Hundesohn packen können. Wir brechen sofort auf. Ich will nicht warten, bis Paine vielleicht auftaucht. He, da sind Pferdespuren genug – Stacy, sind sie mit gestohlenen Pferden unterwegs? Und wann kommen sie zurück?«
»Mit gestohlenen..., ich – ich weiß nichts von gestohlenen..., oaaah, nicht, Clancy!«
Clancy drehte ihm mit einem Ruck den Arm um, und Stacy brach aufschreiend in die Knie.
»Na?«
»Yeah, gestohlene Pferde, Clancy, ich gebe alles zu, aber – brich mir nicht den Arm! Yeah, sie werden morgen kommen.«
»Das reicht!« knurrte Clancy ihn an. »Los, ’rein, für dich reichen die Lassos in dem Bau auch noch, du Halunke. Carter ist bei Paine?«
»Yes, er und die anderen.«
»Du kannst direkt mal die Wahrheit sagen, was?« fauchte Clancy. »Hinein mit dir.«
Er gab ihm einen Stoß. Stacy flog in den Bau und bis an den Tisch. Dann mußte er sich auf den Bauch legen. Clancy nahm ein Lasso und band ihn so zusammen, daß er leise stöhnte. Währenddessen ging Floyd hinaus, unter jedem Arm einen der Burschen.
»Clancy, hör zu, die lochen mich ja ein, wenn das mit den Pferden herauskommt«, wimmerte Hugh Stacy am Boden. »Laß mich laufen, ich schreibe auch alles auf, ich...«
»Du bist nicht ganz normal, was?« zischte Clancy eisig. »Ich habe ein halbes Jahr im Jail gehockt. Wie lange du dort zubringst, geht mich nichts an. Aber ich wollte, es wäre für zehn Jahre, damit du merkst, wie das dort ist, Lump. ’raus mit dir, kleine Schritte kannst du machen.«
Er schob ihn vor sich her, bog um die Ecke des Bretterhauses und blieb jäh stehen.
Im ersten Moment wollte Clancy Stacy zurückreißen. Aber dann rührte er sich nicht mehr.
Floyd Reegan stand mit hochgereckten Händen neben den Pferden. Hinter dem Kantholzstapel tauchten jetzt zwei Männer auf. Der Bursche mit einem glatten, kalten Gesicht, braunen Haaren und hellen Augen sagte eisig:
»Streck sie in den Himmel, Clancy, sonst bist du ein Sieb! Hast du ihn, Carter?«
»Ich habe ihn«, fauchte Carter an der anderen Frontecke hinter Clancy bösartig und gemein, »Clancy, mein Freund, so sieht man sich wieder, was? Ich werde dir ein Loch in das Fell machen, wenn du auch nur mit dem kleinen Finger nach deinem Colt zuckst. Hoch mit den Pfoten, sonst...«
»Es tut mir leid, Clancy«, würgte Floyd. »Ich – ich habe sie nicht gesehen... »
»Halt dein Maul, Bulle!« fuhr ihn der Mann mit dem glatten Gesicht finster an. »Jammern kannst du noch genug. Ich sage dir, Clancy, Stacy ist ein Berufslügner. Der würde dir auch erzählt haben, daß wir erst in einer Woche wiederkommen. Ganz ruhig, Mann. So ist es gut, die Arme hoch und.…«
Und dann war das Kratzen hinter Clancy. Der Hieb traf seinen Kopf und ließ ihn nur noch Feuer sehen. Es war das letzte, was er sah.
Es waren kleine Schläge, wie mit einem Lavameißel, die durch seinen Hinterkopf rasten.
Vielleicht stöhnte er, vielleicht auch ein anderer. Irgendwann hörte er ihre Stimmen, irgendwann hatte er das Gefühl der Nässe auf seinem Gesicht, bis er merkte, daß ihm etwas über die Wangen schabte.
»Mach schneller!« keuchte jemand neben ihm. »’runter mit seinem Bart. Ich sage dir, George, ich kenne ihn. Ich kenne ihn ganz genau, nur der verdammte Bart muß weg. Mach doch schneller, Carter!«
»Dem würde ich am liebsten den Hals abschneiden, statt ihn zu rasieren«, sagte Carter. »Den Hals ab..., krchzzz!«
Was machen sie? fragte sich Clancy, während die Schmerzen noch zunahmen, die seinen Kopf zerplatzen lassen wollten. Was ist das, sie rasieren mich?
Es erschien ihm so unwahrscheinlich, daß er sich bemühte, die Augen zu öffnen.
Er wußte, Carter war einmal Barbier gewesen, hatte dann aber das Rasiermesser mit dem Totschläger als Rauswerfer vertauscht. Blinzelnd und etwas verschwommen sah er, daß Carter ihn wirklich rasierte. Irgendwo zwischen den Gesichtern der anderen war ein längliches, hohlwangiges Gesicht, das ihm bekannt vorkam. Der Mann dort starrte ihn aus dunklen Augen an. Sein Mund öffnete sich, und er schrie:
»Wie heißt der – Rod Clancy? Wisch ihn ab, Carter, es ist gut, wisch ihn ab!«
Carter wischte ihn nicht ab. Er schlug ihm einen nassen Lappen ins Gesicht, daß es nur so klatschte.
»Na, Jeff, erkennst du ihn jetzt?« fragte er dann hämisch. »Setzt den Strolch hin, richtig gerade, los!«
Jeff, grübelte Clancy. Er sah immer noch leicht verschwommen. Jeff heißt der Mann also, Jeff?
Jeff trat dicht vor ihn. Er musterte ihn und grinste dann breit. »Du heißt also Rod Clancy?« erkundigte er sich höhnisch. »Bist du auch ganz sicher, daß du so geheißen hast, als du auf die Welt kamst, Mister? Oder hattest du vielleicht einen anderen Namen?«
Es kostete Clancy Mühe, die Kiefer zu bewegen. Er hatte das Gefühl, daß ein Gummiband um sein Kinn lag und es anzog.
»Mein Name ist Clancy, Rod Clancy«, brachte er langsam heraus. »Was, was soll das, Mann?«
»Er sagt, er ist Clancy«, lachte Jeff los. »Das ist ein Vogel!«
»Zum Henker, Skate!« knurrte
Paine, der Mann mit dem glatten Gesicht. »Hör mit dem Blödsinn auf! Weißt du denn, wer er ist?«
»Sicher weiß ich das«, zischelte Jeff Skate. »Er heißt so ähnlich, nur nicht ganz so, Boß. Na, Clancy, willst du ihm nicht sagen, wie dein richtiger Name ist? No, was? Gut, Mister. Dann muß ich das für dich tun. Boß, er heißt Clanton Roderick Burton.«
Clancy sah den Mann an und hob langsam die Schultern etwas höher.
»Du bist verrückt, Mister«, murmelte er träge. »Wie soll ich heißen?«
Skate, der sich Paine zugewendet hatte, fuhr mit einem Fluch herum.
»Versuch nicht zu lügen, du Narr!« fauchte er.
»Du hast deinen Familiennamen abgelegt, weil dich als Burton jeder zwanzigste Mann in Idaho gekannt hätte. Ich weiß alles von dir. Ich war nur ein kleiner, armseliger Fahrer auf einem der Wagen, die deinem Vater gehören. Aber ich habe dich zweimal gesehen. Einmal, als du in Ely warst, das andere Mal in Goldfield. Du brachtest eine Herde Vieh nach Westen. Mr. Burton, ich kenne dich und deinen Vater. Ich weiß, daß du von zu Hause weggegangen bist. Und ich weiß auch, warum. Sie haben wochenlang darüber geredet. Boß, er ist der letzte Burton außer dem Alten. Ihnen gehört neben drei Ranches die Middle-Nevada Stagecoach und Freight-Line. Dazu einige Anteile an Minen, und der Teufel weiß, was noch alles. Sein Alter ist der zweitreichste Mann in Nevada drüben.«
»Bist du sicher?« schrie Paine verstört. »Mann, das wäre... Er ist ein Burton von den Burtons..., sicher?«
»Sicher!« antwortete Jeff Skate grimmig. »Sie sind klotzig reich, unvorstellbar reich, Boß! Die stinken vor Geld, die Burtons. Der hier, den hat sein Alter zur King Ranch nach Texas geschickt, um alles über Rinder zu lernen. Zwei Jahre ist der in Kalifornien in den Minen gewesen. Und bei einer Bank in Phoenix, unten in Arizona, war er auch eine Zeit. Viel war der nicht zu Hause, der Alte hat ihn überall lernen lassen, den feinen Stinker. In Texas soll er, als man dem alten King Rinder stahl, wie die anderen Männer Kings bis nach Mexiko hineingeritten und die Rinder zurückgeholt haben. Da hat er den Umgang mit den Revolvern gelernt. Gibst du es zu, Burton?«
»Du bist wahnsinnig«, erwiderte Clancy mit einem schiefen Lachen. »Mann, wenn ich ein Burton bin, dann bist du der Präsident, was? Paine, er verwechselt mich. Ich war nie in Nevada.«
»Verdammter Lügner!« fauchte Skate. »Dein Alter ließ dich alles lernen. Als du dann nach Hause kamst vor zwei Jahren, hatte er sogar noch ’ne Braut für dich ausgesucht. Boß, weißt du, wen? Die Tochter von Ezra Conroy, die einzige Tochter, versteht ihr? Die beiden alten, stinkreichen Halunken wollten auf diese Art fast alle Minen in die Hand bekommen. Er sollte Elisha Conrey heiraten. Und da gab es Krach. Er warf seinem Alten die Brocken vor die Stiefel und verschwand. Ich weiß es genau, er ist Clanton Roderick Burton.«
»Paine, ist der mal zu heiß gebadet worden?« fragte Clancy spöttisch. »Ich kenne Burton nicht mal.«
Skate fuhr herum und schlug ihm ins Gesicht.
»Du wirst gleich singen, Vogel!« zischte er gehässig. »Und schön laut, das verspreche ich dir. Paß auf, was wir machen.«
Er sprang zu Floyd hinüber, der gebunden vor dem Bau lag. Über Clancys Rückgrat rieselte es eiskalt. Sie wollten ihn zum Reden bringen. Und sie konnten es schaffen...
*
Er starrte auf das große eiserne Schwungrad, das sich im Rauschen des Wassers langsam zu drehen begann. Sein Blick wanderte über die Transmission mit ihren Riemen, bis er auf dem Hebel liegenblieb, den Skate in die Faust genommen hatte.
Das Schwungrad drehte sich immer schneller. Seine Speichen waren bald nicht mehr auszumachen, nur ein flirrender Kreis schien sich in der Mitte des Rades zu bewegen.
Im nächsten Moment warf Skate den langen Hebel mit dem Einrückhaken nach rechts. Der Treibriemen sauste jetzt auf das eine Rad der Transmission. Von einem anderen Rad lief er herunter und verschwand neben dem Dreiblattgatter im Boden. Das Zischen setzte ein. Es wurde zu einem Stampfen, bis es in ein regelmäßiges Fauchen überging.
Clancy sah auf Floyds Gesicht, das von Schweißperlen bedeckt war. Er blickte auf die Stricke und den Baumstamm, auf den sie Floyd gebunden hatten. Dann sah er, wie Paine eine goldene Uhr nachlässig aus der Tasche zog. Er klappte den Deckel auf, hob den Kopf und starrte Clancy wie eine Schlange an.
»Weg mit dem Block!« befahl Paine eiskalt.
Skate trat vor den Block, der die erste Lore daran hinderte, die schräg abfallende Bahn der Schienen hinunterzurollen.
Die beiden Loren mit dem Stamm setzten sich in Bewegung. Carter und Stacy hielten den Stamm, damit er nicht zu schnell vor das Gatter geriet. Einen Moment später jagten die drei Blätter zischend in den Stamm hinein.
»Er rollt jetzt von selbst«, erklärte Paine mit sanfter Stimme, indem er neben Clancy trat. »Sie schneiden in der Minute einen Meter. Du hast also genau drei Minuten, Burton. Dann sind seine Beine dran, und er wird zu schreien anfangen. Vielleicht schreit er schon vorher, wie? Nun, Clancy-Burton, wie sieht es aus?«
»Das wagt ihr nicht«, sagte Clancy düster. »Ich bin nicht Burton. Er stirbt völlig sinnlos.«
Skate lachte. Er lehnte sich an das Stammende und schob noch leicht. Die Sägen fraßen sich immer weiter.
Clancy sah, wie sich Floyds Gesicht verzerrte. Die Schweißtropfen liefen Floyd nun über die Haut wie kleine Bäche.
»Noch zweieinhalb Minuten, Clancy-Burton«, sagte Paine gemütlich. »Zwei und eine viertel Minute. Gleich zwei, mein Freund! Jeff sagt, der Alte hätte nach dir suchen lassen. Angeblich hätte er von dir zu seinem Geburtstag eine Karte aus Kalifornien bekommen, stimmt das? Warst du in Kalifornien? Anderthalb Minuten noch, Burton. Dein Alter sucht dich also. Ob er sich freut, wenn er dich zurückbekommt? Vielleicht zahlt er jemand, der ihm von dir eine sichere Nachricht bringt, auch was? Eine Minute, Mann!«
Er sah zu Floyd. Er wußte, welche Angst Floyd hatte. Er wußte auch, daß sie es tun würden.
»Hört auf«, sagte er grimmig. »Macht Schluß damit. Nun gut, ich bin Clanton Burton. Geht zur Hölle, ihr Strolche!«
Skate schrie gellend, packte den Hebel und warf ihn herum. Die Sägeblätter fraßen sich noch einmal hinein, dann standen sie. Einer rannte hinaus und zog den Schieber hoch. Auch das Schwungrad kam zur Ruhe. Dann schnitten sie Floyd los.
Er rutschte vom Stamm, sein schweißüberströmtes Gesicht wendete sich Clancy zu.
»Clancy«, stöhnte er, »ich bin schuld, ich habe dich da ’reingeritten. Clancy…«
»Mach dir nichts vor«, antwortete Clancy knapp. »Es ist passiert, Junge. Paine, wenn du glaubst, daß mein Vater zahlt, dann irrst du dich. Mag sein, daß er mich suchen ließ. Ich rechnete damit, ich ging darum hierher. So nahe vermutete er mich niemals, das wußte ich. Er mußte denken, daß ich nach Texas oder Kalifornien, vielleicht auch nach Denver gegangen war. Von Boise aus gab ich jedes halbe Jahr einem der Zugbegleiter der Bahn einen Brief mit und zehn Dollar. Die Leute steckten die Briefe entweder in Kalifornien oder in Denver ein. Er hat mich niemals hier gesucht.«
»Und warum hast du Narr dich Clancy genannt?« fragte Paine bissig. »Warum so, warum nicht ganz anders?«
»Als ich klein war, nannte mich meine Mutter Clancy«, sagte Clancy träge. »Und jetzt bildest du dir ein, mein Vater spuckt etwas für mich aus, was? Du kennst meinen Vater nicht.«
»Und du mich nicht«, lachte Paine höhnisch. Er ließ die Uhr pendeln, bis Floyd plötzlich einen heiseren Schrei ausstieß. Floyd stierte auf die Uhr. Er hatte nicht auf sie geachtet, er hatte nur die Sägen gesehen und an sie gedacht. Jetzt stierte er auf die Uhr.
»Die Uhr!« schrie Floyd verstört. »Clancy, die Uhr, siehst du die Uhr? Zeig mir die Uhr, Mann!«
Paine fuhr herum, starrte Floyd an und trat auf ihn zu.
»Was schreist du so?« fragte er finster. »Was ist mit der Uhr?«
»Mach den Deckel auf!« keuchte Floyd. »Mann, mach ihn auf!«
»Nun gut, und?« knurrte Paine. »was hast du, he?«
Floyd blickte wie hypnotisiert in den Uhrdeckel. Sein Mund blieb offen, und sein Gesicht wurde leichenblaß.
»Wo hast du sie her, Mann?« ächzte er. »Von wem hast du die Uhr bekommen?«
»Bekommen?« grinste Paine höhnisch. »Die gab mir jemand. Er kroch über den Boden, und die Uhr baumelte aus seiner Westentasche an dieser goldenen Kette. Als ich sie mir ansehen wollte, fing er an zu schreien. Er schrie nicht lange.«
»Du, du nahmst einen Stein, was?« fragte Floyd zitternd. »Du hast ihn erschlagen und seine Uhr genommen, du Mörder! Clancy, das ist Ed Bartleys Uhr. Die Pferde, Clancy... In der Nacht verschwanden aus dem Corral in Rogerson vier Pferde. Begreifst du?«
Paine grinste nicht mehr. Skate war genauso erstarrt wie zwei der anderen Burschen.
»Verdammt, woher weißt du das?« zischte Paine dann. »Kerl, woher weißt du das von Rogerson und dem Corral? Was weißt du von dem betrunkenen Hundesohn, der dort am Corral aufstehen wollte und uns sah?«
»Das war ein Freund von mir«, sagte Floyd Reegan tonlos. »Ihr habt ihn erschlagen. Und mich haben sie dafür ins Jail geschickt. Sie sagten, ich hätte ihn nicht nur erschlagen, sondern auch noch seine goldene Uhr gestohlen. Ich weiß nicht, wie oft sie mich fragten, wo ich die Uhr versteckt hätte. Aber ich wurde fast verrückt wegen der dauernden Fragerei. Du hast Ed Bartley erschlagen, Mann!«
»Hölle!« stieß Paine hervor. »Wo wir mal waren, da ritten wir nie wieder hin. Den Narren hatten wir gar nicht gesehen. Er war plötzlich da. Und dich haben sie dafür...«
Er begann zu lachen. Skate wieherte wie ein altes Pferd, und die beiden anderen Burschen schlugen sich auf die Schenkel.
»Die lachen, Clancy«, stammelte Floyd verstört. »Und ich... Ihr Hunde!«
Er bäumte sich plötzlich auf. Seine Fesseln platzten mit einem scharfen Knacken. Ehe jemand etwas tun konnte, traf seine riesenhafte Faust im Hochspringen Jeff Skate. Der Mann lachte nicht mehr. Die Faust setzte ihm das Kinn schief und schleuderte ihn volle sechs Schritt bis an den Baumstamm auf den Loren. Erst als Floyd wie ein Rasender herumfuhr und eine Faust Paine mitten auf den Kopf krachte, sprang ihn Hugh Stacy an und schlug ihm den Colt zwei-, dreimal auf die Haare. Floyd drehte sich unbeholfen, dann brach er zusammen.
»Ihr kommt in die Grube!« schrie Stacy giftig. »Und wißt ihr, wie wir euch fesseln werden? Wir haben genug Ketten vom Bäumeschleppen hier. Wir legen euch genauso in Ketten, wie sie euch im Jail angeschlossen hatten. Und danach darf dein Alter zahlen, Clancy. Oder er sieht dich nie wieder.«
Er holte aus und trat Clancy den Stiefel in die Seite. Clancy kippte vom Bock herab, auf den sie ihn gesetzt gehabt hatten. Er landete in den Spänen.
Ketten, dachte Clancy, Kettensträflinge. Nun gut, sollen sie es tun. Schlimmer als im Jail kann es auch nicht werden.
*
Er lag auf dem Bauch, aber er hielt den Kopf zur Seite. Seine Lider zuckten. Das war das einzige Zeichen von Schmerz, als Skate die Kette anriß und sich ihre rostigen Glieder in die Haut seiner Arme preßten.
Clancy hielt es nicht mehr aus, der Zorn war zu groß.
»Paine!« fauchte er und sah, wie Floyd die Lider schloß. »Paine, zum Teufel, ihr brecht ihm die Handgelenke! Muß das so hart gemacht werden, Mann?«
Paine drehte sich jäh um. Sein glattes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse.
»Zu hart, was?« knirschte er. »Der Bulle hier zerreißt Stricke wie Bindfäden. Zu hart? Der kommt nie mehr los, das sage ich dir. Nie mehr. Verdammte Mißgeburt!«
Sein Stiefel trat zu, nicht nur einmal. Floyd zuckte bei jedem Tritt, bis er nur noch stöhnte.
»Hör auf!« schrie Clancy. »Mann, ich sage dir, wenn du ihn weiter so behandelst, schreibe ich nichts, keine Zeile, gar nichts.«
Paine stand still. Er faßte sich nur an den Kopf, auf den Punkt, den Floyds Riesenfaust getroffen hatte.
Skate stieß ein meckerndes, giftiges Gelächter aus und riß noch härter an den Ketten.
»Der schlägt nie wieder«, sagte er dann bissig. »Der schlägt keinen mehr, sage ich. Hätten ihn auch erschießen können, was, Clancy? Du schreibst einen schönen Brief an deinen Alten. Mehr brauschst du nicht zu tun. Das andere besorgen wir schon. Ich werde ihn besuchen und ihm einen Gruß von dir ausrichten. Und dann werde ich ihm sagen, was mit dir passiert, wenn er einen Trick versucht, der alte Bursche.«
Sie lachten jetzt alle. Stacy stand da und drückte den Bügel des schweren Vorhängeschlosses durch zwei Kettenglieder. Es war ein stabiles Kastenschloß, dessen Schlüssel er umdrehte. Danach packten sie Floyd. Sie schleiften ihn an die Wand, nahmen einen großen Haken und schoben ihn durch die Kette. Die Hammerschläge, mit denen sie den Haken in die Wand trieben, waren das einzige Geräusch für eine Minute.
Clancy hatten sie schon angekettet. Er kauerte an der Wand, die Arme wie Floyd auf dem Rücken.Von unten her sah er in Paines glattes Gesicht und in die Augen, in denen der Hohn zu lesen war.
»Du denkst, er zahlt nicht, was?« fragte Paine spöttisch. »Er zahlt, verlaß dich darauf. Jeff, hat er wirklich einen Vetter? Clancy, war der mal bei euch?«
»No«, antwortete Clancy finster. »Er ist der Sohn einer Schwester meiner Mutter. Sie stammte aus Tennessee. Mein Vater kennt ihn nicht.«
»Hund, lüge nicht. War er wirklich nie bei euch?«
»Ich sagte doch, er war nie da. Wir hatten keine Verbindung mit ihm. Er heißt Jones, Charles Jones.«
»Gut«, grinste Paine widerlich und stieß ihn mit dem Fuß an. »Charlie
Jones, was? Dein Alter wird Besuch bekommen, von Charlie Jones aus Tennessee. Freuen wird er sich, daß sein prächtiger Neffe Charlie noch einen Freund mitbringt. Hooper, das machst du, klar? Du kannst so verdammt vornehm sein, oder nicht? Clancy, sieh dir Hooper an! Sage selbst, ist er nicht ein freundlicher harmloser Bursche? Der kann so bescheiden sein, daß er nirgendwo auffällt. Aber Ohren und Augen hat er weit offen, darauf kannst du wetten. Wird sich dein Alter aber freuen, wenn er zwei ständige Begleiter hat, was?«
Sie brüllten vor Lachen, auch der kleine, schlanke Hooper, ein Mann mit einem harmlosen Gesicht.
»Yes, Sir«, gluckste Hooper. »Wie Sie wollen, Sir. Wird mir eine Ehre sein, Sir.«
Sie lachten Tränen. Aber dann wurden sie ernst, denn Paine hielt sich den Kopf und fluchte wild:
»Verflucht noch mal, mir platzt der Schädel, wenn ich lache! Das sage ich dir, Clancy, dein Alter macht keinen Schritt ohne uns. Morgen erzählst du mir alles, was du über deinen Vetter Charlie und dessen Leute weißt. Aber alles, Mann. Wir reiten erst morgen früh los. Unsere Pferde sind zu müde, und wir sind es auch.«
Er stieß ihn noch einmal an und spuckte aus.
Der Strolch, dachte Clancy, der verfluchte Schurke. Dad kennt meinen Vetter wirklich nicht. Niemand kennt ihn, es sei denn, Charlie wäre in den letzten beiden Jahren zu Besuch gekommen. Dad wird zahlen müssen. Und dann?
»He, was grübelst du, Mensch?« fuhr ihn Paine scharf an. »Denk dir ja keinen Trick aus. Wir kennen auch ein paar, Mann. Bilde dir nicht ein, du könntest mir Blödsinn über deinen Vetter erzählen. Keinen Trick, Clancy. Ich warne dich. Geht die Sache schief oder bin ich nicht rechtzeitig wieder hier, legen sie dich um. Ich bluffe nie.«
»Ich verstehe schon«, erwiderte Clancy düster. »Du bluffst nie, meinst du? Du bluffst die Leute doch schon zwei Jahre, wie? Manchmal schneidet ihr wirklich Bretter und Balken, denke ich. Aber es braucht nur jemand herzukommen, der scharfe Augen hat, dann sieht er, was hier los ist. Zu wenig Arbeit für zu viele Männer, was? So schlau bist du gar nicht, Paine. Ich weiß noch, wie drei Burschen damals, als ich gerade bei Roggers angefangen hatte, Roggers aus der Stagecoach holten und ihm eine Geldtasche abnahmen. Von dem Tag an mußte ich dauernd mit ihm fahren, wenn er mal nach Boise wollte. Das seid ihr gewesen, oder? Wer sagte dir Bescheid, daß Roggers das Geld bei sich hatte – Stacy? Oder du, Carter? Ihr habt doch schon die ganze Zeit für ihn gearbeitet. Nur wußte es keiner!«
»Der verfluchte Hund!« knurrte Stacy und schlug Clancy den Handrücken quer über das Gesicht. »Du bist zu schlau, du Strolch. Siehst du jetzt, wie gerissen der Hund ist, Paine? Wir haben noch ganz andere Sachen gemacht, Clancy, du Schlaukopf! Ich sage dir...«
»Halt das Maul, Stacy«, zischte
Paine wütend. »Sage ihm noch mehr, du Narr. Er weiß ohnehin zuviel. Clancy, auf uns ist noch keiner gekommen. Raus jetzt, schlagt Bretter vor das Fenster und lehnt den Balken gegen die Tür. Hier kommt ihr nie ’raus, versucht es erst gar nicht, ihr Narren.«
Er trat aus der Tür. Clancy hörte noch, wie er Long-Tom befahl, loszureiten und Ferris zu suchen. Dann donnerte er die Tür ins Schloß. Das schwere Rumpeln eines Balkens drang zu ihnen herein. Hammerschläge dröhnten. Es wurde fast dunkel, als sie die dicken Bretter vor das Fenster schlugen.
»Clancy«, flüsterte Floyd im Dröhnen der Hammerschläge. »Clancy, es ist meine Schuld. Jetzt sitzen wir wieder angekettet wie im Jail fest. Dein Vater, wird er bezahlen?«
»Die zwingen ihn«, erwiderte Clancy finster. »Er ist eisenhart. Was er will, das macht er immer. Aber diesmal kann er nichts tun. Er wird zahlen und mich doch nicht wiedersehen.«
Einen Moment schwieg Floyd erschrocken.
»Was, was meinst du?« fragte er dann stockend. »Clancy, die lassen uns doch frei, wenn sie das Geld haben, oder? Denkst du etwa...«
»Das können sie nicht«, gab Clancy gepreßt zurück. »Denk doch nach, Junge! Diese Burschen sind eiskalt. Der Bankraub in Twin Falls war nur einer von vielen. Die Halunken sucht man schon gut zwei Jahre. Paine hat man nie verdächtigt, sonst wäre Sheriff Claybran längst mit einem Aufgebot hiergewesen. Kein Mensch ahnt bis jetzt, wer die Banditen sind, die manchmal Pferde stahlen, ab und zu eine Stagecoach ausraubten oder eine Bank überfielen. Erkannt hat man sie nie. Für Sheriff Claybran ist der Kerl harmlos.«
»Clancy, dann haben wir keine Chance?« wisperte Floyd. Die Hammerschläge verstummten. Sie lauschten, hielten den Atem an und hörten nichts. Drei, vier Minuten war alles ruhig draußen. Dann erst hörten sie die Schritte. Jemand ging um das Blockhaus. Irgendeiner der Halunken, der sie jetzt bewachte. Der nächste Bandit würde ihn ablösen.
»Keine Chance«, antwortete Clancy leise. »Floyd, sobald sie mit dem Geld wieder hier sind, ist es mit uns aus. Eine Chance hätten wir noch, aber sie ist zu klein, fürchte ich...«
Er rutschte herab. Die Ketten klirrten leise, als er sich auf den Boden legte und die gebundenen Beine gegen die Wand stemmte. Er versuchte sich abzudrücken. Sein Körper krümmte sich zusammen. Die Glieder der Kette knackten mißtönig, aber sie brachen ihm beinahe die Handgelenke. Er gab den Versuch keuchend auf.
»Clancy, was für eine Chance?« flüsterte Floyd. »Dein Vater wird sie verfolgen lassen, oder?«
»Vielleicht«, murmelte Clancy und schwieg, als er das Schaben an der Wand hörte und die Schritte verstummten. »Ssst..., leise!«
Vielleicht, dachte Clancy, nur vielleicht. Sie werden ihn mitnehmen und irgendwo zurücklassen, damit er niemanden vor Ablauf von zwei Tagen benachrichtigen kann. Die Halunken sind zu schlau und eiskalt. Es gibt noch eine andere Chance, vielleicht noch eine einzige. Aber es ist zu lange her, unsere Spuren waren tot.
Clancy schloß die Augen. Das Bild stieg vor ihm auf, das Gesicht eines Mannes, grobschlächtig, massig der Kopf, aber scharfe, bohrend blickende Augen.
Was kann er gemacht haben, dachte Clancy, was denn? Wir waren weg, es gab keine Spuren. Roggers war längst tot, der einzige Mann, der alles wußte. No, nicht der einzige. Stacy und Carter waren noch da. Nur nicht mehr in Silver City, sondern vor Monaten schon verschwunden. Horgany hatte ihnen angedroht, sie auf die Nase legen zu lassen, wenn sie sich noch mal in Silver City sehen ließen. Was ist, wenn er auch auf Stacy und Carter kam, das Girl fand? Er war nicht bei Madeleine Crauchot, sie hätte es mir gesagt. Er war nicht in der Stadt, dieser menschliche Fährtenhund.
Clancy brach der Schweiß aus, denn es gab noch eine andere Möglichkeit. Er hatte an sie gedacht, darum war er auch nachts nach Silver City geritten. Nachts konnte auch ein Mann wie O’Mallon niemand sehen. Und wenn er ihn doch gesehen hatte, wenn er in der Stadt gewesen war, unsichtbar, nur lauernd und beobachtend, was sich tat?
Er hätte eingegriffen, dachte Clancy.
No, er hätte nicht zugesehen, wie ich mit dem Frauenzimmer verschwand. Oder doch? Keiner hat jemals gewußt, was O’Mallon eigentlich dachte. Wo war O’Mallon geblieben, was hatte er getan, der menschliche Fährtenhund? Aufgegeben, als er keine Spuren fand? Oder war er nach Silver City geritten und hatte gewartet? Was hatte O’Mallon getan?
*
Stacy zog die Tür des Flachbaues sacht auf. Die Türangeln knarrten leise. Paine hob den Kopf. Er lag ganz hinten auf der einen Pritsche, die Augen weit offen, den Colt in der Faust. Die Mündung zeigte auf die Tür, durch die Stacy sich in den langen Raum schob. Auf dem Tisch stand die Lampe. Sie hatten sie brennen lassen, um genug Licht zu haben, wenn sie sich ablösten. Patty Chickens hatte die erste Wache gehabt. Als er hereinkam, um Stacy zu wecken, hatte die Lampe noch nicht gebrannt, und Patty war über den einen Hocker gestolpert.
Wenn er nicht gleich gebrüllt hätte. daß er es war, hätten sie vielleicht geschossen. Paine hatte geflucht wie ein Irrer und befohlen, sofort die Lampe anzustecken, ehe sie sich noch gegenseitig umbrächten.
Er schläft nicht, dachte Stacy, er ist nervös, verdammt. Ob er nur so unruhig ist, weil er nicht in seinem Blockhaus schlafen kann?
»Was ist?« zischte Paine. Er senkte die Hand, der Revolver verschwand unter der Decke. »Sind sie ruhig?«
»Sie rühren sich nicht«, antwortete Hugh Stacy leise.
»Keine Sorge, Boß. Befreien können sie sich nicht.«
Er ging zu Carter, der fest schlief und schnarchte. Als er ihn anfaßte, fuhr Carter in die Höhe. Die Pritsche knarrte, und auch Hooper bewegte sich sofort.
»Ruhig«, brummte Stacy. »Komm, John, steh auf, du bist dran, Mann!«
Carter blieb einige Sekunden sitzen. Er blinzelte müde, gähnte, ehe er sich erhob und nach seinem Gewehr griff. Dann wollte er aus der Tür schlurfen, aber Paines Stimme stoppte ihn.
»Wenn du draußen weiter pennst, bringe ich dich um«, sagte Paine finster. »Schlaf ja nicht ein, Mann. Geh deine Runde, setz dich nirgendwo hin, sage ich dir. Dieser Bulle Floyd mit seiner Kraft könnte den Haken herausziehen, dem traue ich das zu. Der Kerl hat Kräfte wie ein Ochse. Kommt er los und wirft er sich gegen die Tür, hält sie auch der Balken nicht im Schloß. Beim zweiten Anlauf fliegt sie in Stücke, wette ich.«
Er stand auf, ein unruhiger, nervöser Mann, der todmüde war, aber dennoch keinen Schlaf fand. Er schreckte, kaum daß er einnickte, wieder hoch. Mürrisch ging er mit Carter hinaus. Es ließ ihm keine Ruhe, er mußte selbst nachsehen, ob die Burschen in seinem Blockhaus friedlich waren. Leise schlich er sich an die Bohlen, legte das Ohr gegen sie. Länger als fünf Minuten stand er reglos an der Hütte, dann zog er sich langsam zurück.
»Na?« fragte Carter.
»Nichts, sie sind ganz ruhig«, flüsterte Paine. »Es gefällt mir nicht, verdammt. Morgen früh muß Long-Tom aus dem starken Bandeisen, das hinten im Schuppen liegt, vier richtige Schellen machen. Ich will, daß sie an Händen und Füßen fester gekettet werden als jemals im Jail, Mann.Wenn ich nicht hier bin und sie entwischen euch, dann macht euer Testament. Ich sage dir, Carter, sobald sich in der Hütte was regt, schreist du. Und fliegt die Tür auf, dann schießt du. Laß nur Clancy am Leben, der muß noch schreiben.«
»Boß, die kommen nicht los. Kein Gedanke, daß sie das schaffen könnten. Teufel, wer hätte gedacht, daß der Hund jemals aus dem Jail fliehen würde? Stell dir vor, er wäre mit Stacy nach Silver City geritten, und der Idiot hätte ausgepackt.«
»Ihr hättet ihn damals erschießen sollen, dann gäbe es jetzt keinen Ärger, verdammt noch mal«, knurrte Paine finster. »Paß ja auf, Mann! Nicht schlafen, sonst passiert dir was.«
Er ging zum Schlafhaus hinüber, während Carter sich in Bewegung setzte und seine Runde aufnahm.
Als Carter zwischen Schuppen und Blockhaus durchging, lag der Mann hinter dem ersten Bretterstapel reglos am Boden. Seine Hand umklammerte die lange, spitz zulaufende Eisenstange, mit der ein klemmender Sägeschnitt des Gatters aufgedrückt werden konnte.
Der Mann wartete kaltblütig, bis Carters Schritte hinter der Ecke der Hütte leiser wurden. Erst in diesem Moment erhob er sich lautlos. Die unten umwickelte Stange in der Faust, schlich der Mann bis hinter die Ecke der Hütte. Sein klobiger Schatten preßte sich an die Wand. Seine großen Hände hoben die Stange über den Kopf.
Und dann wartete er. Er hatte viel Zeit gehabt, und er konnte auch noch die zwei Minuten warten, bis Carter um die Ecke kommen mußte...
John Carter blieb stehen. Er glaubte, ein Gewisper aus der Hütte zu hören und brachte sein Ohr an die Bohlen. Jetzt war alles still. Mehr als eine Minute lauschte er, doch es rührte sich nichts.
Verdammter Dreck, dachte Carter bissig. Wir hätten die Laterne anstecken sollen. Ein Blick durch das Fenster hätte gereicht. Sie würden gar nichts versuchen, weil man sie dauernd beobachten könnte. Daran hätte der Boß auch denken müssen.
Carter ging langsam weiter. Er wendete den Kopf und sah zum Fenster, als er kurz vor der Ecke war. Dort kam keiner heraus. Dann machte er den nächsten Schritt, kam um die Hüttenecke und...
Er sah nur den Schatten und riß den Mund zu einem Schrei auf. Das Gewehr unter seinem Arm wollte mit der Mündung hochzucken.
In derselben Sekunde kam der Hieb von oben herab. Es war ein kalter, gnadenloser Hieb, der Carters Hut einbeulte und seinen Kopf voll erwischte.
Carter sah nur noch Feuer, eine Riesenwand, in der jener vierschrötige, unförmig erscheinende Schatten stand. Dann fiel die Feuerwand in sich zusammen. Ein Taumeln, ehe Carter einknickte und sich zur Seite drehte.
Der Mann sprang vorwärts, aber er kam zu spät. Das Gewehr Carters fiel seitlich fort. Es schlug gegen die Wand der Hütte. Ein Scharren ertönte, ein Kratzen, dann der dumpfe Schlag, mit dem Carter hinstürzte. Über ihm blieb der vierschrötige Schatten stehen. Die Augen funkelten, der Blick war eiskalt. Der Mann griff unter die Jacke, zog die kurzen Stricke heraus.
»Narr«, sagte er eisig, als er Carter auf den Rücken warf und ihn band. »Du Narr!«
Es war nur ein Flüstern, das der leise Nachtwind schluckte. Der Mann drückte zu. Daumen und Mittelfinger zwängten Carter den Mund auf. Dann schob er das Halstuch zwischen Carters Zähne.
Es war still, als er um die Hütte glitt und zum Schlafhaus blickte. Nur seine Stiefel scharrten leise über die ausgetretene, sandige Stelle vor der Hüttentür. Seine Augen wanderten über den Balken und den Türgriff. Er lächelte jetzt. Es war ein kaltes, grimmiges Lächeln, als er den Balken sacht anhob.
Der Mann war gekommen. Er hatte Geduld genug gehabt und Zeit zu warten...
*
Clancy lag steif und wie tot am Boden. Nur seine Augen lebten, während sein Atem versiegte. Stille jetzt, völlige Ruhe. Kein Laut mehr vor der Hütte. Und doch war dort jemand, schlich durch die Nacht.
Carter, dachte Clancy. Carter redete draußen, dann ging er zwei Runden, aber er brachte die zweite Runde nicht zu Ende. Da war jemand, einer, der Carter erwischte. Das Scharren, der dumpfe Aufschlag. Carter ist fertig.
»Clancy, Clancy...«
Das Geflüster kam von Floyd, drang durch die Finsternis zu ihm herüber.
»Ssst«, machte er. »Ruhig...«
Seine Stimme verklang, er wendete den Kopf und glaubte, den Mann zu hören. Der Mann schlich wie ein Tier um die Hütte. Das Knirschen kam, ein Schaben an der Tür.
Der Balken, dachte Clancy. Jetzt nimmt er den Balken fort. Und was dann? Die Tür ist verschlossen, er bekommt sie niemals auf ohne Lärm. Großer Gott, die Türklinke bewegt sich!
Das Knarren der Feder ertönte, aber Clancy sah nicht, wie die Klinke herabgedrückt wurde. Er wußte nur, daß der Mann dort stand und hineinkommen wollte.
Noch einmal kam das leise Knarren der Feder. Danach wurde es still.
Er schleicht wieder, dachte Clancy. Er schleicht wie damals, als Kinsey seinen Stiefel auf meiner Hand hatte und meinen Arm packte.
Floyd Reegan fror. Er hatte das Gefühl, auf einem Eisblock zu liegen, dessen Kälte seinen Leib erstarren lassen wollte. Floyd hörte jetzt etwas. Sein Kopf zuckte herum, er sah zur Tür. Dort knirschte es. Es hörte sich an, als wenn Eisen sich in einen Spalt zwängte.
Krrräck!
Die Tür, dachte Clancy und stierte auf den Spalt am Schloß. Plötzlich war Licht dort, ein hellerer Streifen. Mondschein draußen, Licht fiel auf die Hüttenfront, drang durch den Spalt ein. Zwischen dem Spalt steckte etwas und glänzte leicht. Die schwere Eisenstange, an deren anderem Ende der geduckte Schatten stand, sich gegen es lehnte.
Der Mann draußen stemmte sein Knie gegen die Tür, während er wuchtete.
Er sah aus schmalen Augen auf das Kastenschloß, den Riegel, der sich jetzt im Aufdrücken der Tür zeigte. Es war kein Schließblech da. Es gab nur einen tief in die Baumstämme getriebenen Schließhaken, der um den Schloßriegel packte. Das Knacken lief durch das Holz, laut und scharf drang es durch die Stille.
Es geht nicht, dachte der Mann, so nicht. Ich muß seitlich ansetzen und den Schließhaken wegdrücken.
Seine Hand fuhr zum Gürtel, riß das Messer heraus und jagte es in den Spalt.
Dann zog er die Stange zurück, setzte sie seitlich an und legte sich danach auf sie. Er sah, wie die Spitze der schweren Stange unter den Schließhaken fuhr. Langsam und knirschend glitt die oberste Winkelspitze des Hakens aus dem Holz. Durch die Tür ging ein Ruck, der Spalt wurde breiter. Jetzt sah man den Schloßriegel, und er setzte die Stange genau auf ihn. Dann drückte er gegen ihn.
Knack!
Ein scharfes Schnappen, dann war der Türschloßriegel fort, und der Mann stand in der aufschwingenden Tür. Ein viereckig wirkender Klotz, der vom Mondlicht beschienen wurde, reglos, drohend.
Als er losglitt, hatte Floyd das Gefühl, von zwei Händen gewürgt zu werden.
Jetzt kam er. Henry O’Mallon, der Mann, der noch jeden entsprungenen Sträfling erwischt hatte.
»Keinen Laut«, zischte O’Mallon. »Na, ihr Helden? Clancy, du Schlaukopf, liege still. Sie haben alles da, was ich brauche. Mit der Eisenstange wuchte ich den Haken aus den Bohlen, keine Sorge. Aber haltet die Ketten steif. Kein Klirren, verstanden? Wir müssen in den Schuppen. Dort ist ein Schraubstock. In den klemmen wir die Kastenschlösser. Mit der Stange breche ich jeden Schloßbügel auf. Die Schlüssel hat Paine, was? Dreh dich zur Seite, Mann, ich kann bei dem wenigen Licht schlecht sehen. Los, dreh dich schon. Oder meinst du, ich schaffe es allein, mit den Halunken fertig zu werden? Kannst mir ruhig helfen, Mister. Ah, da ist der Haken schon. Paß auf jetzt, der kommt aus dem Holz.«
Er redete, dabei hatte er eigentlich nie viel gesagt. Es kam Clancy vor, als grinste O’Mallon sogar.
»Ich breche ein Kettenschloß auf. Ich«, zischte O’Mallon. »Hätte nie gedacht, daß ich eines Tages jemand mit Gewalt eine Kette abnehmen müßte. Mann, ein paarmal war ich soweit, daß ich eingreifen und schießen wollte. Die Halunken kamen, als ich gerade dabei war, drüben am Wasserfall am Lasso hinabzuklettern. Sie sahen nur euch. Mein Glück, was? Dann verkroch ich mich im Loch unter dem Sägegatter. Als das Ding anlief, dachte ich, ich käme nie mehr heraus.«
»Dann... Mann, du hast alles gehört und gesehen? Und du hast nichts versucht?«
»Sollte ich?« fragte O’Mallon kalt. »Hätte ich die geringste Chance gegen die Burschen besessen, Mister?«
»Alle Teufel, hast du Nerven! Was ist mit Ferris?«
»Der rennt hierher, denke ich. Hoffentlich kommt er nicht zu schnell mit diesem Halunken Long-Tom zurück. Pack die Ketten, zieh sie straff, Clancy! Paine, der Hundesohn, hat einen leichten Schlaf. Der Kerl schläft wahrscheinlich gar nicht. Er ist nervös wie ein junger Hund, der keinen Baum finden kann. Hast du die Ketten?«
»Yeah!«
O’Mallon huschte zu Floyd, stieß ihn an.
»Na, du Unschuldslamm?«
Unschuldslamm, dachte Floyd. Großer Gott, wie oft haben sie das zu mir gesagt, und wie höhnisch und gemein. Klingt jetzt nicht mehr höhnisch, was?
Es klang anders. Es klang wie eine bittere, gallige Feststellung...
*
Es war wie ein Bild, dessen Anblick er nicht los wurde. Das Bild blieb, auch wenn er die Augen schloß, der Bandit George Paine. Er sah nur noch Geld. Er konnte tun, was er wollte, und er wußte, daß es ihn nicht schlafen lassen würde. Geld, Scheine, unendlich viele Scheine, hunderttausend Dollar. Die Gedanken kamen, obwohl er sich gegen sie sträubte. Das Geld – er würde es bekommen. Und was sollte er mit ihm anfangen, wenn er es hatte? Manchmal hatte er davon geträumt, reich zu werden. So reich wie die Carmichels, denen die Plantage gehört hatte, auf der sein Vater nur einer von vielen Aufsehern gewesen war. Ein Haus haben, wie die Carmichels es hatten, ein Haus mit Säulen vor dem Eingang. Einen Wagen und vier Pferde. Und dann durch die Straßen fahren, die Leute den Hut ziehen sehen.
Oder sollte er fortgehen nach Havanna de Cuba? Einmal hatte ihm jemand davon erzählt. Seitdem träumte er auch davon: Dort konnte er bis an das Ende seiner Tage sorglos leben. Die Frauen dort hatten eine braune Haut, wie Samt und Seide.
George Paine lag auf dem Rücken, die Augen weit offen. Er hielt es nicht aus, stillzuliegen und nur nachzudenken. Patty Chickens schnarchte sägend. Das Schnarchen machte Paine verrückt, die Gedanken kreisten um das Geld.
Ich muß gehen, dachte er. Und wenn ich mich draußen irgendwo hinlege, nur nicht hier drin bleiben. Hooper pfeift, wenn er den Atem ausstößt, Patty schnarcht wie ein Walroß, der verdammte Kerl.Was soll ich noch mit ihnen, wenn ich das Geld habe? Ich nehme nur Hooper mit. Und wenn wir das Geld haben, dann... Vielleicht nehme ich einen Stein wie bei diesem Narren, der plötzlich am Corral auftauchte und mich anglotzte, was?
Paine wälzte sich auf die Seite. Dann stand er auf. Die Unruhe ging nicht fort, wenn er auf dem Rücken lag und grübelte. Leise ging er los, öffnete die Tür und trat hinaus. Mondlicht griff nach ihm, sein Blick wanderte träge umher.
Im nächsten Moment erstarrte er, seine Augen weiteten sich vor Schreck.
Paine sah zur Hütte, auf die offene Tür. Eine Sekunde war es ihm, als wenn ihn ein Blitz träfe und ihn lähmte. Er stierte zur offenenTür. Das dunkle Loch des Eingangs gähnte ihm entgegen. Keine Spur von Carter, nichts zu sehen.
In ihm kroch das Grauen hoch. Seine Lider schlossen sich einen Moment, bis er sie wieder aufriß. Aber das Bild blieb. Die Hütte war offen. Er schrie nicht, als er begriff, was passiert sein mußte. Nur sein Blick wanderte langsam nach rechts. Einen fürchterlichen Augenblick lang hatte er das Gefühl, daß ein Gewehrlauf auf ihn zeigte. Durch seine Muskeln lief ein Zittern. Sie krampften sich zusammen, und dann sprang er. Er flog mit einem Satz in die Hütte zurück, erwartete das schmetternde Krachen zu hören. Aber es kam nichts. Alles blieb tot und still. Mit aufgerissenem Mund blieb Paine an der Wand des Schlafhauses stehen.
Hooper richtete sich auf, blinzelte, fuhr zusammen, als er Paines leichenblasses Gesicht sah.
Paine schrie auch jetzt noch nicht. Seine Stimme war ganz leise.
»Hooper«, keuchte Paine. Seine Stimme krächzte, der Schweiß brach ihm aus. »Hooper, ’raus aus dem Bett, Mann, wacht auf, schnell! Die Hütte, sie sind ausgebrochen, sie sind frei! ’raus, hört ihr nicht, ’raus mit euch!«
Er sah Hoopers Gesicht zu einer Fratze der Furcht werden, die flackernde Angst in Hoopers Augen. Jeff Skate fuhr auf der Pritsche herum, sein Mund öffnete sich, als wollte er schreien.
»’runter ducken, nicht so hoch,
daß sie durch die Fenster etwas sehen können!« ächzte Paine. »Stacy, Patty, ’raus, hinten ’raus, das Fenster auf! Sie sind los, sie haben es irgendwie geschafft herauszukommen und Carter erwischt. Sie haben seine Waffen. ‘raus, schnell!«
Er stürzte vorwärts, flog geduckt auf das hintere Fenster zu.
Langsam, dachte er und stierte zur Tür. Sein Revolver hob sich, sein Daumen hielt den Hammer fest. Er war bereit zu feuern. Hölle und Pest, dachte Paine, die Fenster vorn. Wenn sie sehen, daß wir auf sind und das Licht brennt – wir sind Zielscheiben für sie. ’raus, bloß ’raus hier!
Er hob den Riegel aus, schob sacht das Fenster auf, aber er zauderte hinauszublicken. Sie konnten schon hinter dem Schlafhaus sein. Wenn er den Kopf hinausstreckte...
»Licht aus«, zischte Paine, als er Stacy vor der Tür kauern sah und Skate zu ihm hetzte. »Lampe aus und still. Zielt auf die Fenster!«
Sie hockten zwischen den Pritschen und hinter dem Tisch. Sie warteten, bis das Licht erlosch. Paine hob den Kopf, sah blitzschnell nach draußen. Niemand war da, alles leer und still. Da wagte er es, stieg über das Fensterbrett, stand draußen und winkte:
»Kommt, schnell!«
Skate kam ihm zuerst nach, dann Patty Chickens. Als sie alle draußen waren, fünf Mann, huschte Paine nach links. Sein Blick flog von der Schlafhausecke zum Corral. Die Pferde standen dort; keins war fort.
»Wo?« keuchte Skate, seine Stimme schnappte über. Sie sahen sich alle wie gehetzt um.
»Boß, wo sind sie?«
Paine würgte, die Furcht war auch in ihm, aber die Überlegung setzte ein und vertrieb seine Angst.
»Dieser Bulle«, flüsterte er. »Er hat die Haken aus den Bohlen ziehen können. Meine Ahnung, meine Ahnung! Die Schlösser. Sie müssen die Schlösser aufmachen, sie brauchen Werkzeug. Im Schuppen drüben.«
Er rannte zurück, hielt an der anderen Ecke des Schlafhauses an. Als er zum Sägeschuppen sah, bemerkte er das schwache Licht hinter einem der Seitenfenster.
»Da!« stieß er durch die Zähne. »Vorwärts, zum Blockhaus, dann unter dem Holzschuppen her. Skate, nimm Patty mit. Jetzt haben wir sie. Skate, hinten herum, schnell!«
Er hetzte vorwärts, flog am Blockhaus vorbei und erreichte den Holzschuppen. Im selben Moment erlosch der schwache Lichtschein im Sägeschuppen. Dunkelheit lag dort. Paine duckte sich tief, rannte weiter. Links von ihm stürmte Skate mit Patty auf den Sägeschuppen los, um an das hintere Tor zu kommen. Sie mußten an beiden Toren sein und ihnen den Ausgang sperren. Dann saßen sie in der Falle.
Paine war keine zehn Schritt mehr von der Schuppenfront entfernt, als er das schwere Poltern links hörte und Patty Chickens heiser aufschrie.
Der Narr, dachte Paine, während er mit einem Riesensatz vorwärtsflog. Er ist über eins dieser alten Bretter gefallen, der verfluchte Narr. Jetzt ist alles aus.
Im gleichen Augenblick tauchte der Schatten am Schuppentor vor Paine auf. Er riß den Colt hoch und feuerte, um den Mann zurückzutreiben.
Brüllend hallte der Donner durch das Tal. Und der Schatten war verschwunden.
*
Das Krachen ließ Clancy zurückzucken. In seinen Ohren war der brüllende Hall des Schusses, in den sich der knallende Einschlag der Kugel mischte. Quarrend flog ein Holzsplitter über Clancy hinweg. Er lag schon, sah noch den Schatten, den zweiten Blitz, der losbleckte, während die Kugel über ihn in das Tor hämmerte. Durch den Spalt des Tores konnte er nun den zweiten Mann ausmachen. Der Bursche lief. Auch er feuerte jetzt auf das Tor, dessen Flügel sich knarrend unter der Wucht der einschlagenden Geschosse zu bewegen begann. Die Kugeln fetzten wummernd in das Holz, aber sie surrten hoch über Clancy hinweg. Clancys Faust ruckte mit Carters Revolver blitzschnell in die Höhe. Er schoß vom Boden aus nur einmal auf den heranstürmenden Schatten, hinter dem irgendwo noch einer war.
In das Brüllen der Waffe kam der gellende, kurze Schrei. Das Geschoß packte Hooper in der Hüfte. Es riß ihm das rechte Bein weg, als der Hieb ihn lähmte. Hooper fiel mit einem Schrei zu Boden. Als er aufschlug, verlor er den Revolver und wälzte sich herum, bis er hinter einem der kleinen Bretterstapel lag. Dort blieb er liegen, die Hände auf die Hüfte gepreßt. Der Schmerz ließ ihn auf nichts mehr achten. Er hörte nicht das krachende Tosen des anderen Schusses. Er sah auch nicht, daß Stacy aufschrie und zurück in den Holzschuppen hinter die Bohlen hechtete.
In diesem Augenblick zerbrach etwas in Stacy. Es war wieder wie damals, als Porter gestorben war und die wilde Furcht Stacy und Carter gepackt hatte. Es war die gleiche Furcht vor Clancy und dessen schneller Hand, die Stacy hinter die Bohlen fliegen ließ. Von dort rannte er wie ein Hase los und zurück. Er wollte nicht bleiben, er kannte Clancy zu gut und lief. Das brüllende Krachen war hinter ihm. Es wabberte dröhnend durch das Tal und hallte von den Wänden zurück.
Raus, dachte Stacy, ein Pferd und raus hier. Paine schafft ihn nicht. Den schafft keiner, der bringt sie nacheinander um, der verdammte Trickser!
Stacy lief, hörte noch den gellenden Schrei hinter sich.
Paine, dachte er, das war Paine. Jetzt hat es auch noch Paine erwischt. Zuerst Hooper, den kleinen Narren, jetzt
Paine, bloß weg, ehe Clancy kommt!
Paine feuerte wenige Sekunden vorher um die Ecke. Sein Revolver spuckte Feuer. Die Kugeln fauchten in das Tor und trieben es immer weiter herum. Gleich mußte es geschlossen sein.
Der Mann hinter dem Tor rollte sich herum und hinein in den Sägeschuppen. Clancy blieb auf dem Bauch liegen. Die Kugeln fraßen sich in das Tor, als er den Colt anhob und nachlud. Seine linke Hand tastete über Carters Waffengurt, den er jetzt trug. Siebzehn Patronen noch, dachte Clancy. Der Narr dort schießt um die Ecke, aber etwas hat er vergessen: daß dort auch nur Bretter eine Wand bilden!
Er hatte nachgeladen und zielte. Dann feuerte er dreimal auf die Bretter kurz vor der Ecke. Er hielt halbhoch, zog durch und hörte den gellenden Schrei.
»Floyd, paß hinten auf!«
Sein Schrei brach durch den Schuppen, als er loslief. Mit einer Flanke setzte er über den Baumstamm vor dem Gatter hinweg. Er erreichte das linke Fenster knapp neben dem Loch in der Schuppenwand, durch das die Welle des Wasserrades lief. Das Fenster aufstoßen und hinaushechten war das Werk von drei Sekunden.
Stacy, dachte Clancy grimmig. Im Holzschuppen, das war Stacy. Er rennt weg, der Hundesohn. Ein Pferd für Hugh Stacy, was? Du entwischst mir nicht, Freundchen!
Unter ihm war das Wasser, das hochspritzte, als er hineinklatschte. Einen Moment schwamm er, bis er das seichtere Ufer am Schieber erreichte und nach unten in das rauschende, gurgelnde Wasser sprang. Clancy kam glatt auf. Er hielt den Colt hoch wie vorher, als er in den Stauteich geklatscht war. Und dann lief er. Das Wasser spritzte an seinen Stiefeln hoch. Er lief und dachte sekundenlang daran, daß sie nur eine Minute später von den Ketten befreit, in der Falle, gesteckt hätten. Sein erster Blick, nachdem die Ketten am Boden gelegen hatten, war aus dem Seitenfenster des Schuppens hinüber zum Schlafhaus geflogen. Er hatte kein Licht mehr gesehen und war losgestürzt.
Jetzt rannte Clancy im Bach entlang, dessen Ufer seinen geduckt vorwärtsstürmenden Körper deckte. Er lief und hörte hinter sich das Krachen des Gewehres. Aber im Krachen des Schusses war jetzt das grelle Wiehern rechter Hand. Clancy sprang aus dem Bach. Er flog das Ufer empor auf die Baumstämme zu, als das Trommeln der Hufe einsetzte. Hinter den Baumstämmen herausstürzend sah er das Pferd vierzig Schritt entfernt im Galopp aus dem Schatten des Corrals auftauchen. Clancy kniete, hielt den Colt in beiden Fäusten. Im Mondlicht raste das Pferd an ihm vorbei. Es war genau auf seiner Höhe, als er abdrückte.
Das dröhnende Brüllen der Waffe vermischte sich mit dem Trompeten des Pferdes. In der nächsten Sekunde überschlug sich das Pferd. Der Reiter schrie. Aber sein Schrei erstickte gleich darauf.
Im selben Augenblick raste das Getrommel heran. Es war zu weit entfernt gewesen. Die Schlucht hatte es verschlungen, und das Belfern der Schüsse es übertönt. Ehe er sich herumwerfen konnte, war das erste Pferd keine sechzig Schritt vor ihm. Er sah das Pferd, den hageren Schatten von Long-Tom und wollte noch feuern. Doch der Blitz raste über dem Kopf des Pferdes auf. Danach traf ihn der Hieb und riß sein linkes Bein weg.
Clancy fiel schwer auf die linke Seite. Vier Schritt waren es bis zu den Baumstämmen, hinter denen er Dekkung finden konnte. Die Deckung war nahe für jemanden, der springen konnte. Aber zu weit für jemanden, der sich über den Boden rollen mußte. Dennoch versuchte Clancy es. Er rollte einmal, als die nächste Kugel kam. Sie schlug dicht neben ihm ein, riß den Boden auf. Plötzlich wußte er, daß er nicht mehr in den Schlagschatten der Baumstämme kommen würde. Er lag im vollen Mondlicht, ein dunkler Fleck am Boden, auf den Long-Tom nun zum drittenmal feuerte. Die dritte Kugel fauchte genau zwischen seinen Beinen durch, als er sich verzweifelt herumwarf.
Aus der Rolle riß er die Arme hoch und feuerte. Es war ein Schnappschuß, nichts mehr. Die Kugel traf nicht. Doch vielleicht konnte sie Long-Tom am nächsten Schuß hindern. Clancy schlug herum auf die Brust. So sah er sie, zwei Pferde dicht hintereinander. Er konnte nur eins treffen, als er liegenblieb und die Faust hochriß. Es kam ihm vor, als bräche nun die Hölle los. Was er gefürchtet hatte, geschah. Ferris hatte keine Waffe besessen, aber todsicher von Long-Tom Sharkey den Colt bekommen. Genauso war es, das wußte er, als Ferris, der hinter Long-Tom ritt, zu schießen begann. Ob er das Pferd Sharkeys getroffen hatte, sah er nicht mehr. Irgendeine Kugel schleuderte Clancy Sand in die Augen. Er war blind, doch er gab noch nicht auf. Während er sich herumrollte und mit einem letzten, verzweifelten Versuch doch noch an die Stämme kommen wollte, feuerte er blindlings in das Herantrommeln der Hufe hinein. Ihm war, als hörte er irgendwo hinter sich einen Schrei, dem zwei Gewehrschüsse folgten. Dann schien die Welt in einem dröhnenden, schweren Krachen unterzugehen. Holz polterte, Baumstämme bewegten sich. Irgend etwas traf seinen Rücken, lag jäh wie ein Berg auf ihm. Er sah nichts, obgleich er sich hastig über die Lider fuhr. Jemand schrie keine fünf Schritt rechts von ihm. Er schrie durchdringend und schrill, bis aus dem Schreien ein heulendes Jammern wurde.
Weit hinter Clancy fiel noch ein Schuß. Das Gewicht lag über ihm, seine Hand tastete hoch. Es war Holz, das er fühlte, Borke, gegen die er sich zu stemmen versuchte.
»Clancy, wo bist du? Clancy!«
Großer Gott, ein Baumstamm, dachte Clancy entsetzt. Er rieb sich die Augen.
Die Tränen liefen ihm über das Gesicht, bis sie soviel Sand herausgespült hatten, daß er wenigstens verschwommen sehen konnte.
»Clancy!«
»Hier«, sagte er mühsam. Er bekam kaum Luft, das Gewicht nahm noch zu und wollte ihm die Rippen eindrücken. »Hier, Floyd!«
»Yeah, yeah. Clancy, wo denn?«
Der Mann stieß nun kleine, schrille Schmerzensschreie aus. Er schrie ohne Unterlaß.
»Hier, Floyd, hier!«
Es polterte. Stiefel traten auf Holz. Dann berührte die Hand seine Schulter.
»Rühr dich nicht, Clancy.«
»Ich kann mich ja nicht rühren, Floyd. Bring den Stamm weg, schnell!«
Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, bis das Gewicht fort war und das Gepolter verklang. Keuchend kam er in die Höhe, riß die Augen auf und sah nun besser. Aber was er sah, brachte ihn fast um den Verstand. Der ganze Stapel Baumstämme war ins Rutschen geraten. Seitlich an ihm lag ein Pferd, über dem ein Stamm quer ruhte. Der Stapel war nach rechts gerutscht, die Stämme gekollert, als das Pferd gegen sie geprallt war. Zwischen dem Holz ragte ein Arm hoch. Die Schreie kamen dorther, und die Hand zuckte bei jedem Schrei.
Als Clancy sich umblickte, sah er Floyd stehen, den Baumstamm daneben. Floyd keuchte rasselnd, er hatte die Arme auf die Knie gestemmt.
»Floyd, hast du – den – allein bewegt?« ächzte Clancy. »Den hast du doch nicht ohne Hilfe...«
»Das war schwer«, sagte Floyd schnaufend. »Alle Teufel, war das Ding schwer. Wie der schreit, was? Das ist Ferris, Clancy. O’Mallon schoß auf den Gaul, und der sprang gegen die Stämme. Da liegt Long-Tom, du hast ihn noch erwischt.«
Clancy wollte loshumpeln, knickte jedoch ein.
»Mein Bein«, brummte er unwirsch, als Floyd auf ihn zustürzte. »Es kann nicht weiter schlimm sein, Junge. Stütz mich etwas, dann geht es schon.«
Von drüben schrie O’Mallon, er hätte einen Toten und drei Verwundete. Ob sie ihm helfen könnten, die Kerle zu binden. Clancy humpelte, bis er sie liegen sah. Er hockte sich auf Bretter und sah auf sie hinab. Patty Chickens lag am Schuppen. Er war tot, während Jeff Skate stöhnte. Hooper wimmerte leise. Sein Gesicht sah im Schein der Laterne, die O’Mallon aus dem Schuppen geholt hatte, gelblich aus.
Seine Hände hielt er auf die Hüfte gepreßt. George Paine war still und ohnmächtig.
Als Clancy den Kopf hob, stand O’Mallon neben ihm. Das grobe Gesicht zeigte keine Regung.
»Weißt du, wer ich bin?«
O’Mallon sah auf Skate hinab. Der stöhnte nur einmal:
»No.«
»Ich«, sagte O’Mallon, und etwas in seiner Stimme erinnerte Clancy plötzlich an Kinsey. »Ich, mein Freund, bin Henry O’Mallon, Oberaufseher im
State-Jail. Ich werde euch mitnehmen. Und ihr werdet auf dem Wagen, der dort hinten am Schuppen steht, darüber nachdenken können, ob ihr Halunken nicht besser hier gestorben wäret. Eines Tages, mein Freund, seid ihr gesund. Dann werden sie euch zu mir bringen. Ich werde am Tor stehen und euch empfangen, ich, Henry O’Mallon.«
Er sagte es und spuckte aus. Danach half ihm Floyd, die drei Männer zu verbinden – damit sie ihm nicht doch noch starben, sagte O’Mallon grimmig.
Clancy aber hockte auf den Brettern. Er riß das Hemd entzwei, das ihm June Crossils gegeben hatte. Es war das Hemd von Samuel Crossils, jenes Ranchers, dem er einmal geholfen hatte. Clancy dachte an die Crossils. Arme Leute, die ihm mehr Hilfe gegeben hatten als er ihnen. Er sah nur einmal hoch, weil Stacy wimmernd heranschwankte und Floyd ihn fluchend vor sich herjagte.
»Ich habe ihn unter dem Gaul herausgezogen«, berichtete Floyd bissig. »Statt sich zu bedanken, wollte er mit der linken Hand sein Messer nach mir werfen, obwohl sein rechter Arm gebrochen ist und er vor Schmerz heulte. Jetzt heult er doppelt, Clancy. Sein linker Arm ist ausgekugelt. Will auf mich werfen, der Kerl. Gleich hole ich noch Ferris, wie?«
Er ging davon und fluchte immer noch.
Clancy verband sich den Beindurchschuß. Er dachte wieder an die Crossils. Und er wußte, daß er zu ihnen gehen und seinemVater schreiben würde.
Ich werde nicht nachgeben, dachte Clancy bitter. Jahrelang habe ich gehorcht und getan, was er wollte. Aber er muß einsehen, daß es eine Grenze des Gehorsams gibt. Soll er mir mein Erbteil von Mutter auszahlen und sein Geld behalten. Soll er damit machen, was er will. Ich habe mich lange genug herumgetrieben, einmal ist damit Schluß.
Die Crossils haben genug Land, aber zu wenig Vieh. Vielleicht baue ich auf ihrem Land irgendwo eine Ranch, wenn June mich haben will. Ein anderes Girl will ich nicht. Das wird Dad einsehen müssen, oder ich gehe nie mehr nach Hause. Soll er mit dem verdammten Geld selig werden, und mit seinem verdammten Dickschädel, soll er! Wahrscheinlich liest er in der Zeitung, was hier passiert ist, ehe er meinen Brief erhält. Es ist mir gleich, was er macht, es ist mir gleich.
Es war ihm nicht gleich, aber er war nicht bereit, nachzugeben. Wenn es sein mußte, konnte er genauso dickköpfig sein wie der alte James C. Burton.
»Clancy?«
Clancy hob den Kopf. Floyd stand vor ihm, den Hut in der Hand.
»Clancy, kommst du uns mal besuchen? Meine Mutter und meine Schwester – und mich?«
»Sicher«, sagte er leise. »Sicher besuche ich euch, Floyd. Warum fragst du das, he?«
Floyd sah ihn unsicher an.
»Es ist doch vorbei«, murmelte er »Du wirst nach Hause gehen zu deinem Vater. Und dann ist alles anders. Sicher vergißt du es schnell, das Jail, die Zelle, die Lava...«
»Nein«, antwortete Clancy düster. »Ich werde nichts vergessen, nichts, Floyd. Wir werden bleiben, was wir waren. Freunde in Ketten.«
Clancy Burton schloß die Augen. Er wußte, er würde noch davon träumen, wenn er alt war. Manche Dinge vergaß ein Mann nie. Nie die Schellen, nie den Gleichschritt und niemals das Klirren der Ketten bei jedem Schritt. Und auch nie den Freund, der mit ihm diesen bitteren Weg gegangen war.
*
Das Mädchen sah hoch, als der Mann vor dem Haus anhielt. Sie war blond, schlank und braunäugig. Ihre Hände waren voller Seifenschaum. Und sie wischte sie hastig an der Schürze ab, ehe sie das Waschfaß verließ und den alten weißhaarigen Mann fragend ansah.
Der Mann saß auf einem mittelmäßigen Pferd, das einen fleckigen alten Sattel trug. Er war groß, der Fremde, hielt sich etwas gebeugt und hatte einen abgeschabten Anzug am Leib.
»Hallo«, sagte der alte Mann schnaufend. »Das ist doch hier die Ranch der Crossils, wie? Ich hörte, Sie verkaufen hier Pferde, Miß? Kann man hereinkommen?«
»Sicher«, erwiderte sie freundlich. »Sie werden etwas warten müssen, Mister. Meine Eltern sind in der Stadt, mein Bruder ist mit Clancy auf der Weide. In zwei Stunden sind sie bestimmt hier. Kommen Sie nur herein. Möchten Sie einen Kaffee, Mister?«
Er nickte, er humpelte etwas und reckte sich, ein alter Mann, der müde war. Man sah es ihm an. In der Küche setzte er sich bescheiden auf die saubere Bank und sah sich um. Er lächelte etwas, als sie fragte, wie viele Pferde er denn kaufen wollte. Dann unterhielten sie sich. Sie gab ihm Antwort auf seine Fragen nach diesem Land, nach ihren Leuten, der Arbeit, den Pferden und dem Essen, das leise vor sich hin auf dem Herd hinten kochte.
»Grüner Kohl«, sagte sie. »Es ist der letzte vom Winter. Man kocht ihn am besten vier Stunden – und ganz langsam. Wir nehmen immer geräuchertes Fleisch in den Kohl.«
»Ja«, murmelte er. »So kochte ihn meine Mutter immer. Das ist lange her, ich hab’s fast vergessen, Miß Crossils. Ob ich wohl eine Portion bekommen kann? Nachher, meine ich, wenn Ihre Leute alle hier sind. Danke für den Kaffee. Ich komme mit hinaus. Ich setze mich auf die Bank und sehe zu, wie Sie waschen.«
Er folgte ihr, setzte sich draußen auf das Holz und sah ihr zu.
Das ist ein netter alter Mann, dachte sie. Er redet so klug und freundlich...
Sie merkte nicht, wie die Zeit verging. Sie merkte auch nicht, daß sie ihm fast alles erzählte, was sie bewegte. Er lächelte ab und zu. Er lächelte auch, als ihre Eltern kamen und er mit ihrem Vater über den Ankauf von drei Pferden verhandelte. Wenig später traf ihr Bruder ein. Joe sagte, Clancy wollte noch zum Creek und nachsehen, ob sich ein paar Fische in die Reuse verirrt hätten.
Sie aßen schon, als der Hufschlag draußen tackte und June Crossils hinauslief.
Der alte, freundliche Mister im abgeschabten Anzug sagte gerade, das wäre das feinste Essen für ihn seit vierzig Jahren. Er sah auf den Teller hinab, als Clancy hereinkam und stehenblieb.
»Hallo, Clancy«, brummte Samuel Crossils. »Donner, vier Fische. Ziemlich große, was?«
Clancy sagte gar nichts. Er hielt das Netz mit den Fischen in der Hand und starrte nur auf das weiße Haar des Alten am Tisch.
»Das ist Mr. Brown, Clancy«, meinte Samuel Crossils. »Er will drei Pferde kaufen. Clancy...«
»Mr. Brown«, sagte Clancy. »So, das ist Mr. Brown. Drei Pferde wollen Sie kaufen. Was noch, Mr. Brown? Mit Geld kaufst du doch alles, wenn du willst. Aber hier.. .«
»Leg die Fische weg, setz dich hin und nimm deinen Teller«, knurrte Mr. Brown scharf, so daß sie alle zusammenfuhren. Das war nicht mehr die freundliche, sanfte Stimme. Das kam hart, scharf und grimmig. »Ein gutes Essen soll man nicht stehenlassen, verstanden? Das ist wirklich ein feines Essen. Ich will das jede Woche einmal haben, hörst du? Sie kann kochen, waschen und Socken stopfen, und sie gibt einem kluge und verständige Antworten. Meist findet man nur einen Teil davon bei den Frauen heutzutage.
Elisha Conroy könnte nicht die Hälfte davon. Sie ist eine dumme Kuh gegen dieses Mädchen. Ich war ein verdammter, elender Narr, dich jemals mit ihr verheiraten zu wollen. Setz dich hin, zum Teufel. Stellt euch vorher mal nebeneinander! Ich will sehen, wie ihr in der Größe zueinander paßt. Ah, nun los, Tochter, stell dich schon neben ihn!«
Sie starrten ihn an und saßen steif am Tisch.
»Na, was ist noch?« brummelte er. Er lachte plötzlich leise, aber doch etwas grimmig. »Weiße Haare bekommt man wegen diesem Schurken da in der Tür. Auf so einem alten Klepper muß ich reiten, meinen ältesten Anzug anziehen, der überall kneift, ich – James C. Burton. Yeah, was der kann, dieser Rod Clancy, das kann sein Vater schon lange, verstanden? Sehe mir immer die Leute an, mit denen ich etwas zu tun haben will, so ist das. Bitte um Entschuldigung, Miß Crossils.«
»Clancy«, flüsterte June und war bleich wie dieWäsche draußen auf der Leine. »Clancy, ist das – ist das...«
»Das ist mein Vater«, sagte Clancy Burton. »Ich hätte es wissen müssen. Er kennt noch einige Tricks mehr als ich.Wo hast du deinen Wagen?«
»Bei den Reegans.«
»Wo hast du ihn?«
»Der hört schlecht«, kicherte der Alte. »Bei Floyd Reegan. Nette Menschen. Feine alte Mutter hat er. Der verrückte Kerl sagt doch zu mir, er wäre auch für dich gestorben. So einen Mann wie dich gäbe es nur einmal, sagt er zu mir. Ehe wir hier wegfahren, will ich mir diesen elenden Lavabruch noch ansehen und diesen O’Mallon besuchen. Schreibt der Mensch mir einen Brief! Habe nie im Leben einen so saugroben Brief von jemand bekommen. Fragt mich dieser Mensch, ob ich überhaupt wüßte, was für einen Sohn ich hätte. Nun, stellt euch mal nebeneinander! Gut so, mächtig in Ordnung. Dein Freund Floyd kann bei uns arbeiten, seine Mutter und Schwester auch. Und diesen Crossils hier kannst du genug Rinder kaufen. Und sie kommt mit. Sie kocht wie meine gute Mutter, deine Großmutter, Junge.«
Clancy sah ihn an und schluckte. Der Vergleich mit seiner Mutter war das höchste Lob, das James C. Burton jemals vergeben konnte. Er wußte, es war jetzt entschieden.
Er würde nicht mehr der Sohn sein, der jeden Befehl auszuführen hatte. Floyd würde auf die Ranch kommen und sicher eines Tages der Vormann sein... Vormann und etwas mehr, weil sie etwas verband. Niemand würde sie sehen, wenn sie nebeneinander standen. Und doch würde sie immer da sein – die Kette aus jener gemeinsam durchlebten Hölle, die Freunde für ein ganzes Leben geschaffen hatte – Freunde in Ketten!
-