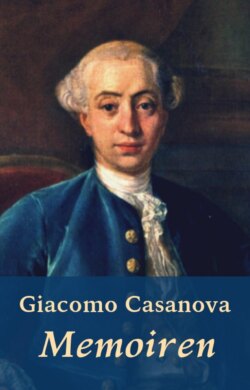Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 11
Sechstes Kapitel
ОглавлениеMein kurzer Aufenthalt in Fort Sant’ Andrea. – Mein erster galanter Denkzettel. – Genußreiche Rache und schöner Alibibeweis. – Haft des Grafen Bonafede. – Meine Entlassung aus der Haft. – Ankunft des Bischofs. – Ich verlasse Venedig
In der Festung, worin die Republik für gewöhnlich nur eine Garnison von hundert slavonischen Invaliden unterhielt, befanden sich damals zweitausend Albansen, sogenannte Cimarioten. Der Kriegsminister, in der Republik, wie ich bereits erwähnte, unter dem Titel eines Weisen der Schrift bezeichnet, hatte sie ihrer Beförderung wegen aus der Levante kommen lassen. Die Offiziere sollten imstande sein, ihre Verdienste selber geltend zu machen, um dafür ihre Belohnungen zu erhaben. Sie stammten alle aus jenem der Republik gehörigen Teile von Epirus, den man Albanien nennt. Fünfundzwanzig Jahre vorher hatten sie sich in dem letzten Kriege ausgezeichnet, den die Republik gegen die Türken führte. Sie boten mir ein neues und überraschendes Beispiel dar: ich sah achtzehn bis zwanzig alte, aber rüstige Offiziere, Gesicht und Brust, die sie in kriegerischem Stolze entblößt trugen, mit Narben bedeckt. Besonders der Oberstleutnant zeichnete sich durch seine Wunden aus, denn ihm fehlte tatsächlich ein Viertel des Kopfes. Er hatte nur ein Auge und ein Ohr, und von der Kinnlade war überhaupt nichts mehr zu sehen. Trotzdem aß und sprach er sehr gut und war von fröhlichem Humor. Bei ihm befand sich seine ganze Familie, bestehend aus zwei hübschen Mädchen, die in ihrer Landestracht besonders interessant waren, und aus sieben Söhnen, die sämtlich Soldaten waren. Er war sechs Fuß hoch, prachtvoll gewachsen, aber wegen seiner entsetzlichen Narben so häßlich von Gesicht, daß er fürchterlich anzusehen war. Trotzdem fand ich an ihm etwas so Anziehendes, daß ich ihn auf den ersten Blick liebgewann; und ich hätte mich mit ihm sehr gern unterhalten, wenn nicht sein Mund beim Sprechen einen so starken Knoblauchgeruch ausgeströmt hätte. Alle diese Albanesen hatten stets die Taschen voll davon, und eine Knoblauchzehe ist für sie ungefähr dasselbe, wie für uns ein Zuckerplätzchen. Kann man hiernach behaupten, daß dieses Kraut ein Gift sei? Die einzige medizinische Eigenschaft, die es besitzt, besteht darin, daß es den Appetit belebt, indem es einem geschwächten Magen Spannkraft gibt.
Der Oberstleutnant konnte weder lesen noch schreiben, aber er schämte sich dessen nicht; denn mit Ausnahme des Priesters und Wundarztes besaß niemand dieses Talent. Alle, Offiziere wie Soldaten, hatten die Taschen voll Gold, und mindestens die Hälfte von ihnen war verheiratet. Es befanden sich daher in der Festung fünf- oder sechshundert Frauen und ein stattlicher Nachwuchs von Kindern. Dieses für mich neue Schauspiel interessierte mich sehr. Glückliche Jugend! Ich denke an dich mit Bedauern, weil du mir oft Neues botest. Darum verabscheue ich das Alter, das mir nur immer Bekanntes bringt – allenfalls abgesehen von dem oft Unerfreulichen und Furchtbaren, was in den Zeitungen steht, aus denen ich mir damals sehr wenig machte.
In meinem Zimmer ging ich den ganzen Inhalt meines Koffers durch, legte alles zur Seite, was sich an geistlichen Kleidungsstücken darin befand, und verkaufte diese unbarmherzig an einen Juden, den ich holen ließ. Zum zweiten schickte ich an Herrn Rosa die Pfandscheine über alle von mir versetzten Sachen, mit der Bitte, alles ohne Ausnahme verkaufen zu lassen und den Überschuß mir zu schicken. Dank diesen beiden Operationen sah ich mich imstande, meinem Soldaten die elenden zehn Soldi zu überlassen, die ich täglich erhielt. Ein anderer Soldat, der früher Friseur gewesen war, nahm sich meiner Haare an, die ich nach den Vorschriften des Seminars hatte vernachlässigen müssen. Ich streifte in den Kasernen umher, um einige Zerstreuung zu suchen; die Wohnung des Majors und die des Albanesen waren meine einzigen Zufluchtsstätten, wo ich Gefühl und ein bißchen Liebe fand. Der letztere wußte bestimmt, daß sein Oberst zum Brigadegeneral ernannt werden würde, und bewarb sich daher um das Kommando des Regiments; aber es war noch ein anderer Bewerber da, und er befürchtete, daß man diesen ihm vorziehen werde. Ich hatte den Einfall, für ihn eine Eingabe zu entwerfen; sie war kurz, aber so kräftig, daß der Kriegsminister, nachdem er ihn nach dem Verfasser des Gesuchs gefragt hatte, ihm alles bewilligte, was er verlangte. Freudestrahlend kehrte der wackere Mann in die Festung zurück, preßte mich gegen seine Brust und sagte mir, sein Glück verdanke er nur mir allein; er lud mich zum Essen an seinen Familientisch, wo seine Knoblauchgerichte mir die Seele im Leibe verbrannten, und schenkte mir zwölf Bottargen Kaviar und zwei Pfund ausgezeichneten türkischen Tabak.
Die Wirkung meiner Eingabe erweckte in allen anderen Offizieren den Glauben, sie könnten nichts erreichen ohne den Beistand meiner Feder, und ich versagte dies niemandem. Darüber kam es zu Streitigkeiten, denn ich bediente gleichzeitig den Nebenbuhler eines anderen, der mich früher schon für meine Dienste bezahlt hatte. Da ich mich aber im Besitz von etwa vierzig Zechinen sah, so ließ ich sie reden; denn vor Not war ich nun geschützt. Es begegnete mir jedoch ein Ereignis, das mir sechs sehr unangenehme Wochen verschaffte.
Am zweiten April, dem bedeutungsvollen Jahrestage meines Eintrittes in diese Welt, sah ich gleich nach dem Aufstehen eine schöne Griechin bei mir eintreten. Sie sagte mir, ihr Mann sei Fähnrich und habe den größten Anspruch darauf, Leutnant zu werden; er würde es auch werden, aber sein Hauptmann sei ihm feindlich gesinnt, weil sie ihm gewisse Gefälligkeiten abgeschlagen habe, die sie nur ihrem Gatten gewähren dürfe. Sie ubergab mir seine Zeugnisse und bat mich, eine Eingabe aufzusetzen, die sie selber dem Kriegsminister überbringen würde; zum Schluß sagte sie noch, sie sei arm und könne mir meine Mühe nur mit ihrem Herzen vergelten. Ich antwortete ihr, ihr Herz dürfte nur der Preis der Liebe sein, und behandelte sie dementsprechend; ich fand keinen andern Widerstand, als wie ihn eine hübsche Frau der Form wegen stets entgegensetzt. Hierauf sagte ich ihr, sie möchte gegen Mittag zu mir kommen, dann werde das Schriftstück fertig sein. Sie kam auch und hatte nichts dagegen, mich noch ein zweitesmal zu belohnen. Endlich kam sie am Abend unter dem Vorwande, daß noch einige Verbesserungen anzubringen seien, und gab mir Gelegenheit, eine dritte Belohnung zu erhalten.
Leider gibt es keine Rosen ohne Dornen; am Morgen des dritten Tages bemerkte ich mit Entsetzen, daß eine Schlange sich unter den Blumen verborgen gehalten hatte. Durch eine sechswöchentliche Pflege und Enthaltsamkeit wurde ich vollkommen wieder hergestellt.
Als ich eines Tages meiner Griechin wieder begegnete, war ich so töricht, ihr Vorwürfe zu machen. Sie brachte mich zum Schweigen, indem sie mir lachend antwortete, sie habe mir nur gegeben, was sie selber gehabt, und ich habe unrecht getan, nicht auf meiner Hut zu sein. Der Leser kann sich kaum einen Begriff davon machen, wie mich dieses Unglück beschämte und bekümmerte; ich kam mir wie entehrt vor. Der Unfall hatte auch noch ein Erlebnis zur Folge, das dem neugierigen Leser einen Begriff geben kann, was für ein Wirbelkopf ich damals war.
Eines Morgens war die Schwägerin des Majors, Frau Vida, mit mir allein und vertraute mir in einem Augenblick süßer Selbstvergessenheit an, daß ihr Gatte sie mit seiner Eifersucht fürchterlich quäle und daß er so grausam sei, sie seit vier Jahren allein schlafen zu lassen, obgleich sie doch in der Blüte der Jahre stehe. „Gott gebe“, fuhr sie fort, „daß er von unserm Beisammensein nichts erfährt; denn dann würde ich weder aus noch ein wissen.“
Ihr Kummer schnitt mir ins Herz; ihr Vertrauen machte auch mich zutraulich; und ich beging die Tölpelei, ihr zu gestehen, in was für einen Zustand mich die grausame Griechin versetzt hätte. Ich sagte ihr, ich empfände dies um so schmerzlicher, da ich sonst glücklich gewesen wäre, ihr für die Kälte ihres eifersüchtigen Mannes Genugtuung zu verschaffen. Kaum hatte ich mit der ganzen Unschuld meines aufrichtigen Herzens diese Worte gesprochen, so stand sie auf und sagte mir in ärgerlichem und zornigem Ton, was nur eine schnöde beschimpfte, anständige Frau dem Frechen sagen kann, der sich gegen sie vergessen hat. Zerknirscht – denn ich sah sofort meinen Verstoß ein – machte ich ihr eine tiefe Verbeugung. Sie aber fuhr in demselben Tone fort und verbot mir, mich jemals wieder bei ihr sehen zu lassen; ich sei ein Geck, der gar nicht wert sei, mit einer anständigen Frau zu sprechen. Ich ging, konnte mich aber nicht enthalten, ihr noch zu sagen, daß eine anständige Frau in solchen Dingen zurückhaltender sein müsse. Indem ich über den Fall nachdachte, fand ich denn auch bald heraus, daß sie, wenn ich ihr nicht meine Schmerzen anvertraut hätte, sondern gesund gewesen wäre, sehr damit einverstanden gewesen wäre, sich von mir trösten zu lassen.
Einige Tage später hatte ich wirklich Grund, die Bekanntschaft der Griechin zu bedauern. Es war am Himmelfahrtstage, und da die Feierlichkeit mit dem Bucentoro ganz in der Nähe der Festung stattfand, so kam Herr Rosa mit der Frau Orio und ihren beiden hübschen Nichten, und ich hatte das Vergnügen, ihnen in meinen. Zimmer das Mittagessen anbieten zu können. Später war ich mit meinen Freundinnen in einer abgelegenen Kasematte ganz allein, und sie bedeckten mich mit ihren Küssen. Ich fühlte, daß sie einige Liebesbeweise von mir erwarteten; aber um ihnen nicht ein peinliches Geständnis machen zu müssen tat ich, als befürchtete ich eine Überraschung, und sie mußten sich wohl oder übel zufrieden geben.
Meiner Mutter hatte ich mit allen Einzelheiten geschrieben, was mir begegnet war, und wie der Abbate Grimani mich zu behandeln sich erlaubte; sie antwortete mir, sie habe dem Abbate geschrieben, wie es die Umstände verlangten, und sie bezweifle nicht, daß er mich würde in Freiheit setzen lassen; den Erlös der Möbel, die er durch Razzetta habe verkaufen lassen, habe Herr Grimani sich verpflichtet, als Erbteil meinem jüngsten Bruder zukommen zu lassen.
Diese letztere Zusage war eine Betrügerei; denn über dieses Erbe wurde erst dreizehn Jahre später abgerechnet, und auch das nur zum Schein. Ich werde am gelegenen Ort von diesem unglücklichen Bruder sprechen, der vor zwanzig Jahren zu Rom im Elend gestorben ist.
Mitte Juni kehrten die Cimarioten nach der Levante zurück, und es blieb in der Festung nur die gewöhnliche Besatzung. In meiner verlassenen Lage plagte mich die Langeweile dermaßen, daß ich zuweilen fürchterliche Wutanfälle bekam.
Die Hitze war sehr stark und fiel mir sehr lästig; ich mußte daher an Herrn Grimani schreiben und ihn um zwei Sommeranzüge bitten; ich bezeichnete ihm den Ort, wo sie sich befinden müßten, wenn nicht etwa Nazzetta sie verkauft hätte. Acht Tage später befand ich mich gerade beim Major, da sah ich diesen elenden Burschen eintreten und mit ihm ein Individuum, das er uns als Petrillo vorstellte, den berühmten Günstling der Kaiserin von Rußland, der von St. Petersburg komme. Statt berühmt hätte er sagen sollen niederträchtig und statt Günstling: Hanswurst.
Der Major lud sie ein, Platz zu nehmen. Razzetta nahm dem Grimanischen Gondoliere ein Paket ab und übergab es mir mit den Worten: „Da bring’ ich dir deine Lumpen.“ Ich antwortete ihm: „Der Tag wird kommen, wo ich dir deinen rigano (Galeerensträflingsjacke) bringe.“ Bei diesen Worten wagte der Kerl seinen Stock zu erheben, aber der Major wies ihn in die Schranken, indem er ihn entrüstet fragte, ob er vielleicht Lust hätte, die Nacht in der Wachtstube zu verbringen. Petrillo, der bis dahin noch nicht gesprochen hatte, sagte nun zu mir, es tue ihm leid, mich nicht in Venedig gefunden zu haben, ich hätte ihn in gewisse Häuser führen können, wo ich jedenfalls gut Bescheid wisse.
„Wir hätten wahrscheinlich deine Frau da getroffen!“ antwortete ich ihm.
„Ich verstehe mich auf Gesichter!“ versetzte er, „du wirst eines Tages gehängt werden.“
Ich zitterte vor Zorn, und der Major, dem ohne Zweifel die Bemerkungen dieser Menschen ebenso ekelhaft waren wie mir, stand auf und sagte, er habe Geschäfte. Sie gingen. Beim Abschied sagte mir der Major, er wolle am nächsten Tage sich beim Kriegsminister beschweren, und Razzetta werde für seine Unverschämtheit büßen.
Mich erfüllte die tiefste Entrüstung, und ich sann nur noch darauf, wie ich mich rächen könnte.
Das Fort war gänzlich von Wasser umgehen, und keine Schildwache konnte meine Fenster sehen. Wenn also ein Boot an diese Stelle kam, so konnte es mich während der Nacht nach Venedig bringen und vor Tagesanbruch wieder mit mir beim Fort sein. Es kam nur darauf an, einen Bootführer zu finden, der für Geld riskieren wollte, im Falle der Entdeckung auf die Galeeren zu kommen. Es kamen regelmäßig mehrere Schiffer in die Festung und brachten Lebensmittel; unter dieser suchte ich mir einen aus, dessen Gesicht mir gefiel, und versprach ihm eine Zechine; er sagte mir, er wolle den nächsten Tag mir Antwort geben. Pünktlich kam er und erklärte sich bereit. Er erzählte mir, er hätte, bevor er sich mit mir einließe, erst wissen wollen, ob ich wegen wichtiger Sachen in Haft wäre; die Frau des Majors hätte ihm aber gesagt, ich wäre nur wegen jugendlicher Streiche auf der Festung. Ich könnte daher auf ihn rechnen. Wir verabredeten hierauf, er sollte sich nach Einbruch der Nacht unter meinem Fenster einfinden und in seinem Boot einen Mast haben, der so lang wäre daß ich mich daran könnte herabgleiten lassen.
Zur verabredeten Stunde ist alles bereit; ich rutsche in das Boot hinunter, und wir fahren ab. Der Himmel war bedeckt und das Wasser stand hoch. Ich stieg beim Grabmal am slavonischen Ufer aus, indem ich dem Schiffer Befehl gab, auf mich zu warten. In eine Schifferkapuze gehüllt, ging ich geraden Weges nach San Salvatore und ließ mich von einem Kaffeehauskellner zu Razzettas Tür bringen.
Uberzeugt, daß er um diese Stunde nicht zu Hause sein werde, klingelte ich und hörte die Stimme seiner Schwester, die mir sagte: Wenn ich ihn treffen wollte, müßte ich morgens kommen. Mit dieser Auskunft war ich zufrieden; ich setzte mich nun am Fuß der Brücke nieder, um zu sehen, von welcher Seite her er die Straße betrete; kurz vor Mitternacht sah ich ihn vom Platz San Paolo her kommen. Mehr brauchte ich nicht zu wiesen; ich ging zu meinem Boot zurück und gelangte ohne jede Schwierigkeit wieder ins Fort hinein; um fünf Uhr früh konnte die ganze Garnison mich an den Wällen spazierengehen sehen.
Nachdem ich alles reiflich überlegt hatte, ergriff ich folgende Maßregeln, um in aller Sicherheit meinen Haß befriedigen und mein Alibi beweisen zu können, für den Fall, daß es mir gelänge, den Schurken totzuschlagen. Denn das war meine feste Absicht.
Am Tage vor der zur Ausführung meines Vorhabens bestimmten Nacht ging ich mit dem Sohn des Adjutanten, dem jungen Aloisio Zeno, in der Festung spazieren; er war erst zwölf Jahre alt, aber er machte mir viel Spaß durch seine Verschmitztheit. Im Jahre 1771 werde ich von ihm zu sprechen haben. Beim Spaziergang sprang ich von einer Bastion herunter und tat, als hätte ich mir dabei den Fuß verstaucht. Ich ließ mich von zwei Soldaten in mein Zimmer tragen. Der Wundarzt der Festung glaubte, ich hätte mir den Fuß verrenkt, und sagte, ich müsse zu Bett liegen bleiben; hierauf umwickelte er mir den Knöchel mit Leinwandbinden, die er in Kampferspiritus getaucht hatte. Es kamen eine Menge Leute zu mir zu Besuch, und ich verlangte, daß mein Soldat geholt würde, um die Aufwartung zu besorgen und bei mir im Zimmer zu schlafen. Ich kannte ihn und wußte, daß ein einziges Glas Branntwein genügte, um ihn betrunken zu machen und in tiefen Schlaf zu versenken.
Sobald ich ihn eingeschlafen sah, schickte ich den Wundarzt fort, desgleichen auch den Beichtvater der Festung, der über meinem Zimmer wohnte. Um halb elf Uhr bestieg ich mein Boot.
In Venedig angekommen, ging ich in einen Laden, wo ich für einen Soldo einen tüchtigen Stock kaufte. Dann setzte ich mich auf die Schwelle einer Tür am Eingang der Straße vom Platz San Paolo her. Ein kleiner Kanal, der an der Straße vorbeifloß, erschien mir wie gemacht, um meinen Feind hineinzuwerfen. Heutigen Tags ist dieser Kanal nicht mehr vorhanden.
Dreiviertel vor zwölf Uhr sehe ich meinen Mann langsamen, gemessenen Schrittes herankommen. Ich breche in eiligem Lauf aus der Straße hervor, indem ich mich dicht an die Häuser halte, so daß er mir Platz machen muß. Dann versetze ich ihm einen Schlag auf den Kopf, einen zweiten auf den Arm. Der dritte, zu dem ich besonders kräftig aushole, wirft ihn ins Wasser. Er schreit und ruft meinen Namen. Im selben Augenblick sehe ich aus einem Hause zu meiner Linken einen Furlanen herauskommen, der eine Laterne in der Hand hält. Ein Stockhieb trifft seine Hand; er läßt die Laterne fallen und die Angst macht ihm Beine. Ich werfe meinen Stock weg, fliege wie ein Pfeil über den Platz, laufe über die Brücke und erreiche mein Boot, während von allen Seiten Leute nach dem Orte eilen, wo der Lärm ist. Ich springe ins Boot; ein starker, aber günstiger Wind schwellt das Segel, das wir sofort aufspannen, und bringt mich zum Fort zurück. Im Augenblick, wo ich durch das Fenster in mein Zimmer einsteige, schlägt es Mitternacht. Schnell ziehe ich mich aus und sobald ich im Bett liege, wecke ich mit gellendem Geschrei meinen Soldaten und sage ihm, er müsse sofort den Feldscherer holen, ich sei sterbenskrank von einem Kolikanfall.
Der Beichtvater wacht von meinem Geschrei auf, kommt herunter und findet mich in Krämpfen liegen. In der Hoffnung, durch eine Latwerge mir Erleichterung zu schaffen, läuft der wackere Mann hinaus und holt mir welche. Während er aber noch Wasser besorgt, verstecke ich die Latwerge, anstatt sie einzunehmen. Nachdem ich eine halbe Stunde lang fürchterliche Gesichter geschnitten hatte, sagte ich, ich fühlte mich nun viel besser, dankte den Anwesenden und bat sie mich allein zu lassen. Dies taten sie auch, indem sie mir eine gute Nacht wünschten.
Am nächsten Morgen stand ich wegen meiner vorgeblichen Fußverrenkung nicht auf, obwohl ich ausgezeichnet geschlafen hatte. Der Major war so freundlich mich aufzusuchen, bevor er nach Venedig fuhr. Er sagte mir, an meiner Kolik sei ohne Zweifel die Melone schuld, die ich den Tag zuvor gegessen hätte.
Um ein Uhr nachmittags kam der Major wieder. „Ich habe Ihnen“, rief er lachend, „eine gute Nachsicht mitzuteilen. Razzetta ist heute nacht kräftig verprügelt und in einen Kanal geworfen worden.“
„Hat man ihn nicht totgeschlagen?“
„Nein. Aber seien Sie froh darüber, denn es würde sonst viel schlechter für Sie stehen. Man behauptet, bestimmt zu wissen, daß Sie das Verbrechen begangen haben.“
„Mir sehr angenehm, daß man das glaubt: Das ist immerhin eine gewisse Rache für mich. Aber man wird es wohl schwerlich beweisen können.“
„Freilich nicht. Indessen hat Razzetta erklärt, er habe Sie erkannt. Dasselbe behauptet der Furlane, dem Sie, wie er sagt, mit einem Stockhieb die Hand verwundet haben, so daß er seine Laterne fallen lassen mußte. Dem Razzetta ist die Nase gebrochen, ihm fehlen drei Zähne, und er hat am rechten Arm eine Quetschwunde. Sie sind beim Avogador (dem Generalstaatsanwalt) angegeben, und Herr Grimani hat sich schriftlich beim Kriegsminister beschwert, daß er Sie in Freiheit gesetzt habe, ohne ihn, Ihren Vormund, davon zu benachrichtigen. Gerade in dem Augenblick, wo er diesen Brief las, betrat ich das Bureau, und ich versicherte Seiner Exellenz, der Verdacht sei falsch; denn als ich fortgegangen, seien Sie wegen einer Sehnenverrenkung im Bett gelegen; ferner sagte ich ihm, um zwölf Uhr nachts hätten Sie einen fürchterlichen Kolikanfall gehabt.“
„Ist Razzetta um zwölf Uhr verprügelt worden?“
„So steht es in der Anzeige. Der Kriegsminister hat sofort an Herrn Grimani geschrieben, Sie hätten das Fort nicht verlassen, sondern befänden sich noch dort, und die Beschwerdeführer könnten, wenn sie wollten, Kommissare schicken, um den Sachverhalt feststellen zu lassen. Machen Sie sich also, mein lieber Abbate, auf Verhöre gefaßt.“
„Ich bin darauf gefaßt; ich werde antworten, es tue mir leid, daß ich unschuldig sei.“
Drei Tage darauf kam ein Kommissar mit einen Schreiben des Avogador, und der Prozeß war bald zu Ende. Denn da das ganze Fort von meiner Sehnenverrenkung wußte, so schworen der Kaplan, der Feldscherer, der Soldat und noch mehrere andere, die gar nichts davon wußten: um zwölf Uhr nachts sei ich zu Bett gewesen und habe einen fürchterlichen Kolikanfall gehabt. Sobald mein Alibi beweiskräftig festgestellt worden war, verurteilte der Avogador Razzetta und den Packträger zur Bezahlung aller Kosten – unter Vorbehalt meiner Rechte.
Nachdem dieses Urteil ergangen war, riet mir der Major, eine Eingabe an den Kriegsminister zu machen und darin um meine Entlassung aus der Haft zu bitten. Mein Gesuch überbrachte der Major persönlich. Ich setzte Herrn Grimani von diesem Schritt in Kenntnis, und acht Tage darauf kündigte der Major mir an, ich sei frei und er selber werde mich dem Abbate Grimani zuführen. Wir saßen bei Tische und waren gerade sehr lustig, als er mir diese Mitteilung machte. Ich glaubte nicht daran, wollte mir aber dies nicht merken lassen und sagte, um ihm ein Kompliment zu machen, sein Haus gefalle mir besser als das Leben und Treiben in Venedig, und um ihn davon zu überzeugen, wolle ich gerne noch acht Tage bleiben, wenn er das erlaube. Mit Freudenrufen nahm man mich beim Wort. Als er mir aber zwei Stunden später seine Mitteilung bestätigte, so daß ich nicht mehr daran zweifeln konnte, da tat es mir leid, daß ich ihm dummerweise acht Tage von meiner Zeit geschenkt hatte. Ich hatte jedoch nicht den Mut, mein Wort zurückzunehmen, denn die Freudenbezeigungen, besonders seiner Frau, waren so lebhaft gewesen, daß es schändlich von mir gewesen wäre, meine Zusage zu widerrufen. Die prächtige Frau wußte, daß ich ihr alles verdankte, und es wäre ihr unangenehm gewesen, wenn ich dies nicht erraten hätte.
Zu guter Letzt passierte mir auf der Festung noch ein Abenteuer, das ich nicht verschweigen zu dürfen glaube.
Am Tage nachdem der Kriegsrninister meine Freilassung verfügt hatte, betrat ein Offizier in venetianischer Uniform das Zimmer des Majors; in seiner Begleitung befand sich ein Herr von etwa sechzig Jahren, der den Degen an der Seite trug. Der Offizier übergab einen Brief mit dem Siegel des Kriegsministeriums und entfernte sich, sobald er vom Major die schriftliche Antwort darauf erhalten hatte.
Hierauf wandte sich der Major an den alten Herrn, den er als Graf anredete: er behalte ihn auf höheren Befehl in Haft und weise ihm die ganze Festung als Gefängnis an. Der Graf wollte ihm seinen Degen geben, der Major aber wies diesen mit edlem Anstand zurück und führte den Herrn in das für ihn bestimmte Zimmer. Eine Stunde darauf brachte ein Livreebedienter ihm ein Bett und einen Koffer, und am andern Morgen kam derselbe Bediente zu mir und bat mich im Namen seines Herrn, ich möchte diesem die Ehre erweisen, bei ihm zu frühstücken. Ich folgte der Einladung, und der Graf empfing mich mit den Worten: „Herr Abbate, man sprach in Venedig soviel von der Tapferkeit, womit Sie Ihr unglaubliches Alibi bewiesen haben, daß ich dem Wunsche nicht widerstehen konnte, Ihre angenehme Bekanntschaft zu machen.“
„Aber, Herr Graf, mein Alibi war vollkommen richtig, und es bedurfte daher keiner Tapferkeit, es zu beweisen. Gestatten Sie mir, Ihnen zu bemerken, daß mir ein sehr schlimmes Kompliment macht, wer daran zweifelt; denn…“
„Reden wir nicht mehr davon und verzeihen Sie mir! Da wir aber doch nun Kameraden geworden sind, so hoffe ich, Sie gönnen mir Ihre Freundschaft. Ich denke, wir frühstücken jetzt.“
Da ich während des Frühstücks dem Grafen Auskunft über meine Lebensverhältnisse gegeben hatte, vergalt er mir dies nach dem Essen mit gleichem Vertrauen und erzählte mir: „Ich bin der Graf Bonafede. In jungen Jahren diente ich unter dem Prinzen Eugen; doch verließ ich den Militärdienst und trat als Beamter in den österreichischen Verwaltungsdienst über; infolge eines Zweikampfes ging ich später nach Bayern. Dort, in München, machte ich die Bekanntschaft einer jungen Dame von Adel, entführte sie und ging mit ihr nach Venedig, wo ich sie heiratete. Seit zwanzig Jahren lebe ich hier; ich habe sechs Kinder und bin in der ganzen Stadt bekannt. Vor acht Tagen schickte ich meinen Lakai auf die flandrische Post, um meine Briefe abzuholen; man wollte sie ihm aber nicht aushändigen, weil er kein Geld bei sich hatte, um das Porto zu bezahlen. Ich ging selber hin und erklärte, ich würde das Porto am nächsten Posttag bezahlen; vergebens; ich bekam meine Briefe nicht. Hierüber aufgebracht, begebe ich mich zum Direktor der Post, Baron Taris, und beschwere mich; er antwortet mir, man habe nur auf seinen Befehl gehandelt und meine Briefe würden mir nicht ausgehändigt werden, wenn ich nicht das Porto bezahlte. Und dies sagte er in so grobem Ton, daß ich vor Entrüstung außer mir war. Da ich in seinem Hause war, besaß ich Selbstbeherrschung genug, um an mich zu halten; aber eine Viertelstunde darauf schrieb ich ihm einen Brief und verlangte Genugtuung; ich teilte ihm mit, daß ich nur noch mit dem Degen an der Seite ausgehen und daß ich, einerlei wo ich ihn träfe, ihn zwingen würde, mir Genugtuung zu geben.“
Ich bin ihm nirgends begegnet; gestern aber wurde ich vom Inquisitionssekretär angesprochen. Er sagte mir, ich müsse die Unhöflichkeiten des Barons vergessen und mich mit dem Offizier, der bei ihm wäre, als Gefangener nach dem Fort Sant’ Andrea begeben; er versicherte mir zugleich, er werde mich nur acht Tage in Haft lassen. – Ich werde also, Herr Abbate, das Vergnügen haben, diese Woche in Ihrer Gesellschaft zu verbringen.
Ich antwortete ihm: seit vierundzwanzig Stunden sei ich frei; um ihm jedoch meine Dankbarkeit für das mir erzeigte Vertrauen zu beweisen, werde ich selber die Ehre haben, ihm Gesellschaft zu leisten. – Da ich mich bereits dem Major gegenüber verpflichtet hatte, so war dies eine Anstandslüge, die sich durch die Gebote der Höflichkeit entschuldigen läßt.
Als ich nachmittags mit ihm auf dem Hauptturm des Forts war, machte ich ihn auf eine Gondel mit zwei Ruderern aufmerksam, die auf das Nebentor zusteuerte. Er sah durch sein Fernrohr und sagte mir, seine Frau und Tochter kämen zu ihm zum Besuch. Wir gingen den Damen entgegen, von denen die eine wohl die Mühen einer Entführung verlohnt haben mochte; die andere, eine junge Person von vierzehn bis sechzehn Jahren erschien mir als eine Schönheit ganz eigener Art. Sie hatte schönes hellblondes Haar, schöne blaue Augen, eine Adlernase und einen schönen Mund, dessen halboffene lachende Lippen zwei Reihen blendend weißer Zähne sehen ließen. So weiß wie die Zähne wäre auch ihr Gesicht gewesen, wenn nicht ein rosiger Hauch ihre Wangen bedeckt hätte. Ihre Taille war so dünn, daß sie unnatürlich aussah, aber ihre tadellos geformte Brust glich einem Altar, auf dem der Gott der Liebe mit Wonne den süßesten Weihrauch einatmen mußte. Ihre zur Schau gestellten Schönheiten gewannen einen ganz eigenartigen Reiz durch ihre Magerkeit; ihr Anblick setzte mich in Entzücken, und ich vermochte meine unersättlichen Augen nicht von ihnen abzuwenden. Mit der Fülle, die man an dieser Brust noch vermißte, stattete meine Phantasie sie aus. Und versenkte ich endlich meine Blicke in ihre Augen, so schien deren lachender Ausdruck mir zu sagen: warte nur noch ein oder zwei Jahre, dann wirst du alles sehen, was jetzt nur deine Phantasie dir zeigt.
Sie war elegant nach der neuesten Mode gekleidet: sie trug einen großen Reifrock und die üblichen Kleider adliger junger Mädchen, die noch nicht das Alter der Reife erlangt haben; indessen war die junge Gräfin schon heiratsfähig. Niemals hatte ich so ungeniert die Brust einer jungen Dame von Adel betrachten können; mir dünkte aber, man dürfe sich wohl eine Stelle anschauen, wo alles erst noch im Entstehen begriffen sei.
Nachdem der Graf mit der Frau Gräfin zunächst einige Worte in deutscher Sprache gewechselt hatte, stellte er mich mit den schmeichelhaftesten Ausdrücken seinen Damen vor und diese sagten mir die anmutigsten Komplimente. Der Major kam hinzu und glaubte sich verpachtet, der Gräfin die Festung zu zeigen; ich machte mir sofort meinen geringeren Rang zu nutze und bot dem Fräulein meinen Arm; der Graf ging auf sein Zimmer.
Ich verstand damals Damen nur nach dem alten venetianischen Brauche zu führen, und das Fräulein fand mich ungeschickt; ich glaubte, ihr sehr vornehm aufzuwarten, indem ich ihr meine Hand unter den Arm schob, aber sie zog ihn laut auflachend zurück. Ihre Mutter drehte sich um und fragte sie, worüber sie denn lache; ich wurde sehr verlegen, als ich sie sagen hörte, ich hätte sie gekitzelt. „Sehen Sie mal“, sagte sie, „so gibt man einer jungen Dame den Arm!“ Und damit schob sie ihre Hand durch meinen Arm, den ich gewiß sehr linkisch werde gehalten haben, denn es wurde mir nicht ganz leicht, so schnell meine Fassung wieder zu gewinnen. Sie mußte glauben, mit einem ganz tölpelhaften Neuling zu tun zu haben und nahm sich wahrscheinlich vor, sich über mich lustig zu machen, Sie sagte mir, wenn ich den Arm so krumm hielte, entfernte ich ihn zu weit von meinem Leibe und dadurch würden die richtigen Verhältnisse des Umrisses gestört. Ich sagte ihr, von Umrissen verstände ich leider nichts, und fragte sie zugleich, ob auch das Zeichnen zu ihren Talenten gehörte. „Ich lerne es“, antwortete sie, „und wenn Sie uns besuchen, zeige ich Ihnen Adam und Eva vom Kavaliere Liberi, ich habe das Bild kopiert, und die Professoren haben die Kopie für schön erklärt, ohne zu wissen, daß sie von mir war.“
„Warum verbargen Sie Ihren Namen?“
„Weil die beiden Figuren zu nackt sind.“
„Nach Ihrem Adam bin ich nicht sehr neugierig, aber Ihre Eva würde ich mit Vergnügen sehen, und ich werde Ihr Geheimnis nicht verraten.“
Hierüber lachte sie wieder, und wieder drehte ihre Mutter sich um. Ich spielte den Tölpel absichtlich seit dem Augenblick, wo sie mich lehren wollte, wie man den Arm gibt, denn ich sah sofort, daß ihre falsche Auffassung von meiner Person mir nützlich werben konnte.
Da sie mich für einen Idioten hielt, glaubte sie mir sagen zu können, sie finde ihren Adam viel schöner als ihre Eva; denn sie habe nichts ausgelassen und man könne jeden Muskel unterscheiden, während an der Eva nichts zu sehen sei.
„Aber ich versichere Ihnen, gerade sie wird mich interessieren.“
„Nein, glauben Sie mir, Adam wird Ihnen besser gefallen.“
Diese Unterhaltung hatte mich sehr aufgeregt. Ich trug wegen der starken Hitze Leinwandhosen… ich fürchtete, die Mutter und der Major, die nur ein paar Schritte uns voraus waren, könnten sich umdrehen… ich ging wie aus Dornen. Um meine Verlegenheit auf den Höhepunkt zu bringen, rutschte der jungen Dame infolge eines Fehltritts der eine Hacken aus dem Schuh. Sie streckt ihren hübschen Fuß vor und bittet mich, ihr den Schuh wieder anzuziehen. Ich lasse mich auf ein Knie nieder, und sie hebt, gewiß ohne sich etwas dabei zu denken, ein wenig den Rock hoch… sie trug einen großen Reifrock und keinen Unterrock… dies genügte, um mich wie tot umsinken zu lassen. Als ich wieder aufstand, fragte sie mich, ob mir unwohl sei.
Als wir gleich daraus aus einer Kasernatte herauskamen, bat sie mich, ihre Frisur, die etwas in Unordnung geraten war, ihr wieder zu ordnen. Da sie dabei den Kopf niederbeugen mußte, konnte mein Zustand ihr nicht mehr verborgen bleiben. Um mir über die Verlegenheit hinwegzuhelfen, fragte sie mich, wer mir mein Uhrband gearbeitet hätte; ich sagte ihr, es sei ein Geschenk meiner Schwester. Sie bat mich, es ihr zu zeigen, als ich ihr aber antwortete, es sei an der Westentasche festgemacht, wollte sie dies nicht glauben; ich sagte ihr, sie könne sich selber davon überzeugen; sie streckte die Hand aus, und mit einer unwillkürlichen, aber unter den Umständen erklärlichen Bewegung wurde ich indiskret. Offenbar nahm sie mir das übel, denn sie sah, daß sie mich falsch beurteilt hatte; sie wurde schüchtern und getraute sich nicht mehr zu lachen. Wir begaben uns zu ihrer Mutter und dem Major, der uns in einer Gruft den Sarg des Marschalls von der Schulenburg zeigte. Dieser war dort einstweilen niedergesetzt, bis das Mausoleum fertig wäre. Mich peinigte die Ungewißheit, ob das Benehmen des jungen Mädchens völlig absichtslos gewesen sei, ob ich durch zu großen Rückhalt oder zu sichtbaren Ausdruck des von ihr entflammten Verlangens gefehlt und sie beleidigt hätte, ob ich also noch weiter zu gehen oder ob ich gut zu machen habe. Mir war’s, als sei ich der erste Schuldige, der ihre Tugend beunruhigt habe, und ich würde zu allem bereit gewesen sein, wenn man mir ein Mittel angegeben hätte, mein Vergehen wieder gutzumachen.
So fein war damals mein Zartgefühl; immerhin kam auch die hohe Meinung in Betracht, die ich von der durch mich beleidigten Person hatte, und in dieser hohen Meinung täuschte ich mich möglicherweise. Ich muß gestehen, die Zeit hat nach und nach dieses Zartgefühl gänzlich zerstört; trotzdem glaube ich nicht schlechter zu sein als andere, die ebenso alt sind wie ich und ebensoviel Erfahrung haben.
Wir begaben uns hierauf zum Grafen zurück, und der Rest des Tages verging ziemlich traurig. Gegen Abend fuhren die Damen wieder ab, nachdem die Mutter mir das Versprechen abgenommen hatte, sie in Venedig zu besuchen.
Das junge Fräulein, das ich beschimpft zu haben glaubte, hinterließ mir einen so starken Eindruck, daß ich sieben Tage in der größten Ungeduld verbrachte; aber ich konnte es nur deshalb nicht erwarten, sie wiederzusehen, weil ich sie um Verzeihung bitten und sie von meiner Reue überzeugen wollte.
Am anderen Tage besuchte den Grafen sein ältester Sohn. Er war häßlich, aber von edlem Anstand und sehr bescheidener Denkungsart. Fünfundzwanzig Jahre später fand ich ihn als Kadetten in der Garde des Königs von Spanien. Er hatte zwanzig Jahre als einfacher Gardist gedient, um diesen geringen Grad zu erreichen. Ich werde an Ort und Stelle von ihm sprechen; einstweilen will ich nur erwähnen, daß er in Madrid behauptete, mich niemals gekannt zu haben. Seine Eitelkeit bedurfte dieser Lüge, wegen deren er mir leid tat.
Am Morgen des achten Tages wurde der Graf aus der Festung entlassen, am Abend desselben Tages verließ auch ich sie, indem ich mit dem Major verabredete, daß wir uns in einem Kaffeehause am Markusplatz treffen wollten, um zusammen zum Abbate Grimani zu gehen. Ich verabschiedete mich von seiner Gattin, deren Andenken mir ewig teuer sein wird, und sie sagte mir: „Ich danke Ihnen, daß Sie alles so gut gemacht hatten, um Ihr Alibi zu beweisen; aber danken Sie auch mir, daß ich so gescheit war, Sie vollkommen zu durchschauen. Mein Mann hat alles erst später erfahren.“
In Venedig angelangt, ging ich zu Frau Orio, wo man mich herzlich willkommen hieß. Ich aß bei ihnen zu Abend und meine reizenden beiden Freundinnen – die es am liebsten gesehen hätten, wenn der Bischof unterwegs gestorben wäre – schenkten mir die köstlichste Gastfreundschaft.
Am nächsten Mittag ging ich mit dem Major, der sich pünktlich am verabredeten Ort eingefunden hatte, zum Abbate Grimani. Er empfing mich mit der Miene eines Schuldbewußten, der um Verzeihung bittet, und seine Dummheit machte mich ganz verlegen, als er mich bat, ich möchte doch Razzetta und dem Furlanen verzeihen; sie hätten sich geirrt. Hierauf sagte er mir, der Bischof werde in den allernächsten Tagen eintreffen; er, der Abbate, habe mir ein Zimmer anweisen lassen, und ich könne an seinem Tische speisen. Dann ging der Major mit mir zu dem geistreichen Herrn Valavero, der nicht mehr Kriegsminister war, denn sein Halbjahr war abgelaufen. Ich bezeigte ihm meinen ehrfurchtsvollen Dank, und wir unterhielten uns über allerlei gleichgültige Dinge, bis der Major aufbrach. Sobald wir allein waren, bat er mich, ihm zu gestehen, daß ich Razzetta verprügelt hätte. Ich räumte dies unumwunden ein, und er lachte recht herzlich über meine Erzählung des ganzen Hergangs. Er stellte fest, daß ich meinen Streich nicht um Mitternacht hätte ausführen können; daher müßten sich die Dummköpfe bei ihrer Anschuldigung getäuscht haben; übrigens hätte es aber für mich dessen gar nicht bedurft, um mein Alibi zu beweisen; denn da meine Sehnenverrenkung für echt galt, so hätte diese bereits genügt.
Der Leser wird wohl nicht vergessen haben, daß ich eine große Last auf dem Herzen hatte; es lag mir in der Tat sehr viel daran, diese loszuwerden. Ich mußte die Göttin aller meiner Gedanken sehen und meine Verzeihung von ihr erlangen oder zu ihren Füßen sterben.
Ohne Mühe fand ich ihr Haus; der Graf war nicht anwesend. Die gnädige Frau empfing mich auf das zuvorkommendste; aber ihr Anblick setzte mich so in Erstaunen, daß ich nicht wußte, was ich ihr sagen sollte.
Ich glaubte, ich würde einen Engel sehen, würde ihn in einem Paradiese finden – und ich sah nichts weiter als einen großen Saal, dessen Ausschmückung in vier wurmstichigen Holzstühlen und einem sehr schmutzigen Tische bestand. Es herrschte tiefe Dämmerung in dem Saal, denn die Fensterläden waren beinahe ganz geschlossen. Dies hätte geschehen sein können, um die Hitze abzuhalten; aber ich sah, daß man sie nur deshalb geschlossen hatte, um zu verbergen, daß alle Fensterscheiben zerbrochen waren. Trotz dem trüben Licht konnte ich bemerken, daß die Frau Gräfin in ein zerlumptes Kleid gehüllt, und daß ihr Hemd nichts weniger als sauber war. Als sie meine Zerstreutheit bemerkte, ließ sie mich allein, indem sie sagte, sie werde mir ihre Tochter schicken; einen Augenblick darauf trat diese mit edlem und leichtem Anstand ein und sagte mir, sie hätte mich mit Ungeduld erwartet, aber nicht zu dieser Stunde, wo sie sonst niemanden zu empfangen pflege.
Ich war um eine Antwort verlegen, denn es kam mir vor, als sei sie nicht sie selbst. In ihrem elenden Hauskleid erschien sie mir beinahe häßlich, und ich wunderte mich, wie sie im Fort einen so starken Eindruck auf mich hatte machen können. Als sie in meinen Zügen die Überraschung las, die ich empfand, erriet sie einen Teil der Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, und ich sah auf ihrem Gesicht keinen Verdruß, wohl aber einen Schmerz, der mir weh tat. Hätte sie philosophisch denken können oder hätte sie gewagt dies zu tun, so würde sie das Recht gehabt haben, in mir einen Menschen zu verachten, der sich für sie nur wegen ihrer schönen Kleider oder wegen einer falschen Vorstellung von ihrem adligen Stande oder ihrem Vermögen interessiert hatte. Aber sie versuchte es mit Aufrichtigkeit, um mir über meine Verlegenheit hinwegzuhelfen. Sie fühlte mit Bestimmtheit, daß das Gefühl zu ihren Gunsten sprechen würde, wenn es ihr gelänge, die richtige Saite anzuschlagen.
„Ich sehe, sie sind überrascht, Herr Abbate“, sagte sie; „und ich weiß recht wohl warum! Sie haben ohne Zweifel Prunk und Glanz zu finden erwartet, und Sie finden nur augenscheinliches Elend. Die Regierung gibt meinem Vater nur ein geringes Jahrgeld, und wir sind neun Menschen. Da wir jeden Feiertag zur Kirche gehen müssen, und zwar in Kleidern, wie sie unserm Stande entsprechen, so sind wir oft gezwungen, aufs Essen zu verzichten, um die Kleider auslösen zu können, die wir aus Not haben versetzen müssen. Am nächsten Tag bringen wir sie wieder ins Leihhaus. Wenn der Pfarrer uns nicht bei der Messe sähe, würde er unsere Namen aus der Liste der Almosenempfänger der Armenbrüderschaft streichen; von diesem Almosen aber leben wir.“
Welch eine Erzählung! Sie erriet, was in mir vorging. Das Gefühl hatte mich überwältigt, aber es hatte mich mehr mit Beschämung als mit Rührung erfüllt. Da ich nicht reich war und keine Liebe mehr verspürte, so wurde ich kälter als Eis und stieß einen tiefen Seufzer aus. Weil jedoch ihre Lage mir Kummer machte, so antwortete ich ihr als ehrlicher Mensch, indem ich ihr sanft zuredete und ihr meine Teilnahme bezeigte.
„Wäre ich reich“, sagte ich, „so würde ich Ihnen leicht beweisen, daß Sie Ihr Unglück keinem Fühllosen und Undankbaren anvertraut haben; aber ich bin es nicht, und da ich unmittelbar vor der Abreise stehe, so kann ich Ihnen nicht einmal mit meiner Freundschaft nützlich werden.“ Hierauf nahm ich meine Zuflucht zu Gemeinplätzen und sagte ihr, ich gäbe die Hoffnung nicht auf, daß sie dank ihren Reizen ihr Glück machen würde.
„Das kann wohl sein“, antwortete sie in nachdenklichem Ton, „nur muß derjenige, auf den sie etwa Wirkung üben, wissen, daß sie untrennbar sind von meinen Gefühlen; er muß sich meinem Gefühl anpassen, und er wird mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, auf die ich Anspruch habe. Ich wünsche nichts weiter als eine rechtmäßige Ehe; auf Adel und Reichtum erhebe ich keinen Anspruch; was es mit dem Adel auf sich hat, das weiß ich, und den Reichtum kann ich entbehren, denn ich bin seit langer Zeit an Dürftigkeit gewöhnt, ja ich habe mich sogar, was nicht leicht zu begreifen ist, ohne das Notwendige behelfen müssen. Aber wir wollen uns meine Zeichnungen ansehen!“
„Sie sind sehr gütig, mein gnädiges Fräulein!“
An ihre Zeichnungen hatte ich ja gar nicht mehr gedacht, und ihre Eva interessierte mich nicht mehr. Ich folgte ihr.
Ich betrat eine Kammer, worin sich ein Stuhl, ein kleiner Spiegel und ein ungemachtes Bett befanden; in diesem sah man die untere Seite des umgestülpten Strohsacks; vielleicht sollte dadurch der Eindruck erweckt werden, daß Bettücher vorhanden wären. Aber besonders abstoßend wirkte auf mich ein gewisser Geruch, dessen Ursache ganz frisch war. Wäre ich noch verliebt gewesen, so hätte dieses Gegenmittel genügt, um mich augenblicklich völlig zu heilen. Ich fühlte nur noch das Bedürfnis, mich zu entfernen, und niemals wiederzukommen, und es tat mir leid, daß ich nicht eine Handvoll Dukaten auf den Tisch werfen konnte; dadurch hätte sich mein Gewissen befreit gefühlt.
Die arme junge Dame legte mir ihre Zeichnungen vor, sie schienen mir schön zu sein, und ich lobte sie, aber ich hielt mich nicht bei ihrer Eva auf und scherzte auch nicht über ihren Adam, was, wäre mein Geist anders aufgestutzt gewesen, geschehen sein würde. Aus Höflichkeit fragte ich sie leichthin, warum sie sich denn nicht ihr Talent zu nutze machte. Sie könnte doch Pastell malen lernen.
„Das möchte ich gerne“, antwortete sie, „aber eine einzige Schachtel Farben kostet zwei Zechinen.“
„Werden Sie mir verzeihen, wenn ich’s wage, Ihnen sechs anzubieten?“
„Ach, ich nehme sie dankbar an, und ich bin glücklich, diese Verpflichtung gegen Sie zu haben.“
Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und wendete sich ab, um sie mir zu verbergen. Diesen Augenblick benutzte ich, um das Geld auf den Tisch zu legen. Um ihr über ein Gefühl der Demütigung hinwegzuhelfen und gleichsam aus Höflichkeit gab ich ihr einen Kuß auf den Mund; sie sollte meine Mäßigung auf Rechnung der Achtung schreiben, die sie mir eingeflößt hatte; im übrigen stand es bei ihr, meinen Kuß als eine Zärtlichkeit aufzufassen oder nicht. Ich verabschiedete mich von ihr mit dem Versprechen, ich würde wiederkommen, um ihren Vater zu besuchen. Ich habe nicht Wort gehalten. Der Leser wird sehen, in welcher Lage ich sie zehn Jahre später wiedersah.
Mit welchen Betrachtungen verließ ich das Haus! Welch eine Lehre hatte ich empfangen! Ich verglich Wirklichkeit und Einbildung, und ich sah mich gezwungen, der Einbildung den höheren Rang zuzuweisen; denn die Wirklichkeit hängt stets von der Phantasie ab. Schon damals fühlte ich dunkel, was mir später klar und deutlich geworden ist: daß Liebe nur eine mehr oder weniger lebhafte Neugier ist, wozu noch der von der Natur in uns gelegte Trieb hinzukommt, für die Erhaltung der Art zu sorgen. Die Frau ist wie ein Buch, das immer, mag es gut oder schlecht sein, zunächst durch das Titelblatt gefallen muß. Wenn dieses nicht interessant ist, so erweckt es keine Lust zum Lesen; und diese Lust steht genau im Verhältnis zu dem erweckten Interesse. Das Titelblatt der Frau ist genau wie das eines Buches von oben bis unten zu lesen; ihre Füße, für die jeder, der meinen Geschmack teilt, sich interessiert, besitzen dieselbe Anziehungskraft wie der Druckvermerk eines Buches. Wenn die meisten Liebhaber den Füßen einer Frau nur geringe oder gar keine Aufmerksamkeit schenken, so machen auch die meisten Leser sich nichts aus der Ausgabe eines Buches. Jedenfalls haben die Frauen recht, daß sie große Sorgfalt auf ihr Gesicht, ihre Kleidung und ihre Haltung verwenden, denn dadurch können sie alle, die nicht von der Natur bei ihrer Geburt mit Blindheit begnadet worden sind, neugierig darauf machen, sie zu lesen. Wie nun Leute, die viel gelesen haben, schließlich immer neue Bücher lesen wollen, und wären es auch schlechte, so wird ein Mann, der viele Frauen und lauter schöne Frauen gekannt hat, zuletzt auch auf die häßlichen neugierig, wenn sie nur für ihn neu sind. Wenn auch sein Auge deutlich die Schminke sieht, die ihm die Wirklichkeit verhehlt, so redet ihm doch seine zu einem Laster gewordene Leidenschaft allerlei zugunsten des falschen Titelblattes ein. Vielleicht, sagt er sich, ist das Werk besser als der Titel; vielleicht ist die Wirklichkeit besser als die Schminke, die sie mir verbirgt. Er versucht nun das Buch zu überfliegen; aber dieses ist noch nicht durchgeblättert worden, und er findet Widerstand; das lebende Buch will nach Regel und Ordnung gelesen sein, und der Lesewütige wird ein Opfer der Koketterie, jenes Ungeheuers, das alle verfolgt, die aus der Liebe die Aufgabe ihres Lebens machen.
Verständiger Leser, der du diese letzten Zeilen, die Apollo selbst meiner Feder eingeflößt, gelesen hast, gestatte mir, dir etwas zu sagen: Du bist verloren, du wirst bis zu den letzten Augenblicken ein Opfer des schönen Geschlechts bleiben, wenn diese Zeilen nicht dazu beitragen, dir die Täuschung zu benehmen. Wenn meine Aufrichtigkeit für dich nichts Anstößiges hat, so mache ich dir mein Kompliment.
Gegen Abend machte ich einen Besuch bei Frau Orio, um bei dieser Gelegenheit ihren reizenden Nichten zu sagen, daß ich bei Grimani wohne und nicht gleich in den nächsten Tagen außerhalb des Hauses schlafen könne. Ich traf bei ihnen den treuen alten Rosa, der mir sagte, man spreche in der ganzen Stadt nur von meinem Alibi, und dieses könne nur dadurch so berühmt geworden sein, daß man allgemein von seiner Falschheit überzeugt sei; ich müßte daher von seiten Razzettas eine Rache gleicher Art befürchten, und ich würde gut tun, auf meiner Hut zu sein, besonders nachts. Ich fühlte, wie gut der Rat des klugen alten Herrn war, und ging infolgedessen nur noch in Begleitung aus oder ich nahm eine Gondel. Frau Manzoni lobte mich sehr; sie sagte, die Gerechtigkeit habe mich freisprechen müssen, aber die öffentliche Meinung wisse wohl, woran sie sich zu halten habe, und Razzetta könne mir nicht verziehen haben.
Drei oder vier Tage darauf meldete Grimani mir die Ankunft des Bischofs. Er wohnte bei seinen Ordensbrüdern im Minimitenkloster San Francesco di Paola. Er brachte mich selber zum Prälaten wie ein hochgeschätztes Juwel, und er tat, wie wenn nur er es zeigen könnte.
Ich sah einen schönen Mönch, der sein Bischofskreuz auf der Brust trug. Er erinnerte mich an den Vater Mancia; doch sah er kräftiger aus und weniger zurückhaltend. Er war vierunddreißig Jahre alt und war Bischof durch die Gnade Gottes, des Heiligen Stuhles und meiner Mutter. Nachdem er mir seinen Segen gegeben hatte, den ich kniend empfing, reichte er mir die Hand zum Kusse und drückte mich an seine Brust, indem er mich auf lateinisch seinen lieben Sohn nannte; auch später bediente er sich mir gegenüber nur dieser Sprache. Ich dachte, er schäme sich wahrscheinlich italienisch zu sprechen, weil er Calabreser sei; aber er befreite mich von diesem Irrtum, indem er Herrn Grimani auf italienisch anredete. Er sagte mir, er könne mich nicht von Venedig aus mit sich nehmen, ich müsse mich nach Rom begeben. Herr Grimani werde mir die nötigen Weisungen geben; in Ancona werde ich von einem seiner Freunde, dem Minimitenmönch Lazari, seine Adresse erfahren, und dieser werde mir auch das Reisegeld geben. „Sobald Sie in Rom sind“, fuhr er fort, „werden wir uns nicht mehr trennen und werden über Neapel zusammen nach Martorano reisen. Kommen Sie morgen in aller Frühe zu mir. Sobald ich die Messe gelesen habe, frühstücken wir miteinander. Übermorgen reise ich ab.“
Auf dem Heimwege hielt mir Herr Grimani eine Moralpredigt, bei deren Anhören ich zehnmal beinahe laut herausgeplatzt wäre. Unter anderem warnte er mich vor allzu eifrigem Studium; denn in der dicken Luft Calabriens könne ich durch zu große geistige Anstrengung leicht schwindsüchtig werden.
Am nächsten Tage begab ich mich schon in der Morgendämmerung zum Bischof. Nach der Messe und dem Schokoladenfrühstück nahm er mich drei Stunden ins Gebet, ich bemerkte klar und deutlich, daß ich ihm durchaus nicht gefallen hatte; aber ich meinerseits war mit ihm zufrieden. Er schien mir ein Ehrenmann zu sein; übrigens fühlte ich mich für ihn eingenommen, da ich durch ihn auf den Weg zu den hohen Würden der Kirche gebracht werden sollte, denn damals hatte ich nicht das geringste Selbstvertrauen, obwohl ich von meiner Persönlichkeit einen guten Begriff hatte.
Nach der Abreise des guten Bischofs übergab Herr Grimani mir einen von diesem zurückgelassenen Brief, den ich dem Vater Lazari im Minimitenkloster der Stadt Ancona überbringen sollte. Abbate Grimani sagte mir, er würde mich bis Ancona im Gefolge des venetianischen Gesandten befördern, dessen Abreise unmittelbar bevorstehe. Ich mußte mich also bereit halten, und da ich es eilig hatte, aus seinen Händen herauszukommen, so fand ich alle Vorbereitungen ausgezeichnet.
Sobald ich den für die Abreise des Gesandten, Cavaliere da Lezze, und seines Gefolges festgesetzten Tag erfuhr, nahm ich Abschied von allen meinen Bekannten. Meinen Bruder Francesco ließ ich in der Schule des berühmten Dekorationsmalers Joli zurück.
Da die Peote, in der ich mich einschiffen sollte, erst mit Tagesanbruch abfuhr, so verbrachte ich die Nacht bei meinen beiden Engeln, die diesmal keine Hoffnung mehr hatten, mich wiederzusehen. Ich wußte natürlich nicht, was mir bevorstand; ich überließ mich meinem Geschick und hielt es für überflüssige Mühe an die Zukunft zu denken. So verging uns die Nacht zwischen Freude und Trauer, zwischen Wonnen und Tränen. Beim Abschied gab ich ihnen den Schlüssel zurück, den ich hatte anfertigen lassen und der mir so süße Augenblicke verschafft hatte.
Diese Liebe, meine erste, lehrte mich fast nichts Neues, das mir in der Schule der Welt hätte zugute kommen können, denn sie war vollkommen glücklich, durch keine Sorge gestört und durch keine selbstsüchtige Regung getrübt. Oft fühlten wir alle drei das Bedürfnis, unsere Seelen zur ewigen Vorsehung zu erheben, um ihr für den stets gegenwärtigen Schutz zu danken, durch den sie jeden Unfall, der unseren holden Frieden hätte stören können, von uns fern gehalten hatte.
Ich hinterließ bei Frau Manzoni alle meine Papiere und alle verbotenen Bücher, die ich besaß. Die prächtige Frau, die zwanzig Jahre älter war als ich und an das Schicksal glaubte, in dessen großem Buche sie gerne blätterte, sagte mir lachend, sie wisse bestimmt, daß sie mir alles, was ich ihr hinterlasse, spätestens im Laufe des nächsten Jahres zurückgeben werde. Ihre Weissagungen verwunderten mich und machten mir Vergnügen; und da ich große Achtung für sie hegte, so schien mir, ich müsse selber dazu helfen, daß die Prophezeiungen in Erfüllung gingen. Übrigens gab ihr diesen Blick in die Zukunft weder Aberglaube noch ein inhaltsloses Vorgefühl, das stets von der Vernunft zu verdammen ist, sondern ihre Kenntnis von der Welt und von dem Charakter derjenigen, für die sie sich interessierte. Sie lachte darüber, daß sie sich niemals irrte.
An der Piazetta schiffte ich mich ein. Herr Grimani hatte mir am Tage vorher zehn Zechinen gegeben, die nach seiner Meinung für die im Lazarett zu Ancona abzumachende Quarantainezeit genügen müßten. Sowie ich das Lazarett verlassen hatte, könne es mir unmöglich an dem nötigen Gelde fehlen. Da die Herren ihrer Sache so gewiß waren, so mußte ich wohl ihre Sicherheit teilen; in meiner Sorglosigkeit dachte ich denn auch gar nicht weiter darüber nach. Allerdings gab mir auch der Inhalt meiner Börse, von dem kein Mensch etwas wußte, eine gewisse Zuversicht: vierzig schöne Zechinen erhöhten beträchtlich meinen jungen Mut. So verließ ich denn meine Heimat mit freudigem Herzen und ohne das geringste Bedauern.
Die Packträger und Dienstmänner in Venedig stammen größtenteils aus dem Friaul.