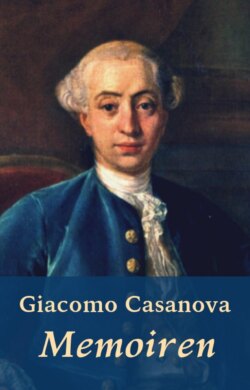Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 7
Zweites Kapitel
ОглавлениеMeine Großmutter gibt mich dem Doktor Gozzi in Pension – Meine erste zärtliche Bekanntschaft
Sobald ich mit der Slavonierin allein war, führte sie mich auf den Dachboden, wo sie mir mein Bett zeigte, das in einer Reihe mit vier anderen stand; von diesen waren drei für drei Knaben meines Alters bestimmt, die in diesem Augenblick in der Schule waren; das vierte gehörte der Magd, die den Auftrag hatte aufzupassen, daß wir uns nicht den üblichen kleinen Schülerausschweifungen hingäben. Nach diesem Besuch gingen wir wieder hinunter, und sie führte mich in den Garten; dort könnte ich bis zum Mittagessen spazierengehen, sagte sie.
Ich war weder glücklich noch unglücklich; ich sagte kein Wort. Ich empfand gar nichts, weder Furcht, noch Hoffnung, noch Neugier; ich war weder lustig noch traurig. Anstößig war mir nur das Gesicht der Hausherrin; denn obwohl ich keinen Begriff von Schönheit oder Häßlichkeit hatte, so stieß mich doch alles an ihr ab: ihr Gesicht, der Ausdruck ihrer Miene, ihr Ton und ihre Sprache. Ihre männlichen Gesichtszüge brachten mich jedesmal in Verwirrung, so oft ich sie ansah, um zu hören, was sie mir sagte. Sie war groß und breit wie ein Soldat; sie hatte eine gelbe Hautfarbe, schwarze Haare, lange dichte Augenbrauen und ihr Kinn war mit etlichen langen Barthaaren geschmückt. Um dies Bildnis zu vervollständigen, will ich noch erwähnen, daß ein häßlicher, von Runzeln durchfurchter, halbentblößter Busen ihr bis zur Hälfte ihres langen Oberkörpers herabhing; sie mochte etwa fünfzig Jahre alt sein. Die Magd war eine dicke Bäuerin, die für alle Verrichtungen angenommen war, und der sogenannte Garten war ein Viereck von dreißig zu vierzig Schritt, an dem nichts Angenehmes war außer der grünen Farbe.
Gegen Mittag sah ich meine drei Kameraden ankommen, die mir, wie wenn wir alte Bekannte gewesen wären, sehr viel erzählten; sie setzten bei mir Vorkenntnisse voraus, die ich nicht besaß. Ich antwortete ihnen nicht, aber dadurch ließen sie sich nicht aus der Fassung bringen; schließlich nötigten sie mich an ihren unschuldigen Vergnügungen mich zu beteiligen. Es handelte sich um Wettlaufen, Huckepackreiten, Kobolzschießen, und ich ließ mich in alle diese Wunder recht gerne einweihen, bis wir zum Essen gerufen wurden. Ich setzte mich zu Tisch; als ich aber einen Holzlöffel vor mir sah, stieß ich diesen zurück und verlangte mein silbernes Besteck, das ich sehr liebte, weil es ein Geschenk meiner guten Großmutter war. Die Magd antwortete mir, die Hausfrau wolle, daß wir alle gleich seien, und ich müsse mich dem Brauch fügen; dies tat ich denn auch, obwohl es mir mißfiel; ich begann wie die anderen die Suppe aus der Schüssel zu löffeln, ohne mich über die Schnelligkeit zu beklagen, womit meine Kameraden aßen, doch nicht ohne mich zu wundern, daß so etwas erlaubt sei.
Nach der sehr schlechten Suppe bekamen wir eine kleine Portion gedörrten Stockfisch, hierauf einen Apfel, und damit war das Mittagessen zu Ende; wir befanden uns in der Fastenzeit. Wir hatten keine Gläser oder Becher, sondern tranken alle aus demselben irdenen Krug ein elendes Getränk, das man Craspia nennt; es wird zubereitet, indem man entkernte Weinbeeren in Wasser kocht. Die folgenden Tage trank ich nur reines Wasser. Das Essen überraschte mich, denn ich wußte nicht, ob es mir erlaubt wäre, es schlecht zu finden.
Nach Tisch führte mich die Magd in die Schule zu einem jungen Priester, namens Doktor Gozzi; mit ihm hatte die Slavonierin verabredet, ihm monatlich vierzig Soldi zu bezahlen, das ist der elfte Teil einer Zechine.
Da ich erst schreiben lernen mußte, wurde ich zu den fünf- bis sechsjährigen Kindern gesetzt, die sich sofort über mich lustig machten.
Wieder ins Haus meiner Slavonierin zurückgekehrt, erhielt ich mein Abendessen, das natürlich noch schlechter war als die Mittagsmahlzeit. Ich war erstaunt, daß es mir nicht erlaubt war, mich darüber zu beklagen. Man legte mich in ein Bett, wo ich wegen des Ungeziefers der genugsam bekannten drei Arten kein Auge zutun konnte. Außerdem jagten die Ratten, die überall herumliefen und auf mein Bett sprangen, mir eine Angst ein, daß mir das Blut in den Adern erstarrte. In dieser Nacht empfand ich zum erstenmal, was Unglück ist, und lernte es mit Geduld ertragen.
Die Insekten, die mich verzehrten, verminderten die Angst, die ich vor den Ratten hatte; und zum Ausgleich machte mich die Angst weniger empfindlich gegen die Bisse. Meiner Seele kam dieser Widerstreit meiner Leiden zu statten. Die Magd war völlig taub gegen mein Geschrei.
Sobald der Tag zu grauen begann, verließ ich mein trauriges Lager, und nachdem ich mich bei dem Mädchen ein bißchen über alle die ausgestandenen Leiden beklagt hatte, verlangte ich von ihr ein Hemd, denn das meinige war ekelhaft anzusehen. Sie antwortete mir aber, das Hemd werde nur Sonntags gewechselt, und lachte mich aus, als ich ihr drohte, ich würde mich bei der Hausfrau beklagen.
Zum erstenmal in meinem Leben weinte ich vor Kummer und Zorn, als ich meine Kameraden mich verspotten hörte; die Unglücklichen waren in derselben Lage wie ich, aber sie waren daran gewöhnt. Damit ist alles gesagt.
Von Traurigkeit niedergeschmettert, schlief ich in der Schule den ganzen Vormittag. Einer meiner Kameraden sagte dem Doktor den Grund hierfür, aber nur in der Absicht, mich lächerlich zu machen. Der junge Priester aber, den ohne Zweifel die Vorsehung für mich ausgesucht hatte, ließ mich in sein Kabinett kommen. Nachdem er alles angehört und sich mit eigenen Augen von der Wahrheit meiner Erzählung überzeugt hatte, wurde er ganz bewegt, als er die Beulen sah, von denen meine unschuldige Haut bedeckt war. Schnell legte er seinen Mantel an, führte mich nach meiner Pension und zeigte der Unholdin, in welchem Zustand ich mich befand. Diese spielte die Erstaunte und schob alle Schuld auf die Magd. Sie mußte jedoch dem dringenden Wunsche des Priesters nachgeben, ihm mein Bett zu zeigen; da war ich denn nicht weniger erstaunt als er, als ich sah, wie schmutzig die Tücher waren, in denen ich die schreckliche Nacht verbracht hatte. Das verdammte Weib gab immer noch der Magd die Schuld und erklärte, sie werde sie aus dem Hause jagen; diese aber, die in demselben Augenblick dazukam, wollte sich den Tadel nicht gefallen lassen und sagte ihr gerade ins Gesicht, sie habe selber schuld; und indem sie gleichzeitig die Betten der anderen Knaben aufdeckte, konnten wir uns überzeugen, daß sie nicht besser dran waren als ich. Wütend gab ihre Herrin ihr sofort eine Ohrfeige; die Magd aber wollte diese nicht auf sich sitzen lassen, gab ihr eine wieder und ergriff die Flucht. Der Doktor ließ mich bei der Alten und ging, indem er ihr sagte, er würde mich nicht eher wieder in seine Schule aufnehmen, als bis ich ebenso sauber wäre wie die anderen Schüler. Ich mußte nun kräftige Schelte über mich ergehen lassen, die in die Drohung ausklang, sie würde mich aus dem Hause werfen, wenn ich ihr noch einmal eine derartige Schererei bereitete.
Das verstand ich nicht. Ich war wie ein neugeborenes Kind; ich kannte nur das Haus, in dem ich geboren und aufgewachsen war und worin Sauberkeit und ein anständiger Überfluß herrschten. Ich sah mich mißhandelt, ausgescholten, obwohl mir dünkte, ich könnte doch ganz unmöglich schuldig sein. Endlich warf die Megäre mir ein Hemd an den Kopf; eine Stunde später sah ich eine neue Magd frische Betttücher auflegen, und wir aßen zu Mittag.
Mein Lehrer ließ es sich ganz besonders angelegen sein, mich zu unterrichten. Er wies mir einen Platz an seinem eigenen Tisch an, und um ihm zu zeigen, daß ich diese Auszeichnung zu schätzen wisse, strengte ich alle meine Kräfte an, um etwas zu lernen; nach Verlauf eines Monats schrieb ich denn auch schon so gut, daß er mich zur Grammatik übergehen ließ.
Das neue Leben, das ich führte, der Hunger, den ich leiden mußte, und zweifelsohne mehr als dies alles die Luft von Padua gaben mir eine Gesundheit, von der ich früher keinen Begriff gehabt hatte. Aber grade diese gute Gesundheit machte für mich den Hunger, den ich ausstehen mußte, um so bitterer: er war geradezu unerträglich geworden. Ich wuchs sichtbar; ich hatte allnächtlich einen neunstündigen tiefen Schlaf, den niemals ein anderer Traum störte, als daß es mir vorkam, ich säße an einer reichbesetzten Tafel und wäre damit beschäftigt, meinen grimmigen Hunger zu stillen; aber jeden Morgen empfand ich dann, wie unangenehm solche schmeichlerischen Träume sind. Dieser verzehrende Hunger würde mich schließlich völlig erschöpft haben, hätte ich mich nicht entschlossen, alles was ich irgendwo an eßbaren Sachen finden könnte, mir anzueignen und zu verzehren, so oft ich nur sicher wäre, nicht dabei gesehen zu werden.
Not macht erfinderisch. Ich hatte in einem Küchenschrank etwa fünfzig geräucherte Heringe bemerkt; diese verspeiste ich nach und nach sämtlich; desgleichen alle Würste, die im Rauchfang hingen. Um dies unbemerkt tun zu können, stand ich nachts auf und schlich auf den Zehenspitzen im Hause herum. Alle frischgelegten Eier, deren ich im Hühnerhof habhaft werden konnte, schlürfte ich noch warm hinunter; sie waren für mich die köstlichste Speise. Um etwas zum Essen zu finden, machte ich sogar Beutezüge in die Küche meines Lehrers.
Die Slavonierin war in Verzweiflung, niemals einen der Diebe entdecken zu können, und warf eine Magd nach der anderen aus dem Hause. Trotz alledem war ich mager wie ein Gerippe, da sich nicht jederzeit eine Gelegenheit zum Stehlen fand.
In vier oder fünf Monaten machte ich so schnelle Fortschritte, daß der Doktor mich zum Dekurio der Schule ernannte. Ich hatte die Aufgaben meiner dreißig Mitschüler durchzusehen, ihre Fehler zu verbessern und dem Lehrer mit Lob oder Tadel Bericht zu erstatten. Meine Strenge dauerte aber nicht lange, denn die Faulpelze kamen bald hinter das Geheimnis, mich milde zu stimmen. Wenn ihr Latein von Fehlern wimmelte, gewannen sie meine Nachsicht mittels gebratener Rippchen oder Hühnchen; oft gaben sie mir sogar Geld. Dies erweckte meine Habgier oder vielmehr meine Leckerhaftigkeit; denn von nun an besteuerte ich nicht nur die Unwissenden, sondern ich wurde zum Tyrannen und weigerte mein Lob denen, die es verdienten, sobald sie sich’s einfallen ließen, den von mir beanspruchten Zoll weigern zu wollen. Meine Ungerechtigkeit wurde ihnen unerträglich, und sie verklagten mich beim Lehrer, der mich absetzte, als er mich der Erpressung überführt sah. Nach dieser Absetzung wäre es mir gewiß sehr schlecht gegangen, wenn nicht das Schicksal bald nachher meiner grausamen Leidensschule ein Ende gemacht hätte.
Der Doktor, der mich lieb hatte, nahm mich eines Tages mit in sein Kabinett und fragte mich unter vier Augen, ob ich bereit sei, die Schritte zu tun, die er mir anraten wolle, um aus der Pension der Slavonierin herauszukommen und bei ihm einzutreten. Da er mich von seinem Vorschlag entzückt fand, ließ er mich drei Briefe abschreiben, die ich an den Abbate Grimani, an meinen Freund Baffo und an meine Großmutter sandte. Da das Halbjahr zu Ende ging und meine Mutter sich damals nicht in Venedig aufhielt, war keine Zeit zu verlieren. In diesen Briefen entwarf ich eine Schilderung aller meiner Leiden und erklärte, ich würde bald sterben, wenn man mich nicht aus den Händen der Slavonierin befreite und mich meinem Schullehrer übergäbe, der bereit wäre, mich bei sich aufzunehmen, dafür jedoch monatlich zwei Zechinen beanspruchte.
Herr Grimani antwortete mir gar nicht, sondern ließ mich durch seinen Freund Ottaviani ausschelten, daß ich mich hätte verführen lassen. Herr Baffo aber ging zu meiner Großmutter, die nicht schreiben konnte, besprach die Sache mit ihr und meldete mir in einem Brief, in ein paar Tagen würde ich glücklich sein. Und wirklich kam acht Tage darauf die ausgezeichnete Frau, die mich bis an ihr Lebensende liebgehabt hat, nach Padua und zwar gerade in dem Augenblick, als ich mich zu Tisch setzen wollte, um zu Mittag zu essen. Sie trat mit der Hausfrau zusammen ins Zimmer und sobald ich sie erblickte, fiel ich ihr um den Hals und weinte strömende Tränen, in die sie sogleich auch die ihrigen mischte. Als sie dann saß und mich auf ihren Schoß genommen hatte, fühlte ich meinen Mut wieder erwachen und zählte ihr im Beisein der Slavonierin alle meine Qualen auf; nachdem ich ihr den Bettlertisch gezeigt hatte, an dem ich mich sattessen sollte, führte ich sie an mein Bett. Zum Schluß bat ich sie, sie möchte mich mit sich zum Essen nehmen, nachdem ich sechs Monate lang gehungert und geschmachtet hätte. Die Slavonierin ließ sich das nicht anfechten; sie sagte nur, mehr könnte sie für das Geld, das man ihr gäbe, nicht tun. Da hatte sie recht; aber wer zwang sie, ein Kosthaus zu halten, um die Kinder hinzumorden, die der Geiz ihr anvertraute und die doch der Nahrung bedurften?
Meine Großmutter bedeutete ihr in aller Ruhe, sie werde mich mitnehmen, und sagte ihr, sie möchte alle meine Kleider in meinen Koffer packen. Entzückt, mein silbernes Besteck wiederzusehen, ergriff ich es und steckte es schnell in die Tasche. Zum ersten Male fühlte ich die Macht der Zufriedenheit, die den, der sie empfindet, zu Verzeihung und zum Vergessen alles Ungemachs nötigt.
Meine Großmutter führte mich in die Herberge, wo sie wohnte, und wir speisten zu Mittag. Aber sie aß fast gar nichts vor Erstaunen über meine Gefräßigkeit. Unterdessen kam der Doktor Gozzi, den sie hatte benachrichtigen lassen, und seine Erscheinung stimmte sie zu seinen Gunsten. Er war ein schöner Priester von sechsundzwanzig Jahren, rundlich, bescheiden und von ehrerbietigem Wesen. In einer Viertelstunde war alles abgemacht. Die gute Großmutter zählte ihm vierundzwanzig Zechinen für Kostgeld auf ein Jahr im voraus und ließ sich Quittung darüber geben, zunächst aber behielt sie mich drei Tage bei sich, um mich als Abbate zu kleiden und mir eine Perücke machen zu lassen; denn wegen meiner Unsauberkeit mußte sie mir die Haare abschneiden lassen.
Nach Ablauf dieser drei Tage brachte sie mich selber zum Doktor, um mich dessen Mutter zu empfehlen. Diese sagte ihr sofort, sie möchte mir ein Bett schicken oder in Padua eins für mich kaufen. Der Doktor sagte ihr aber, ich würde bei ihm in seinem sehr breiten Bett schlafen; für diese Güte war ihm meine Großmutter sehr dankbar. Hierauf geleiteten wir sie zum Burchiello, mit dem sie nach Venedig zurückreisen wollte.
Die Familie des Doktors Gozzi bestand aus seiner Mutter, die großen Respekt vor ihm hatte, weil sie als einfache Bäuerin sich nicht für würdig hielt, einen Priester und gar einen Doktor zum Sohn zu haben; sie war häßlich, alt und zänkisch. Ferner aus seinem Vater, einem Schuster, der den ganzen Tag arbeitete und niemals, auch bei Tische nicht, ein Wort sprach. Gesellig wurde er nur an den Feiertagen, die er regelmäßig mit seinen Freunden in der Schenke verbrachte, aus der er um Mitternacht, den Tasso singend und so betrunken, daß er sich nicht auf den Beinen halten konnte, nach Hause kam. War er in diesem Zustand, so wollte der gute Mann durchaus nicht ins Bett, und er wurde brutal, wenn man ihn dazu zwingen wollte. Er hatte nur soviel Vernunft und Geist, wie der Wein ihm verlieh; denn wenn er nüchtern war, konnte er nicht mal die unbedeutendsten Familienangelegenheiten behandeln, und seine Frau sagte, er würde sie nie geheiratet haben, wenn man nicht zur Vorsicht ihn tüchtig hätte frühstücken lassen, ehe sie zur Kirche gingen.
Doktor Gozzi hatte auch eine dreizehnjährige Schwester, Bettina; sie war hübsch, lustig und eine große Romanleserin. Vater und Mutter zankten beständig mit ihr, weil sie sich so oft am Fenster sehen ließe, und der Doktor schalt sie wegen ihrer Lesewut. Das Mädchen gefiel mir sofort, ohne daß ich wußte warum. Sie schleuderte dann später in mein Herz die ersten Funken einer Leidenschaft, die in der Folge meine herrschende wurde.
Sechs Monate nach meinem Eintritt in das Haus hatte der Doktor keine Schüler mehr; denn alle verließen ihn, weil ich der einzige Gegenstand seiner Zuneigung geworden war. Dies brachte ihn zu dem Entschlusse, ein kleines Institut einzurichten, indem er junge Schüler in Kost nähme; aber es dauerte zwei Jahre, bis ihm dieser Plan gelang. Während dieser Zeit teilte er mir alles mit, was er wußte, und das war allerdings nicht viel, doch aber genügend, mich in alle Wissenschaften einzuführen. Er lehrte mich auch Violine spielen; eine Kunst, die ich mir später unter Umständen, von denen der Leser noch hören wird, zunutze machen mußte. Der gute Doktor, der ganz und gar kein Philosoph war, ließ mich die Logik der Peripatetiker und die Kosmographie des alten Ptolomäischen Systems lernen, über das ich mich beständig lustig machte, indem ich ihn durch Lehrsätze auf die er nie zu antworten wußte, zur Verzweiflung brachte. Übrigens waren seine Sitten untadelhaft, und in religiösen Dingen war er sehr streng, obgleich er kein Frömmler war. Da alles für ihn Glaubensartikel war, so fand er nichts schwer zu begreifen. Nach seiner Meinung hatte die Sintflut die ganze Erde bedeckt; vor dieser Katastrophe wurden die Menschen tausend Jahre alt und Gott unterhielt sich mit ihnen in Gesprächen; Noah hatte in hundert Jahren die Arche gebaut, und die Erde hing unbeweglich im Mittelpunkt des Weltalls, das Gott aus dem Nichts erschaffen hatte. Als ich ihm sagte und bewies, daß das Vorhandensein des Nichts ein Unsinn wäre, fiel er mir ins Wort und sagte, ich sei ein Dummkopf.
Er liebte ein gutes Bett, seinen Schoppen Wein und Fröhlichkeit im Familienkreise. Dagegen liebte er weder Schöngeister, noch Witzworte, noch Kritik, denn diese wird leicht zur bösen Nachrede; er lachte über die Dummheit der Leute, die sich mit Zeitunglesen abgäben; denn die Zeitungen, sagte er, lögen immer und wiederholten ewig dasselbe. Er sagte, nichts sei so lästig wie Ungewißheit, und darum verdammte er das Denken, weil aus diesem der Zweifel entspringe.
Seine Hauptleidenschaft war Predigen; dabei kam ihm nämlich Gesicht und Stimme zustatten. Seine Zuhörerschaft bestand denn auch nur aus Frauen; trotzdem war er ein geschworener Weiberfeind, und er sah niemals einer ins Gesicht, wenn er mit ihr sprechen mußte. Die fleischliche Sünde war nach seiner Meinung die allergrößte; deshalb ärgerte er sich, wenn ich ihm sagte, daß gerade diese nur die allerkleinste sein könne. Seine Predigten waren gespickt mit Zitaten aus der griechischen Literatur, die er aber ins Lateinische übersetzte. Als ich mich eines Tages erkeckte, ihm zu sagen, er müßte sie ins Italienische übersetzen, weil die Frauen Latein ebensowenig verständen wie Griechisch, da wurde er so böse, daß ich niemals wieder den Mut fand, hierüber mit ihm zu sprechen. Übrigens rühmte er mich seinen Freunden als ein Wunderkind, weil ich ganz allein, ohne andere Beihilfe als die Grammatik, die griechischen Schriftsteller lesen gelernt hatte.
In der Fastenzeit des Jahres 1736 schrieb meine Mutter dem Doktor, sie müsse bald nach Petersburg abreisen und wünsche mich vorher noch einmal zu sehen; er möge daher auf drei oder vier Tage mit mir nach Venedig kommen. Diese Einladung machte ihn nachdenklich, denn er hatte niemals Venedig gesehen und auch noch nie in guter Gesellschaft verkehrt; trotzdem wollte er aber auch nicht als Neuling erscheinen. Sobald wir unsere Reisevorbereitungen getroffen hatten, begleitete die ganze Familie uns zum Burchiello.
Meine Mutter empfing ihn mit dem edelsten Anstande; da sie aber schön war wie der Tag, so war mein armer Lehrer in großer Verlegenheit; denn er wagte ihr nicht ins Gesicht zu sehen und mußte sich doch mit ihr unterhalten. Sie merkte dies und beschloß sich gelegentlich einen Spaß mit ihm zu machen. Ich selber erregte die Aufmerksamkeit aller Bekannten und Verwandten; als sie mich früher kannten, war ich beinahe blödsinnig gewesen, darum war jeder erstaunt, daß ich in der kurzen Zeit von zwei Jahren mich so sehr herausgemacht hatte. Dem Doktor war es eine Wonne zu sehen, daß man ihm das ganze Verdienst meiner Umwandlung beimaß.
Das erste, woran meine Mutter Anstoß nahm, war meine blonde Perücke, die schreiend von meinem braunen Gesicht abstach und gar nicht zu meinen Augenbrauen und zu meinen schwarzen Augen passen wollte. Der Doktor, den sie fragte, warum er mir denn nicht meine eigenen Haare frisieren lasse, antwortete ihr: dank der Perücke könne seine Schwester mich leichter sauber halten. Über diese naive Antwort erhob sich allgemeines Gelächter, das sich verdoppelte als auf die Frage, ob seine Schwester verheiratet sei, ich das Wort ergriff und an seiner Stelle erwiderte, Bettina sei das hübscheste Mädchen im ganzen Viertel und erst vierzehn Jahre alt. Als nun meine Mutter dem Doktor sagte, sie werde seiner Schwester ein schönes Geschenk machen, doch nur unter der Bedingung, daß sie mir meine Haare frisiere, da versprach er ihr, es solle nach ihrem Willen geschehen. Meine Mutter ließ einen Perückenmacher holen, der mir eine zu meiner Gesichtsfarbe passende Perücke brachte.
Da die ganze Gesellschaft mit Ausnahme des Doktors sich jetzt an die Spieltische setzte, so suchte ich meine Brüder auf, die bei meiner Großmutter im Zimmer waren. Francesco zeigte mir Architekturzeichnungen, die ich mit Gönnermiene für leidlich erklärte; Giovanni zeigte mir nichts, und ich fand ihn sehr unbedeutend. Die anderen waren noch sehr jung.
Beim Abendessen benahm der Doktor, der neben meiner Mutter saß, sich sehr linkisch. Er würde wahrscheinlich kein Sterbenswörtchen gesagt haben, hätte nicht ein anwesender, englischer Gelehrter ihn lateinisch angesprochen; da er jedoch nichts verstanden hatte, antwortete er bescheiden, er könne nicht englisch, worüber große Heiterkeit entstand. Herr Baffo half uns aus der Verlegenheit, indem er uns sagte, daß die Engländer das Lateinische läsen und aussprächen wie ihre eigene Sprache. Hierauf bemerkte ich: darin hätten die Engländer ebenso unrecht, wie wir unrecht haben würden, wenn wir ihre Sprache nach den für das Lateinische gültigen Regeln aussprechen wollten. Der Engländer fand meine Bemerkung ausgezeichnet und schrieb sofort ein bekanntes altes Distichon nieder, das er mir zu lesen gab:
Dicite, grammatici, cur mascula nornina cunnus,
Et cur femineum mentula nomen habet?
Sagt, ihr Grammatiker, mir, warum ist ein männliches Hauptwort
Cunnus? Und sagt mir, warum weiblich die Mentula ist?
Nachdem ich es laut gelesen hatte, rief ich aus: „Das ist allerdings richtiges Latein!“ – „Das wissen wir“, sagte meine Mutter, „aber du mußt es uns übersetzen.“ – „Es zu übersetzen genügt nicht“, antwortete ich, „es ist eine Frage, auf die ich antworten will.“ Und nachdem ich einen Augenblick nachgedacht hatte, schrieb ich folgenden Pentameter:
Disce quod a domino nomina servus habet.
Wisse, es muß nach dem Herrn immer sich richten der Knecht.
Dies war meine erste literarische Leistung; und ich kann sagen, dieser Augenblick streute in meine Seele den Samen der Begier nach literarischem Ruhm; denn das Beifallsklatschen erhob mich auf den Gipfel des Glückes. Der Engländer war höchst erstaunt; er sagte, so etwas hätte noch niemals ein elfjähriger Knabe geleistet; dann umarmte er mich mehrere Male und schenkte mir seine Uhr. Meine Mutter fragte Herrn Grimani neugierig, was denn die Verse bedeuteten; da aber der Abbate nicht mehr davon verstanden hatte als sie selber, sagte Herr Baffo es ihr leise ins Ohr. Überrascht über meine Kenntnisse stand sie auf, holte eine goldene Uhr und reichte sie meinem Lehrer. Nun wußte dieser nicht, wie er sich benehmen sollte, um ihr seine große Dankbarkeit zu bezeigen, und dadurch wurde der Auftritt sehr komisch. Um ihm alle Komplimente zu ersparen, reichte meine Mutter ihm ihre Wange; er brauchte ihr nur zwei Küsse zu geben – in guter Gesellschaft das einfachste und unbedeutendste Ding von der Welt. Aber der arme Mann stand wie auf glühenden Kohlen und war so aus der Fassung gebracht, daß er, glaube ich, lieber gestorben wäre als ihr die Küsse gegeben hätte. Gesenkten Hauptes trat er zurück, und man ließ ihn in Ruhe, bis wir zu Bett gingen.
Sobald wir in unserem Zimmer allein waren, schüttete er mir sein Herz aus. Er sagte mir, es sei schade, daß er in Padua weder das Distichon noch meine Antwort bekanntmachen könnte.
„Und warum nicht.“
„Weil es eine Schmutzerei ist.“
„Aber eine erhabene.“
„Wir wollen zu Bette gehen und nicht mehr davon reden. Deine Antwort ist wunderbar, weil du weder die Sachkenntnis haben kannst, noch auch Verse machen gelernt hast.“
Die Sachkenntnis besaß ich nun freilich doch, in der Theorie nämlich; denn ich hatte heimlich Meursius gelesen, und zwar gerade, weil er mir das verboten hatte. Aber er war mit Recht darüber erstaunt, daß ich Verse machen konnte; denn er selber, der mich die Prosodie gelehrt hatte, konnte niemals einen Vers zustande bringen.
Nemo dat quod non habet – Niemand kann geben, was er selber nicht hat – ist ein Lehrsatz, der in geistigen Dingen keine Geltung hat.
Vier Tage darauf gab mir bei unserer Abreise meine Mutter ein Paket für Bettina, und Abbate Grimani schenkte mir vier Zechinen, um mir Bücher zu kaufen. Eine Woche später reiste meine Mutter nach St. Petersburg.
Als wir wieder in Padua waren, sprach mein guter Lehrer drei oder vier Monate lang tagtäglich und bei jeder Gelegenheit immerzu von meiner Mutter. Bettina, die in dem Paket fünf Ellen schwarze Glanzseide und zwölf Paar Handschuhe gefunden hatte, faßte eine große Neigung zu mir und nahm sich mit solcher Sorgfalt meiner Haare an, daß ich nach sechs Monaten meine Perücke ablegen konnte. Jeden Tag kam sie zu mir, um mich zu kämmen, und oft geschah dies, ehe ich noch aufgestanden war; sie sagte, sie habe keine Zeit solange zu warten, bis ich aufgestanden sei. Sie wusch mir Gesicht, Hals, Brust; sie erwies mir kindliche Liebkosungen, die ich für unschuldig erachtete und die mich gegen mich selber aufbrachten, weil sie mich aufregten. Da ich drei Jahre jünger war als sie, so schien mir, sie könne sich wohl gar nichts dabei denken, wenn sie mich liebkoste, und es ärgerte mich, daß ich mir etwas dabei dachte. Wenn sie auf meinem Bette sitzend mir sagte, ich nähme zu, und sich mit Händen davon überzeugte, so regte sie mich sehr heftig auf; ich ließ sie aber ruhig gewähren, weil ich befürchtete, sie könnte meine Erregung bemerken. Und wenn sie mir sagte, ich hätte eine zarte Haut, und mich dabei kitzelte, mußte ich mich zurückbeugen; dann ärgerte ich mich über mich selber, daß ich’s nicht wagte, es mit ihr ebenso zu machen, zugleich aber freute ich mich, daß sie nicht merkte, wie große Lust ich dazu hatte. Wenn ich angezogen war, gab sie mir die süßesten Küsse und nannte mich ihr liebes Kind; so große Lust ich aber auch hatte, ihr Beispiel zu befolgen, so wagte ich es doch noch nicht. Als dann jedoch später Bettina sich über meine Schüchternheit lustig machte, faßte ich Mut und gab ihr ihre Küsse noch kräftiger zurück; doch hörte ich stets auf, sobald ich die Lust verspürte weiter zu gehen. Ich drehte den Kopf zur Seite, als ob ich irgend etwas suchte, und sie entfernte sich. Sobald sie zur Tür hinaus war, war ich in Verzweiflung darüber, daß ich nicht meinem Naturtrieb gefolgt war. Ich war erstaunt, daß Bettina, ohne sich aufzuregen, alles mit mir machen konnte, wozu sie Lust hatte, während es mich die größte Mühe kostete, nicht weiter zu gehen, und ich nahm mir jedesmal vor, von nun an solle es anders werden.
Zu Anfang des Herbstes bekam der Doktor drei neue Pfleglinge; einer von diesen, der fünfzehn Jahre alt war, schien mir in weniger als einem Monat mit Bettina auf sehr gutem Fuß zu stehen. Diese Wahrnehmung erweckte in mir ein Gefühl, wovon ich bis dahin keinen Begriff gehabt hatte und dessen Wesen ich auch erst mehrere Jahre später mir klarmachte. Es war weder Eifersucht, noch Entrüstung, sondern eine edle Verachtung, die ich nicht glaubte unterdrücken zu dürfen, denn Cordiam war unwissend, ungeschliffen, geistlos, unerzogen, der Sohn eines gewöhnlichen Bauern und in keiner Weise imstande, einen Vergleich mit mir auszuhalten; denn er hatte vor mir weiter nichts voraus, als daß er schon in mannbarem Alter war; er schien mir nicht danach angetan, mir vorgezogen zu werden; mein erwachendes Selbstgefühl sagte mir, daß ich besser sei als er. Ein Gefühl von Stolz mit Verachtung gemischt erhob sich in mir gegen Bettina, die ich liebte, ohne es zu wissen. Sie merkte es an der Art und Weise, wie ich ihre Liebkosungen aufnahm, wenn sie mich in meinem Bett frisierte: ich stieß ihre Hand zurück und antwortete nicht mehr auf ihre Küsse. Eines Tages fragte sie mich, warum ich denn gegen sie so sei; es ärgerte sie, daß ich keinen Grund angeben wollte, und sie sagte mir mit einer Miene, wie wenn ich ihr leid täte: ich sei eifersüchtig auf Cordiani. Dieser Vorwurf erschien mir als eine erniedrigende Verleumdung; ich antwortete ihr: meiner Meinung nach sei Cordiani ihrer würdig, wie sie seiner. Sie ging lächelnd hinaus; aber indem sie nachdachte, wie sie sich rächen könnte, fand sie, daß dies nur geschehen könnte, indem sie mich eifersüchtig machte. Diesen Zweck konnte sie freilich nicht erreichen, ohne mich verliebt zu machen. Das fing sie folgendermaßen an:
Eines Morgens kam sie an mein Bett und brachte mir ein paar weiße Strümpfe, die sie für mich gestrickt hatte. Nachdem sie mein Haar in Ordnung gebracht hatte, sagte sie, sie müsse mir die Strümpfe selber anpassen, um zu sehen, was daran verkehrt sei, und um sich bei den anderen, die sie mir noch machen wollte, danach zu richten. Der Doktor war ausgegangen, um seine Messe zu lesen. Während sie mir die Strümpfe anzog, sagte sie, meine Beine seien unsauber, und ohne mich erst um Erlaubnis zu fragen, fing sie sofort an sie zu waschen. Ich hätte mich geschämt, ihr irgendwelche Scham zu zeigen; darum ließ ich sie gewähren, zumal da ich nicht voraussah, was noch kommen sollte. Auf meinem Bett sitzend, trieb Bettina ihren Reinlichkeitseifer zu weit, und ihre Neugier verursachte mir solche Wollust, daß diese nicht eher aufhörte, als bis sie nicht weiter gehen konnte. Nachdem ich wieder ruhig geworden war, fühlte ich mich als den schuldigen Teil und hielt mich für verpflichtet, sie um Verzeihung zu bitten. Dies hatte sie nicht erwartet; sie dachte einen Augenblick nach und sagte mir dann in gütigem Ton, sie selber habe schuld, aber es solle nicht wieder vorkommen. Hierauf ging sie und überließ mich meinen Gedanken.
Diese waren bitter! Ich bildete mir ein, ich hätte sie entehrt, hätte das Vertrauen ihrer Familie getäuscht, die heiligen Gesetze der Gastfreundschaft verletzt, mit einem Wort: ich hätte ein furchtbares Verbrechen begangen, das ich nur dadurch wieder gutmachen könnte, daß ich sie heiratete – das heißt, wenn Bettina sich überhaupt entschließen könnte, einen ihrer unwürdigen schamlosen Menschen zum Gatten zu nehmen.
Diesen Betrachtungen folgte eine düstre Traurigkeit; die von zu Tag schlimmer wurde, da Bettina überhaupt nicht mehr zu mir ans Bett kam. Während der ersten acht Tage erschien die Zurückhaltung des Mädchens mir vernünftig, und meine Traurigkeit hätte bald den Charakter einer idealen Liebe angenommen, wenn nicht ihr Verhalten Cordiani gegenüber in meine Seele das Gift der Eifersucht geträufelt hätte, obgleich ich nicht im entferntesten daran dachte, sie könne etwa mit ihm dieselbe Sünde begangen haben wie mit mir.
Aus gewissen Gründen nahm ich an, Bettina hätte damals wohl gewußt, was sie tat, und käme nur deshalb nicht wieder, weil sie es jetzt bereute. Dies schmeichelte meiner Eitelkeit; denn nun nahm ich an, sie sei in mich verliebt. In diesen falschen Ideen befangen, entschloß ich mich, sie brieflich zu ermutigen.
Ich entwarf ein Briefchen; es war nur kurz, genügte aber, um sie zu beruhigen, falls sie sich schuldig fühlte oder falls sie mir etwa andere Gefühle zutraute, als ihr Selbstbewußtsein sie verlangen mußte. Mein Brief schien mir ein Meisterwerk zu sein und mehr als hinreichend, um zu bewirken, daß sie mich anbetete und mir den Vorzug vor Cordiani gäbe, der nach meiner Meinung kaum der Mensch war, sie nur einen Augenblick in der Wahl zwischen ihm und mir schwanken zu lassen. Eine halbe Stunde nach Empfang des Briefes antwortete sie mir mündlich, sie würde am nächsten Morgen wieder wie früher in mein Zimmer kommen. Aber ich erwartete sie vergeblich. Ich war empört darüber; wie groß aber war nicht mein Erstaunen, als sie bei Tisch mich fragte, ob ich mich nicht von ihr als Mädchen verkleiden lassen wollte, um den Ball zu besuchen, den einer unserer Nachbarn, der Arzt Olivo, fünf oder sechs Tage später zu geben gedachte. Da alle Anwesenden diesen Vorschlag vortrefflich fanden, so willigte ich ein. Ich erblickte hierin eine günstige Gelegenheit, eine Aussprache zu haben, uns gegenseitig zu rechtfertigen und wieder vertraute Freunde zu werden, ohne daß wir eine Uberraschung infolge fleischlicher Schwachheit befürchten müßten. Aber nun kam etwas dazwischen, und es entwickelte sich eine richtige Tragikomödie.
Ein alter, wohlhabender Pate des Doktor, der auf dem Lande wohnte, glaubte nämlich nach langer Krankheit dem Ende nahe zu sein und schickte ihm einen Wagen mit der Bitte, er und sein Vater möchten unverzüglich zu ihm kommen, damit sie bei seinem Tode zugegen wären und seine Seele Gott empföhlen. Der alte Schuster leerte zunächst eine Flasche, zog dann seinen Sonntagsrock an und machte sich mit seinem Sohne auf den Weg.
Diese Gelegenheit schien mir günstig, und ich gedachte, sie auszunützen, zumal da es für meine Ungeduld bis zum Ballabend noch viel zu lange hin war. Es gelang mir Bettina zu sagen, ich würde die Tür meines Zimmers nach dem Korridor zu offen lassen und ich erwartete sie, sobald alle anderen zu Bett wären. Sie antwortete, sie werde bestimmt kommen. Sie schlief im Erdgeschoß in einer Kammer, die nur durch eine einfache Scheidewand von der Schlafkammer ihres Vaters getrennt war. Der Doktor war verreist; ich schlief also allein im großen Zimmer. Die drei Pensionäre hatten einen Saal, der für sich lag; ich hatte also kein Hindernis zu befürchten und ich war entzückt, daß endlich der ersehnte Augenblick da war.
Kaum war ich in meinem Zimmer, so schob ich den Riegel vor und öffnete die nach dem Korridor führende Tür, so daß Bettina sie nur aufzustoßen brauchte, um eintreten zu können. Dann löschte ich mein Licht, zog mich aber nicht aus.
Wenn man in einem Roman derartige Situationen beschrieben findet, scheinen sie einem übertrieben. Aber das ist nicht der Fall, und Ariostos Beschreibung von Ruggiero, wie er auf Alcina wartet, ist ein schönes Bildnis nach der Natur.
Ich wartete bis Mitternacht, ohne mich zu beunruhigen. Als ich aber die zweite, die dritte, die vierte Morgenstunde verstreichen sah, ohne daß Bettina erschien, da erhitzte sich mein Blut, und ich wurde wütend. Der Schnee fiel in dicken Flocken, aber ich litt noch mehr von meinem Zorn als von der Kälte. Eine Stunde vor Tagesanbruch konnte ich meine Ungeduld nicht mehr bemeistern; ich entschloß mich, ohne Schuhe hinunterzugehen, um den Hund nicht aufzuwecken, und mich unten auf die Treppe zu setzen, die nur vier Schritt von Bettinas Tür entfernt war. Wäre Bettina nicht in ihrer Kammer gewesen, so hätte diese Tür offen sein müssen. Ich ging auf die Tür zu und fand sie geschlossen; und da sie nur von innen verschließbar war, so dachte ich mir, Bettina müsse eingeschlafen sein. Ich wollte anklopfen, tat es aber nicht, weil ich fürchtete, der Hund könnte aufwachen. Von dieser Tür bis zu Bettinas Kammertür waren noch zehn bis zwölf Schritt. Von Kummer erdrückt und nicht wissend, wozu ich mich entschließen sollte, setzte ich mich auf die unterste Treppenstufe; kurz vor Tagesanbruch aber war ich so niedergeschlagen, so erstarrt und vor Kälte schlotternd, daß ich mich entschloß, wieder in mein Zimmer zu gehen; ich fürchtete auch, die Magd könnte mich auf der Treppe finden und denken, ich wäre verrückt geworden. Ich stand auf; im selben Augenblick hörte ich ein Geräusch in Bettinas Zimmer. Nun war ich sicher, daß sie kommen würde, die Hoffnung gab mir neue Kräfte, ich eilte auf die Tür zu, sie öffnete sich. Aber statt daß Bettina herauskommt, sehe ich Cordiani, der mir einen so furchtbaren Fußtritt vor den Bauch gibt, daß ich weit zur Tür hinausfliege und draußen im Schnee liege. Ohne sich bei mir aufzuhalten, läuft Cordiam weg und schließt sich in den Saal ein, den er gemeinsam mit seinen Kameraden, den beiden Feltrini, bewohnt.
Schnell springe ich auf, um mich sofort an Bettina zu rächen, die in diesem Augenblick nichts vor meiner Wut hätte retten können. Ich finde ihre Tür verschlossen und versuche sie mit einem kräftigen Fußtritt zu sprengen. Der Hund fängt an zu bellen, und ich laufe schnell die Treppe hinauf in mein Zimmer, wo ich mich einschließe und zu Bett gehe, um Leib und Secle wieder warm zu bekommen; denn ich war mehr als tot.
Betrogen, erniedrigt, mißhandelt, ein Gegenstand der Verachtung für einen glücklichen, triumphierenden Cordiani, so verbrachte ich drei Stunden damit, den schwärzesten Racheplänen nachzuhängen. Sie alle beide zu vergiften, schien mir in diesem furchtbaren und unglücklichen Augenblick sehr milde zu sein. Diesen Plan ließ ich fallen und ging zu einem anderen über, der ebenso unbesonnen wie niederträchtig war: ich wollte sofort mich aufmachen, um ihrem Bruder alles zu hinterbringen. Ich war erst zwölf Jahre alt, mein Geist hatte noch nicht gelernt, kalten Blutes heroische Rachepläne zu überlegen, die ihren Ursprung nur in falschem Ehrgefühl hatten. Ich war noch ein Neuling in Dingen dieser Art.
In solcher Stimmung befand ich mich, als ich plötzlich vor meiner Tür die heisere Stimme von Bettinas Mutter hörte; sie bat mich schnell herunterzukommen, ihre Tochter liege im Sterben. Es hätte mich geärgert, wäre sie gestorben, ehe ich mich an ihr gerächt; schnell sprang ich aus dem Bett und ging hinunter. Ich sah sie auf dem Bett ihres Vaters in fürchterlichen Krämpfen liegen; alle Hausgenossen standen um sie herum. Ihr halbnackter Leib bog sich; sie drehte sich nach links und rechts, schlug wild mit Händen und Füßen um sich, und vereitelte durch ihre heftigen Stöße alle Bemühungen sie festzuhalten.
Noch ganz voll von den Ereignissen der Nacht, wußte ich bei diesem Anblick nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich kannte weder die Natur noch die Listen der Menschen, und ich war erstaunt, mich hier als kühlen Zuschauer zu sehen und beim Anblick von zwei Menschen, von denen ich den einen zu töten, dem anderen die Ehre zu nehmen gedachte, meine Selbstbeherrschung bewahren zu können. Nach einer Stunde schlief Bettina ein. In diesem Augenblick kamen gleichzeitig eine Hebamme und der Arzt Olivo an. Die Frau sagte, Bettinas Krämpfe würden durch ein hysterisches Leiden verursacht, der Doktor behauptete das Gegenteil und verordnete Ruhe und kalte Bäder. Ich sagte dazu kein Wort, aber ich lachte im stillen über beide, denn ich wußte oder glaubte zu wissen, daß des Mädchens Krankheit nur von ihren nächtlichen Arbeiten herrührte oder auch vielleicht von ihrer Angst wegen meines Zusammentreffens mit Cordiani. Wie dem auch sein mochte, ich entschloß mich, meine Rache bis zur Ankunft ihres Bruders zu verschieben, obwohl ich die Krankheit Bettinas keineswegs für erheuchelt hielt; denn es schien mir unmöglich zu sein, daß sie soviel Kraft hätte.
Um in mein Zimmer zu gelangen, mußte ich durch Bettinas Zimmer gehen; auf ihrem Bett lag ihre Tasche und bei diesem Anblick bekam ich Lust, sie zu untersuchen. Ich fand darin ein Briefchen, und da ich Cordianis Schrift erkannte, nahm ich es mit, um es auf meinem Zimmer in aller Ruhe zu lesen. Erstaunt war ich über die Unvorsichtigkeit des Mädchens, denn ihre Mutter konnte den Brief finden, und da sie nicht lesen konnte, würde sie ihn ihrem Sohn, dem Doktor, gegeben haben. Ich dachte, sie müsse den Kopf verloren haben, aber man stelle sich meine Empfindungen vor als ich folgende Worte las:
„Da Ihr Vater verreist ist, brauchen Sie nicht wie sonst Ihre Tür offen zu lassen. Sofort nach Tisch werde ich mich in Ihre Kammer begeben; dort werden Sie mich finden.“
Zuerst war ich ganz starr vor Staunen; dann dachte ich über die Sache nach und mußte lachen, als ich sah, wie gründlich ich angeführt worden war; ich glaubte mich von meiner Liebe geheilt. Cordiani schien mir entschuldbar, Bettina verächtlich. Ich wünschte mir Glück, eine ausgezeichnete Lehre für mein ganzes Leben erhalten zu haben. Ich ging sogar so weit, zu finden, daß Bettina recht gehabt, mir, der ich noch ein Kind war, den fünfzehnjährigen Cordiani vorzuziehen. Obwohl ich aber geneigt war zu vergeben und zu vergessen, lag mir doch Cordianis Fußtritt schwer auf der Seele; den vergab ich ihm nicht.
Als wir Mittags in der Küche, wo wir der Kälte wegen aßen, bei Tisch saßen, ertönte plötzlich von neuem Bettinas Geschrei. Alle liefen zu ihr; nur ich blieb ruhig sitzen und aß zu Ende; hierauf ging ich wieder an meine Arbeit.
Als ich abends zum Essen herunterkam, sah ich in der Küche Bettinas Bett neben dem ihrer Mutter; aber ich kümmerte mich nicht darum, ebensowenig wie um den Lärm, der die ganze Nacht anhielt, und um die allgemeine Aufregung, als sie am nächsten Morgen wieder Krämpfe bekam.
Am Abend kamen der Doktor und sein Vater zurück. Cordiani, meine Rache fürchtend, kam zu mir und fragte mich, was ich zu tun gedächte. Als er mich aber, das offene Messer in der Hand, auf sich zukommen sah, lief er eilends davon. Daran, dem Doktor die ärgerliche Geschichte zu erzählen, hatte ich gar nicht wieder gedacht; ein Plan dieser Art konnte in meinem Geist nur in einer augenblicklichen zornigen Aufwallung auftauchen.
Am anderen Morgen unterbrach die Mutter uns während der Lehrstunde, um nach vielen Umschweifen dem Doktor zu sagen, sie glaube herausgebracht zu haben, was es mit der Krankheit ihrer Tochter auf sich habe. Diese sei von einer Hexe bezaubert, und sie kenne diese Hexe.
„Das kann ja sein, liebe Mutter, aber man darf sich in solchen Sachen nicht täuschen. Wer ist die Hexe?“
„Unsere alte Magd; ich habe mich eben davon überzeugt.“
„Wieso denn?“
„Ich habe meine Zimmertür mit zwei kreuzweis gelegten Besen versperrt; wer hinein wollte, mußte das Kreuz zerstören. Als aber die Magd sie sah, ist sie umgekehrt und durch die andere Tür hineingegangen. Es ist doch klar: wenn sie keine Hexe wäre, hätte sie das Besenkreuz fortgeräumt.“
„Das ist gar nicht so klar, liebe Mutter. Laßt doch mal die Frau hereinkommen.“
„Warum“, fragte der Abbate die Magd, sobald sie erschien, „bist du heute morgen nicht durch die gewöhnliche Tür ins Zimmer gekommen?“
„Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen.“
„Hast du nicht vor der Tür das Andreaskreuz gesehen?“
„Was ist das für’n Kreuz?“
„Es nützt dir nichts, daß du die Dumme spielst!“ rief die Mutter.
„Wo hast du vorigen Donnerstag geschlafen?“
„Bei meiner Nichte. Sie hat ein Kind gekriegt.“
„Das ist nicht wahr. Zum Sabbat bist du gewesen, denn du bist ’ne Hexe, und du hast meine Tochter behext!“
Entrüstet spuckt das arme Weib ihr ins Gesicht; die Mutter ergreift in ihrer Wut einen Stock, um sie durchzuprügeln; der Abbate will seine Mutter zurückhalten, aber er muß der Magd nacheilen, die schon die Treppe hinunterläuft und schreit und flucht, um die Nachbarschaft zu alarmieren. Er holt sie ein, und es gelingt ihm endlich, sie zu beschwichtigen, indem er ihr ein bißchen Geld gibt.
Nach diesem ebenso komischen wie ärgerlichen Auftritt legte der Abbate seinen priesterlichen Ornat an, um seine Schwester zu beschwören und festzustellen, ob sie wirklich den Teufel im Leibe hätte.
Die Neuheit all dieser Mysterien erregte meine ganze Aufmerksamkeit; die ganze Gesellschaft schien mir verrückt oder blödsinnig dumm zu sein; denn ich mußte lachen, wenn ich mir bloß vorstellte, daß in Bettinas Leib Teufel sein sollten. Als wir an ihr Bett traten, schien sie keine Luft kriegen zu können, und von den Beschwörungen ihres Bruders wurde es mit ihrer Atemnot nicht besser. Darüber kam der Doktor Olivo zu; er fragte den Doktor, ob er dabei sein dürfte. Dieser antwortete: ja; wenn er den Glauben hätte. Olivo antwortete, sein Glaube beschränke sich auf die Wunder des Evangeliums, und entfernte sich.
Als kurz darauf der Doktor wieder auf sein Zimmer gegangen war und ich mich mit Bettina allein befand, flüsterte ich ihr ins Ohr: „Fassen Sie Mut; werden Sie gesund und verlassen Sie sich auf meine Verschwiegenheit.“ Sie drehte den Kopf nach der anderen Seite, ohne mir zu antworten; aber der ganze Tag verging ohne Krämpfe. Ich glaubte sie geheilt zu haben; den nächsten Tag jedoch stieg das Fieber ihr ins Gehirn, und sie sprach in ihrem Delirium griechische und lateinische Worte ohne Zusammenhang. Nun zweifelte man nicht mehr, daß sie wirklich vom Teufel besessen sei. Die Mutter ging aus und kam nach einer Stunde mit dem berühmtesten Teufelsaustreiber von Padua zurück. Dies war ein sehr häßlicher Kapuziner, genannt Bruder Prospero da Bovolenta.
Sobald Bettina den Teufelsbeschwörer erblickte, sagte sie ihm laut lachend die fürchterlichsten Beleidigungen; darüber freuten sich alle Anwesenden, denn nur der Teufel konnte so frech sein, einen Kapuziner dermaßen zu behandeln. Dieser aber, als er sich Dummkopf, Eindringling, Stinkbock schimpfen hörte, schlug mit einem großen Kruzifix auf Bettina los; er sagte aber, er schlage den Teufel. Er hörte erst auf, als er sah, daß sie den Nachttopf ergriffen hatte und ihm diesen an den Kopf werfen wollte.
„Wenn der, der dich mit Worten verletzt hat“, so rief sie, „der Teufel ist, so schlage ihn mit deinen Worten, du Esel! Aber wenn ich es bin, so merke dir, du Flegel, daß du mich zu respektieren hast. Mach, daß du fort kommst.“
Ich fah den Doktor Gozzi rot werden. Der Kapuziner aber blieb unentwegt, in seiner Glaubensrüstung vom Kopf zum Fuß gepanzert; er las einen furchtbaren Bannfluch herunter und forderte zum Schluß den bösen Geist auf, ihm seinen Namen zu sagen.
„Ich heiße Bettina.“
„Nein! Denn das ist der Name eines getauften Mädchens!“
„Du glaubst also, ein Teufel müsse einen männlichen Namen haben? Erfahre, du unwissender Kapuziner, ein Teufel ist ein Engel, der kein Geschlecht haben kann. Da du aber glaubst, daß der, der aus meinem Munde zu dir spricht, ein Teufel sei, so versprich mir die Wahrheit zu antworten, und ich verspreche dir, mich deinen Beschwörungen zu fügen.“
„Ja, ich verspreche es dir.“
„Sage mir also: Glaubst du gelehrter zu sein als ich?“
„Nein, aber ich halte mich für stärker namens der allerheiligsten Dreieinigkeit und kraft meiner geheiligten Priesterwürde.“
„Wenn du stärker bist, so verhindere mich doch, dir die Wahrheit über dich zu sagen: du bist eitel auf deinen Bart; du kämmst ihn täglich zehnmal, und es würde dir nicht einfallen, die Hälfte davon abzuschneiden, wenn du mich dadurch aus diesem Leibe austreiben könntest. Schneide ihn ab, und ich schwöre dir, ich werde ausfahren.“
„Vater der Lüge, ich werde deine Strafen verdoppeln!“
„Tu’s nur!“
Bei diesen Worten brach Bettina in ein solches Gelächter aus, daß ich unwillkürlich ebenfalls lachen mußte. Darauf wandte der Kapuziner sich zum Doktor und sagte ihm, ich hätte keinen Glauben und müsse hinausgehen. Dies tat ich, indem ich ihm sagte, er habe richtig geraten. Ich war noch nicht draußen, als der Mönch, der Bettinen seine Hand zum Kusse reichte, das Vergnügen hatte, sie darauf spucken zu sehen.
Unbegreifliches, talentvolles Mädchen! Sie führte den Kapuziner ab, und kein Mensch wunderte sich darüber, denn alle ihre Antworten wurden dem Teufel zugeschrieben. Ich begriff nicht, was sie damit beabsichtigen konnte.
Der Kapuziner speiste mit uns und brachte während des Essens eine Masse Dummheiten vor. Nach der Mahlzeit ging er wieder in Bettinas Kammer, um ihr seinen Segen zu geben; aber sobald sie ihn erblickte, nahm sie ein großes Glas mit einem schwarzen Mischmasch, den der Apotheker ihr geschickt hatte, und warf es ihm an den Kopf. Cordiani, der dicht neben ihm stand, bekam ein gutes Teil davon ab, was nur ungeheuer viel Vergnügen machte. Bettina hatte recht, daß sie sich die Gelegenheit zu nutze machte, denn alles wurde dem armen Teufel auf Rechnung geschrieben. Jedenfalls wenig befriedigt, sagte Vater Prospero beim Abschied zum Doktor, das Mädchen sei ohne Zweifel besessen, aber er müsse einen anderen Teufelsbanner suchen, denn ihm habe Gott nicht die Gnade erweisen wollen, sie von dem bösen Geist zu befreien.
Als er fort war, verbrachte Bettina sechs Stunden vollkommen ruhig und überraschte uns alle, als sie am Abend kam und sich mit uns zu Tisch setzte; sie versicherte ihren Eltern, sie befinde sich wohl, und sprach mit ihrem Bruder. Hierauf wandte sie sich an mich und sagte, der Ball solle morgen stattfinden, und sie werde in der Frühe zu mir kommen und mich als Mädchen frisieren. Ich dankte ihr und erwiderte, sie sei sehr krank gewesen und müsse sich schonen. Bald ging sie zu Bett; wir aber blieben noch bei Tische sitzen und sprachen von nichts anderem, als von ihr.
Als ich wieder auf meinem Zimmer war und mich zu Bett legen wollte, fand ich in meiner Nachtmütze einen Zettel mit folgenden Worten:
„Entweder kommen Sie als Mädchen verkleidet mit mir auf den Ball oder Sie sollen etwas sehen, worüber Sie weinen werden.“
Ich wartete, bis der Doktor eingeschlafen war, und schrieb dann meine Antwort an sie nieder:
„Ich werde nicht auf den Ball gehen, denn ich bin fest entschlossen, jede Gelegenheit zu vermeiden, wobei ich mit Ihnen allein sein könnte. Sie drohen mir, ich solle etwas Furchtbares sehen; ich traue Ihnen wohl zu, daß Sie Ihr Wort halten werden; aber ich bitte Sie: schonen Sie meines Herzens, denn ich liebe Sie, wie wenn Sie meine Schwester wären. Ich habe Ihnen verziehen, liebe Bettina, und ich will alles vergessen. Anbei ein Brief, den Sie gewiß mit Freuden wieder in Ihren Händen sehen werden. Sie sehen, welcher Gefahr Sie sich ausgesetzt haben, indem Sie ihn in Ihrer Tasche auf dem Bett liegen ließen. Daß ich ihn Ihnen zurückgebe, muß Sie von meiner Freundschaft überzeugen.“