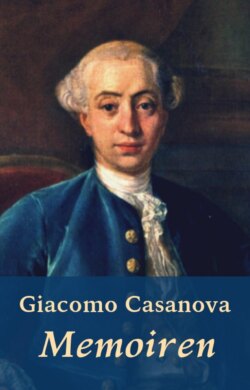Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 12
Siebentes Kapitel
ОглавлениеUnglück in Chiozza. – Der Barfüßermönch Vater Steffano. – Im Lazarett zu Ancona. – Die griechische Sklavin. – Pilgerfahrt zu Unserer lieben Frau von Loreto.– Fußwanderung nach Rom; Weiterreise nach Neapel.– Der Bischof, den ich suche, ist nicht zu finden. – das Glück verschafft mir die Mittel nach Martorano zu gelangen, von wo ich schleunigst wieder abreise, um nach Neapel zurückzukehren
Das sogenannte große Gefolge des Gesandten schien mir sehr klein; es bestand aus einem Mailänder Haushofmeister namens Carnicelli, einem Abbate, der ihm als Sekretär diente, da er nicht schreiben konnte, einer alten Aufwartefrau, einem Koch mit einer häßlichen Frau und aus acht oder zehn Bedienten.
Mittags kamen wir in Chiozza an. Als wir ausgestiegen waren, fragte ich höflich den Mailänder, wo ich mich einquartieren solle. „Wo Sie wollen“, antwortete er; „nur müssen Sie dem Mann da bekannt machen, wo Sie wohnen, damit er Ihnen Bescheid sagen kann, sobald die Tartane bereit ist, in See zu stechen. Ich habe die Verpflichtung, Sie vom Augenblick unserer Abreise von hier kostenfrei nach dem Lazarett in Ancona zu befördern; bis dahin also amüsieren Sie sich!“
Der Mann da, den er mir gezeigt hatte, war der Besitzer der Tartane. Ich fragte ihn, wo ich wohnen könnte. „Bei mir“, antwortete er, „wenn es Ihnen recht ist, mit dem Herrn Koch, dessen Frau an Bord der Tartane bleibt, in einem großen Bett zu schlafen.“ Ich konnte nichts Besseres tun, als dieses Anerbieten anzunehmen; ein Matrose nahm meinen Koffer auf die Schulter und führte mich zum Hause des wackeren Schiffers. Mein Koffer mußte unter das Bett geschoben werden, denn dieses Bett füllte die ganze Kammer aus. Ich lachte darüber, denn es kam mir nicht zu, den Heiklen zu spielen. Ich ging ins Wirtshaus, um zu essen, und besah mir hierauf den Ort. Chiozza ist eine Halbinsel und hat einen Seehafen, der zur Republik Venedig gehört; seine zehntausend Einwohner bestehen meistens aus Matrosen, Fischern, Kaufleuten, Zollwächtern und Steuer- oder Finanzbeamten der Republik.
Ich bemerke ein Kaffeehaus und trete ein. Kaum bin ich drinnen, da kommt ein junger Doktor der Rechte, mit dem ich in Padua studiert hatte, auf mich zu, umarmt mich und stellt mich einem Apotheker vor, dessen Apotheke gleich nebenan lag. Er sagte mir, bei ihm versammelten sich alle literarisch gebildeten Leute. Kurz darauf kam ein einäugiger großer Jakobinermönch, den ich von Venedig her kannte, namens Corsini, und begrüßte mich auf die höflichste Weise. Er sagte mir, ich käme gerade zur rechten Zeit, um dem Picknick der makkaronischen Akademiker beizuwohnen, das am nächsten Tage nach einer Sitzung der Akademie stattfinden sollte und wobei jedes Mitglied ein Gedicht eigener Mache vortrage. Er lud mich ein daran teilzunehmen und der Vereinigung die Ehre zu erweisen, daß ich ihr eines meiner Geisterzeugnisse mitteilte. Ich nahm an und wurde durch Zuruf als Mitglied aufgenommen, nachdem ich zehn Stanzen vorgelesen, die ich für diesen Anlaß gedichtet hatte. Bei Tisch machte ich eine noch bessere Figur als bei der Sitzung, denn ich aß so viel Makkaroni, daß man mich als Fürsten ausrief.
Der junge Doktor, der ebenfalls Akademiker war, stellte mich seiner Familie vor. Seine sehr wohlhabenden Eltern bezeigten mir tausend Freundlichkeiten. Er hatte eine sehr liebenswürdige Schwester; aber eine zweite, die den Nonnenschleier genommen hatte, erschien mir geradezu als ein Wunder von Schönheit. Ich hätte im Schoße dieser reizenden Familie meinen Aufenthalt in Chiozza auf sehr angenehme Art verbringen können; aber es stand geschrieben, daß ich an diesem Ort nur Kummer erleben sollte. Der junge Doktor machte mich darauf aufmerksam, daß der Jakobinermönch Corsini ein großer Taugenichts sei, den man nirgends gern sehe, und daß ich gut tun würde, den Verkehr mit ihm zu meiden. Ich dankte ihm herzlich für seinen guten Rat; aber mein Leichtsinn ließ es nicht zu, ihn mir zunutze zu machen. Von Natur nachsichtig und zu unbedacht, um mich vor Fallen zu fürchten, gab ich mich dem törichten Glauben hin, der Mönch könne mir im Gegenteil viele Annehmlichkeiten verschaffen.
Am dritten Tage kam ich denn wieder mit dem Taugenichts zusammen; er führte mich in ein schlechtes Haus, in das ich auch ohne seine Empfehlung Eingang gefunden hätte. Um zu renommieren, spielte ich den Liebenswürdigen gegen eine Unglückliche, deren Häßlichkeit allein mich schon hätte abschrecken sollen. Von da nahm er mich zum Abendessen mit sich in ein Wirtshaus, wo wir viele andere Burschen von seiner Sorte fanden. Nach dem Essen legte einer von ihnen eine Pharaobank. Man lud mich zur Teilnahme am Spiel ein. Ich ließ mich aus falscher Scham, die so oft junge Leute ins Verderben stürzt, dazu verführen. Nachdem ich vier Zechinen verloren hatte, wollte ich aufhören, aber mein ehrenwerter Freund, der Jakobiner, wußte mich zu veranlassen, noch vier Zechinen halbpart mit ihm zu riskieren. Er hielt die Bank; sie wurde gesprengt. Ich wollte nicht mehr spielen, aber Corsini tat, als gehe es ihm sehr zu Herzen, daß er an meinem Verlust schuld sei, und riet mir, selber eine Bank von zwanzig Zechinen zu legen. Die Bank flog auf. In der Hoffnung, mein Geld wieder zu gewinnen, verlor ich alles, was ich hatte. Niedergeschmettert ging ich weg; als ich mich neben dem Koch ins Bett legte, wachte er auf und sagte, ich sei ein liederlicher Mensch. „Stimmt!“ war meine Antwort.
Meine Natur war durch das Wachen und durch den Kummer erschöpft; so versank ich denn in einen tiefen Schlaf. Um Mittag weckte mich der erbärmliche Hallunke Corsini und sagte mir triumphierend, es sei ein sehr reicher junger Mensch eingeladen worden, er werde mit uns zu Abend essen und müsse unbedingt verlieren; so werde ich meinen Verlust wieder wettmachen.
„Ich habe all mein Geld verloren, leihen Sie mir zwanzig Zechinen.“
„Wenn ich Geld herleihe, verliere ich ganz gewiß. Das ist ein Aberglaube von mir; aber ich habe zu oft die Erfahrung gemacht. Sehen Sie zu, daß Sie anderwärts Geld auftreiben, und kommen Sie. Adieu!“
Ich wagte nicht, meinem vernünftigen Freund etwas von meiner Lage zu sagen, daher erkundigte ich mich nach einem anständigen Pfandleiher und leerte meinen Koffer. Der ehrliche Mann machte ein Verzeichnis von meinen Sachen und gab mir dreißig Zechinen unter der Bedingung, daß alle Sachen ihm gehören sollten, wenn ich ihm nicht längstens in drei Tagen das Geld zurückgäbe. Ich muß ihn als ehrlichen Mann bezeichnen, denn er selber nötigte mich, drei Hemden, einige Strümpfe und Taschentücher zu behalten. Ich wollte ihm alles geben, da ich ein Vorgefühl hatte, daß ich alles Verlorene zurückgewinnen würde. Ein ziemlich allgemein verbreiteter Irrtum. Einige Jahre später rächte ich mich, indem ich eine Abhandlung gegen die Vorgefühle schrieb. Ich glaube, das einzige Vorgefühl, wozu der Mensch einiges Vertrauen haben darf, ist das, welches ihm Böses weissagt, denn dieses geht aus dem Verstande hervor. Das Vorgefühl, das uns Glück voraussagt, kommt aus dem Herzen, und das Herz glaubt an das närrische Glück, weil es selber närrisch ist.
Spornstreichs eilte ich zu meiner ehrenwerten Gesellschaft, die nichts mehr fürchtete, als daß ich nicht wiederkäme. Während des Abendessens verlautete kein Sterbenswörtchen von Spielen, aber man zollte meinen außerordentlichen Fähigkeiten das schwülstigste Lob und pries das hohe Glück, das in Rom meiner harre. Als nach Tisch immer noch nicht vom Spiel die Rede war, trieb mich mein böser Geist, und ich verlangte mit Nachdruck Revanche. Man antwortete mir, ich brauche ja nur eine Bank aufzulegen, sie würden alle setzen. Ich tat es, verlor alles und ging. Den Mönch bat ich, meine Wirtszeche zu bezahlen, und er versprach es mir.
Ganz verzweifelt ging ich nach meiner Wohnung, denn um mein Unglück voll zu machen, bemerkte ich unterwegs, daß ich eine zweite Griechin gefunden hatte, die weniger schön, aber ebenso heimtückisch gewesen war. Wie betäubt legte ich mich zu Bett und ich war, glaube ich, ganz gefühllos, als ich einschlief. Elf Stunden lag ich in schwerem Schlaf, und als ich aufwachte, schloß ich gleich wieder die Augen und versuchte, noch einmal einzuschlafen, denn mein Geist war niedergedrückt, und ich verabscheute das Tageslicht, dessen ich nicht mehr würdig zu sein glaubte. Ich fürchtete mich vor einem völligen Erwachen, weil ich dann hätte einen Entschluß fassen müssen; aber nicht einen Augenblick kam mir der Gedanke, nach Venedig umzukehren, was ich doch eigentlich hätte tun sollen. Auch hätte ich mich lieber umgebracht, als dem jungen Doktor meinen Zustand anzuvertrauen. Das Leben war mir zur Last; ich hatte die unbestimmte Hoffnung, ich könnte vielleicht Hungers sterben, ohne mich von der Stelle zu rühren. Ich glaube bestimmt, ich wäre nicht aufgestanden, wenn mich nicht der brave Albanese, der Schiffer der Tartane, gerüttelt und mir gesagt hätte, ich müßte an Bord gehen, das Schiff segle ab.
Der Mensch fühlt sich erleichtert, wenn er – einerlei wodurch – aus einer großen Ratlosigkeit herausgerissen wird. Mir kam es vor, als hätte mir der Schiffer das einzige genannt, was ich in meiner Not noch tun konnte. So zog ich mich in aller Eile an, band meine ganzen Habseligkeiten in ein Schnupftuch und lief nach der Anlegestelle des Schiffes. Eine Stunde später wurde der Anker gelichtet, und am Morgen lief die Tartane in den istrischen Hafen Orsara ein. Wir gingen alle an Land, um die Stadt zu besehen, die aber diesen Namen nicht verdient. Sie gehört dem Papst, da die Republik Venedig sie dem heiligen Stuhl zum Geschenk gemacht hat.
Ein junger Barfüßer, Bruder Steffano von Belluno genannt, den der Schiffer, ein großer Verehrer des heiligen Franziskus, aus Barmherzigkeit mitgenommen hatte, trat an mich heran und fragte mich, ob ich krank sei.
„Ehrwürdiger Vater, ich habe Kummer.“
„Den werden Sie verscheuchen, wenn Sie mit mir nur zu einer Anhängerin unseres Ordens zum Essen gehen.“
Seit sechsunddreißig Stunden war keine Nahrung irgendwelcher Art in meinen Magen gekommen, und da der hohe Seegang während der nächtlichen Fahrt mich sehr stark mitgenommen hatte, so war mein Magen gewiß ganz leer. Außerdem quälte meine erotische Unbequemlichkeit mich über alle Maßen; dazu kam noch das Gefühl der Erniedrigung, das auf mir lastete, – ich hatte keinen Heller in der Tasche. Ich befand mich in einem so traurigen Zustand, daß ich nicht die Kraft hatte, meinen Willen gegen irgend etwas zu setzen. In völliger Teilnahmslosigkeit folgte ich mechanisch dem Barfüßer.
Er stellte mich der Betschwester vor, indem er ihr sagte, er begleite mich nach Rom, wo ich das Ordenskleid des heiligen Franziskus nehmen werde. Solche Lüge war nur widerwärtig, und in einer anderen Lage hätte ich sie unbedingt nicht durchgehen lassen; aber in der Lage, in der ich mich befand, kam dieser Betrug mir nur komisch vor. Die gute Frau gab uns eine treffliche Mahlzeit Fische, die mit dem in jener Gegend ausgezeichneten Öl zubereitet waren. Wir tranken dazu Refosco, den ich wundervoll fand. Während wir frühstückten, kam ein freundlicher Priester, der zu mir sagte, ich dürfe nicht die Nacht auf der Tartane verbringen, sondern müsse ein gutes Bett bei ihm annehmen, und wenn wir am nächsten Tage wegen widrigen Windes nicht absegeln könnten, auch noch zu einem guten Mittagessen bei ihm bleiben. Ohne Zögern nahm ich dieses Anerbieten an. Nachdem ich reichlich gefrühstückt hatte, dankte ich aus aufrichtigem Herzen der guten frommen Frau und ging mit dem Priester fort, um die Stadt zu besehen. Abends nahm er mich mit in sein Haus und gab mir ein gutes Nachtmahl. Dieses war von seiner Haushälterin zubereitet, die sich mit uns zu Tisch setzte; sie gefiel mir. Sein Refosco war noch besser, als der der Betschwester; der Wein machte mich meine Leiden vergessen, und ich plauderte recht heiter. Er wollte mir ein von ihm verfaßtes Gedicht vorlesen, aber ich konnte nicht mehr die Augen offen halten und sagte ihm, ich würde es gerne am nächsten Tage anhören.
Ich ging zu Bett, und nach einem zehnstündigen tiefen Schlaf brachte mir die Haushälterin den Kaffee; sie hatte schon auf den Augenblick meines Erwachens gelauert. Ich fand das Mädchen reizend; leider aber war ich nicht imstande ihr zu beweisen, wie schön ich sie fand.
Da ich sehr zugunsten meines Gastfreundes eingenommen war und sein Gedicht recht aufmerksam hören wollte, so entriß ich mich meiner traurigen Stimmung und machte über seine Verse Bemerkungen, die ihn so entzückten, daß er mich viel geistreicher fand, als er erwartet hätte, und mich durchaus auch noch mit der Vorlesung seiner Idyllen beglücken wollte. Da mußte denn meine Höflichkeit gute Miene zum bösen Spiel machen. In angenehmer Weise verbrachten wir den ganzen Tag mitsammen. Die Haushälterin erwies mir die deutlichsten Aufmerksamkeiten; ich sah, daß ich ihr gefallen hatte, und indem ich diesen Gedanken angenehm fand, fühlte ich, daß sie meine Eroberung gemacht hatte, wie ich die ihre. Der Tag verging dem guten Priester blitzschnell – dank den Schönheiten, die ich an seinen Versen entdeckt hatte, die, offen gestanden, unter dem Mittelmaß waren. Mir aber kam die Zeit entsetzlich lang vor, so sehr sehnte ich mich nach den Verheißungen des Zubettegehens, die ich in den Blicken der Haushälterin las. Zwar befand ich mich sowohl körperlich wie seelisch in traurigem Zustande; aber so war ich nun einmal: ich überließ mich der Freude, während mich doch, wenn ich vernünftig gedacht hätte, alles hätte traurig stimmen müssen.
Endlich war der Augenblick da. Ich fand das liebenswürdige Mädchen bis zu einem gewissen Grade gefällig; als ich aber ihren Reizen volle Ehre erweisen zu wollen schien, setzte sie mir einigen Widerstand entgegen. Da gab ich ehrbar meine Versuche auf; wir waren beide froh, so wohlfeilen Kaufes davon gekommen zu sein, und ich ging ruhig zu Bett. Die Geschichte war jedoch noch nicht zu Ende. Denn als sie morgens mir meinen Kaffee brachte und ihre anreizende Miene mich zu einigen Liebkosungen hinriß, widerstand sie, wie sie sagte, nur weil sie fürchtete, überrascht zu werden. Der Tag verging dem Priester und mir aufs beste, und am Abend wurden zwei volle Stunden aufs köstlichste verbracht, da die Schöne keine Überraschungen mehr fürchtete. Ich hatte alle Vorsichtmaßregeln getroffen, die unter solchen Umständen möglich sind. – Am andern Tage reiste ich ab.
Während der ganzen Reise machte mir Bruder Steffano durch seine Bemerkungen Spaß; unter dem Schleier der Einfalt war Unwissenheit mit Spitzbüberei gemischt. Er zeigte mir alle Almosen, die er in Orsara erhalten hatte: Brot, Wein, Käse, Würste, Konfekt und Schokolade. Alle Taschen seiner heiligen Kutte waren voll von Lebensmitteln. „Haben Sie auch Geld?“ fragte ich ihn.
„Gott bewahre! Erstens verbietet mir unser glorreicher Orden welches anzurühren; zweitens würde man mir einen oder zwei Soldi geben, wenn ich auf meinen Bettelgängen mir einfallen ließe, Geld zu nehmen. Was ich an Eßwaren bekomme, ist zehnmal soviel wert. Glauben Sie mir, San Francesco war ein sehr kluger Mann.“
Bei näherem Überlegen fand ich, daß für den Mönch Reichtum grade darin bestand, was in jenem Augenblick mich elend machte. Er lud mich ein, sein Tischgenosse zu sein, und schien ganz stolz darauf zu sein, daß ich ihm die Ehre erwies.
Die Tartane lief den Hafen von Pola an, der Veruda heißt, und wir stiegen aus. Nachdem wir ein Viertelstunde bergan gestiegen waren, kamen wir in die Stadt, und ich verwandte ein paar Stunden auf die Besichtigung der dort befindlichen römischen Altertümer. Die Stadt war ja einstmals Hauptstadt des römischen Reiches; ich fand jedoch von der früheren Größe keine Spur mehr als die Ruinen einer Arena. Wir kehrten nach Veruda zurück und gingen wieder unter Segel. Am nächsten Tage kamen wir vor Ancona an; da wir jedoch lavieren mußten, liefen wir erst am übernächsten Tag in den Hafen ein. Dieser Hafen gilt zwar für ein großartiges Denkmal Trajans, aber er wäre sehr schlecht, wenn nicht mit großen Kosten ein Damm ins Meer hinein gebaut worden wäre. Durch diesen wird er allerdings ziemlich gut. Ich machte die interessante Beobachtung, daß die nördliche Küste der Adria voll von Häfen ist, während die gegenüberliegende nur einen oder zwei hat. Offenbar zieht das Meer sich nach Osten zurück, und in drei- oder vierhundert Jahren wird Venedig mit dem Festlande verbunden sein.
In Ancona stiegen wir im alten Lazarett ab, wo man uns sagte, wir müßten eine Quarantäne von achtundzwanzig Tagen durchmachen. Venedig hatte nach einer dreimonatlichen Sperre die Besatzung von zwei Schiffen aus Messina zugelassen; und in Messina hatte kurz vorher die Pest gewütet. Ich verlangte ein Zimmer für mich und Bruder Steffano, der mir dafür ungeheuer dankbar war. Von einem Juden mietete ich ein Bett, einen Tisch und ein paar Stühle; den Mietspreis für das Ganze verpflichtete ich mich nach Beendigung der Sperrzeit zu bezahlen. Der Mönch wollte nur ein Bündel Stroh. Ich glaube, wenn er hätte ahnen können, daß ich ohne ihn vielleicht verhungert wäre, so hätte er nicht so laut jubiliert, daß er bei mir wohnen durfte. Ein Matrose, der sich Hoffnungen auf meine Freigebigkeit machte, fragte mich, wo mein Koffer sei. Da ich ihm antwortete, ich wisse nichts davon, gab er sich viele Mühe ihn zu finden. Auch der Albanese half suchen, und ich hätte beinahe laut herausgelacht, als der Schiffer zu mir kam und mich um Entschuldigung bat: er habe den Koffer vergessen, aber er wolle dafür sorgen, daß ich ihn vor Ablauf von drei Wochen erhalte.
Der Barfüßer, der mit mir vier Wochen verbringen sollte, gedachte auf meine Kosten zu leben, während im Gegenteil ihn die Vorsehung mir geschickt hatte, um für meinen Unterhalt zu sorgen. Er hatte Lebensmittel, wovon wir uns acht Tage lang nähren konnten, aber es galt auf weiter hinaus vorzusorgen.
So entwarf ich ihm denn nach dem Abendessen eine pathetische Schilderung meiner Lage; um nach Rom zu kommen, fehle mir alles; dort würde ich als Sekretär bei der Gesandtschaft eintreten. Man denke sich meine Überraschung, als ich bei der traurigen Erzählung meines Unglücks den Tölpel ein ganz fröhliches Gesicht machen sah. „Ich übernehme es, Sie bis nach Rom zu bringen; sagen Sie mir nur, ob Sie schreiben können?“
„Sie scherzen wohl?“
„Welches Wunder! Wie Sie mich hier sehen, kann ich nur meinen Namen schreiben. Allerdings kann ich das mit beiden Händen. Welchen Zweck hätte es für mich mehr zu können?“
„Ich bin erstaunt, ich glaubte, Sie seien Priester.“
„Nicht Priester! Mönch bin ich. Ich lese die Messe, muß also lesen können. San Francesco, dessen unwürdiger Sohn ich bin, konnte nicht lesen, darum hat er auch niemals eine Messe verrichtet. Nun, da Sie schreiben können, so schreiben Sie morgen an alle Personen, die ich Ihnen nennen werde, ich stehe Ihnen dafür, man wird uns so viel schicken, daß wir davon bis zum Ende der Quarantaine herrlich und in Freuden leben können.“
Den ganzen nächsten Tag mußte ich damit verbringen, acht Briefe zu schreiben; denn es besteht im Franziskanerorden folgende Überlieferung: wenn ein Mönch an sieben Türen geklopft hat, ohne ein Almosen zu erhalten, so soll er mit Zuversicht bei der achten anpochen; denn hier wird es ihm nicht mißlingen. Da er schon einmal nach Rom gereist war, so kannte er in Ancona alle guten Häuser, wo San Francesco in Ehren gehalten wurde, und alle Oberen der reichen Klöster. Ich mußte an alle Adressen schreiben, die er mir nannte, und durfte keine von den Lügen auslassen, die er mir diktierte. Er nötigte mich auch, für ihn zu unterschreiben, denn wenn er selber unterzeichne, sagte er, so würde man leicht sehen, daß er nicht die Briefe geschrieben hätte, und das würde ihm schaden, „denn in unserer verderbten Zeit“, sagte er, „achtet man ja nur die Gelehrten“. Ich mußte die Briefe mit lateinischen Zitaten spicken – selbst die an Frauen gerichteten, und alle meine Einwendungen waren vergeblich. Denn, wenn ich mich widersetzte, drohte er mir, er würde mir nichts mehr zu essen geben. So entschloß ich mich denn, alles zu tun, was er wollte. An den Superior der Jesuiten ließ er mich schreiben: er wende sich nicht an die Kapuziner, weil das lauter Atheisten wären, deshalb hätte auch der heilige Franziskus sie niemals leiden können. Vergebens sagte ich ihm, zu Lebzeiten des Heiligen habe es weder Kapuziner noch Barfüßer gegeben; er sagte mir, ich sei ein Ignorant. Ich glaubte, man würde ihn als Narren behandeln und kein Mensch würde uns etwas schicken, aber ich irrte mich. Lebensmittel trafen in so großer Menge ein, daß ich ganz überrascht war. Von drei oder vier Seiten schickte man uns Wein, der für die ganze Dauer der Sperre ausreichte, um so mehr, da ich nur Wasser trank, denn ich wollte schnell wieder gesund werden. Zu essen empfingen wir täglich mehr, als sechs Personen verzehren konnten. Den Rest gaben wir unserem Aufseher, der eine zahlreiche Familie hatte. Für alle diese Gaben fühlte der Mönch sich nur dem heiligen Franziskus zur Dankbarkeit verpflichtet und durchaus nicht den guten Seelen, die ihm das Almosen spendeten.
Er übernahm es, meine Unterkleider durch den Aufseher waschen zu lassen; ich selber hätte sie diesem nicht zu geben gewagt. Er aber sagte, er riskierte nichts dabei; denn ein jeder wüßte, daß die Barfüßer keine Wäsche trügen.
Ich blieb fast den ganzen Tag im Bett; so brauchte ich mich nicht vor den Leuten sehen zu lassen, die ihm ihren Besuch abstatten zu müssen glaubten. Die anderen, die nicht kamen, sandten ihm Briefe voll von geschickten Sticheleien; ich hütete mich wohl, ihn auf diese aufmerksam zu machen. Übrigens hatte ich eine entsetzliche Mühe, ihn zu überzeugen, daß diese Briefe nicht beantwortet zu werden brauchten.
Eine zweiwöchentliche Ruhe und strenge Enthaltsamkeit brachten mich auf den Weg zu völliger Wiederherstellung. Ich spazierte nun vom Morgen bis zum Abend im Hof des Lazaretts herum, aber ich mußte diese Unterhaltung aufgeben, als ein türkischer Kaufmann aus Saloniki ankam und mit allen seinen Leuten im Erdgeschoß untergebracht wurde. Nun hatte ich nur noch das Vergnügen, den Tag auf einem Balkon zu verbringen, der auf diesen Hof hinausging. Von dem Balkon aus sah ich eine überraschend schöne griechische Sklavin, die in mir große Teilnahme erweckte. Sie saß fast den ganzen Tag auf ihrer Türschwelle und strickte oder las. Wenn sie ihre schönen Augen erhob und meinen Blicken begegnete, senkte sie bescheiden den Kopf; zuweilen stand sie sogar auf und ging langsam ins Haus hinein, wie wenn sie mir hätte sagen wollen: Ich wußte nicht, daß ich beobachtet würde. Von Gestalt war sie groß und schlank; nach ihrem Gesicht zu urteilen mußte sie noch in der zartesten Jugendblüte stehen; ihre Haut war blendend weiß, ihre Haare und Augen waren von schönem Schwarz. Sie trug griechische Kleider, und diese gaben ihrem ganzen Wesen etwas überaus Wollüstiges.
In der Langeweile eines Lazaretts und so wie Natur und Gewohnheit mich gemacht hatten – wie hätte ich wohl ein so verführerisches Wesen halbe Tage lang sehen können, ohne mich rasend zu verlieben? Ich hatte sie in lingua franca mit ihrem Herrn sprechen hören; dieser war ein schöner Greis, der sich ebenso sehr langweilte und nur zuweilen mit seiner Pfeife im Munde auf einen Augenblick herauskam, um gleich wieder ins Haus zu gehen. Gerne hätte ich dem reizenden Mädchen ein paar Worte gesagt; aber ich fürchtete, sie könnte dann fortgehen und ich würde sie nicht wiedersehen. Endlich aber konnte ich es nicht länger aushalten, und ich faßte den Entschluß, ihr zu schreiben. Um ein Mittel, ihr meinen Brief zukommen zu lassen, war ich nicht verlegen, denn ich brauchte ihn nur vom Balkon herunterfallen zu lassen. Da ich aber nicht sicher war, ob sie ihn aufheben würde, fing ich es folgendermaßen an, um nicht einen Fehlschritt zu riskieren: Ich benutzte einen Augenblick, wo sie sich allein befand, und ließ ihr ein kleines in Briefform gefaltetes Stück Papier vor die Füße fallen. Auf dieses Papier hatte ich aber wohlweislich nichts geschrieben, und einen richtigen Brief hielt ich gleichzeitig in der Hand. Als ich sie sich bücken sah, um den ersten Brief aufzuheben, ließ ich schnell den zweiten fallen; sie hob auch diesen auf und steckte alle beide in die Tasche. Einen Augenblick darauf verschwand sie. Mein Brief lautete etwa so:
„Engel des Morgenlandes, ich bete Dich an. Ich werde die ganze Nacht auf dem Balkon verbringen, denn mich beseelt der Wunsch, daß Du nur auf eine einzige Viertelstunde kommst, um durch das Loch, das sich unter meinen Füßen befindet, meine Stimme zu hören. Wir werden leise sprechen; um mich zu hören, kannst Du auf den Ballen steigen, der gerade unter dem Loche liegt.“
Ich bat meinen Wächter, mich nicht einzuschließen, wie er es sonst allnächtlich tat; er willigte ein, unter der Bedingung, daß er mich beobachten könnte; denn wenn ich mir einfallen ließe, in den Hof hinunterzuspringen, so wäre es um seinen Kopf geschehen. Er versprach mir jedoch, nicht auf den Balkon zu kommen.
Um Mitternacht sah ich sie erscheinen – grade in dem Augenblick, wo ich an ihrem Kommen verzweifelte. Ich legte mich lang auf den Fußboden, so daß mein Kopf sich über dem Loche befand, das ein unregelmäßiges Quadrat von ungefähr sechs Zoll bildete. So sah ich sie auf den Ballen steigen, und ihr Kopf war nun einen Fuß vom Balkon entfernt. Sie mußte sich mit der einen Hand an der Mauer festhalten, weil ihr Stützpunkt unsicher war. So sprachen wir nun von uns, von Liebe, Sehnsucht, Hindernissen, Unmöglichkeit und Listen. Ich sagte ihr, warum ich nicht in den Hof hinunterspringen könnte, und sie bemerkte darauf: selbst wenn ich nicht durch diesen Grund aufgehalten würde, so würde ein solches Unterfangen uns ja doch ins Unglück stürzen, da ich unmöglich wieder hinaufgelangen könnte. Außerdem wisse nur Gott allein, was der Türke mit ihr anfangen würde, wenn er uns beieinander fände. Hierauf versprach sie mir, jede Nacht hinauszukommen, um mit mir zu sprechen, und steckte die Hand durch das Loch. Unersättlich küßte ich sie immer und immer wieder; mir war, als hätte ich in meinem Leben noch nicht eine so weiche und zarte Hand berührt. Aber welche Wonne, als sie mich um die meine bat! Schnell streckte ich meinen Arm durch das Loch und sie preßte ihre Lippen auf das Ellenbogengelenk. Welch süße Diebstähle erlaubte meine Hand sich da! Aber wir mußten uns trennen; als ich wieder in mein Zimmer trat, sah ich mit Vergnügen, daß der Wächter in tiefem Schlaf in einer Ecke lag.
Ich war zufrieden, denn ich hatte alles erhalten, was ich in der unbequemen Lage nur erwarten konnte; aber ich zerbrach mir den Kopf, um ein Mittel zu finden, wie ich mir in der nächsten Nacht noch mehr Genüsse verschaffen könnte. Da sah ich, daß der weibliche Spürsinn meiner schönen Griechin findiger war als der meinige. Sie befand sich mit ihrem Herrn im Hof und sagte ihm etwas auf türkisch, wozu er beistimmend nickte, gleich darauf kamen ein Diener und der Wächter und stellten einen großen Korb mit Waren unter den Balkon. Sie traf dabei die nötigen Anordnungen und ließ, scheinbar um für den Korb besser Platz zu machen, einen von den Baumwollballen kreuzweis über die beiden anderen legen. Freudig erschauernd erriet ich sofort ihre Absicht, sie verschaffte sich auf diese Weise das Mittel sich um zwei Fuß höher zu erheben. Ich sah aber sofort, daß sie dann eine sehr unbequeme Haltung annehmen müßte; sie müßte sich zusammenkrümmen und das würde sie nicht aushalten können. Das Loch war nicht groß genug, daß sie hätte den Kopf hindurchstecken und bequem aufrecht stehen können. Es galt ein Mittel zu finden, um diese Unbequemlichkeit zu beseitigen. Ich sah keine andere Möglichkeit, als das Brett loszureißen, aber das war nicht so leicht. Trotzdem entschloß ich mich, es auf alle Fälle zu versuchen, und ging in mein Zimmer, um nur eine große Zange zu holen. Der Wächter war nicht da, ich machte mir seine Abwesenheit zunutze und es gelang mir, vorsichtig die vier großen Nägel auszureißen, mit denen das Brett befestigt war. Als ich sah, daß ich es nach Belieben entfernen konnte, legte ich die Zange wieder auf ihren Platz und erwartete in verliebter Ungeduld die Nacht.
Der Gegenstand meiner Wünsche kam pünktlich um zwölf Uhr. Als ich sah, daß es ihr Mühe machte, auf den obersten Ballen hinaufzuklettern und sich darauf festzuhalten, hob ich das Brett aus, streckte ihr den Arm entgegen, soweit ich konnte, und bot ihr auf diese Weise einen festen Halt. Sie richtete sich auf und war angenehm überrascht, Kopf und Arme durch das Loch stecken zu können. Wir verloren keine lange Zeit mit Komplimenten; doch beglückwünschten wir uns gegenseitig, gemeinsam auf die Erreichung des gleichen Zieles hingearbeitet zu haben.
Hatte ich in der vorigen Nacht mehr sie gehabt als sie mich, so war jetzt das Umgekehrte der Fall. Ihre Hand verzehrte mein ganzes Sein, ich aber konnte auf halbem Wege nicht weiter. Sie verfluchte den Verfertiger des Baumwolleballens, daß er ihn nicht einen halben Fuß dicker gemacht hätte, damit sie mir näher kommen könnte. Auch damit wären wir noch nicht zufrieden gewesen; aber sie hätte doch mehr Genuß gehabt.
Unsere Freuden, wenngleich unfruchtbar, beschäftigten uns bis zum Morgengrauen. Ich setzte sorgfältig das Brett wieder ein und legte mich dann zu Bett; ich hatte es außerordentlich nötig, frische Kräfte zu sammeln. Bevor sie ging, sagte meine reizende Griechin mir noch, daß am Morgen ihr kleiner Beiram beginne; er daure drei Tage, und wir könnten uns erst am vierten wiedersehen.
In der ersten Nacht nach dem Beiram kam sie wirklich; sie sagte mir, ohne mich könne sie nicht glücklich werden; da sie Christin sei, so könne ich sie loskaufen; ich solle nach meiner Entlassung aus dem Lazarett auf sie warten.
Diese Erklärung zwang mich zu dem Geständnis, daß ich nicht die Mittel dazu besitze. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. In der folgenden Nacht sagte sie mir, ihr Herr würde sie für zweitausend Piaster verkaufen; sie sei Jungfrau, und ich werde mit ihr zufrieden sein. Sie werde mir ein Kästchen voll von Diamanten geben, von denen ein einziger zweitausend Piaster wert sei. Wir könnten die anderen verkaufen und von dem Erlös behaglich leben, ohne jemals Armut befürchten zu müssen. Sie versicherte mir, der Türke würde das Verschwinden des Kästchens gewiß nicht bemerken, und wenn auch, so würde er eher jeden anderen in Verdacht haben als sie.
Ich war verliebt in das Mädchen, der Vorschlag beunruhigte mich. Aber am nächsten Morgen beim Erwachen schwankte ich nicht mehr. Sie kam zur gewöhnlichen Stunde und brachte das Kästchen mit, ich sagte ihr jedoch, ich könne mich nicht entschließen, Mitschuldiger an einem Diebstahl zu werden Sie seufzte und sagte mir, ich liebe sie nicht, wie sie mich liebe, aber sie sehe wohl, ich sei ein Christ.
Es war die letzte Nacht; wir sahen uns aller Wahrscheinlichkeit nach zum letztenmal. Das Feuer, das durch unsere Adern strömte, verzehrte uns. Sie schlug mir vor, sie auf den Balkon hinaufzuziehen. Welcher Liebhaber wäre vor einem so lockenden Vorschlag zurückgewichen? Ich stand auf. Wenn ich auch nicht ein neuer Milon war, so umfaßte ich sie doch unter den Armen und zog sie zu mir hinauf. Schon war ich beinahe in ihrem Besitz, da fühle ich plötzlich, daß jemand meine Schultern packt. Es ist der Wächter. Er schreit mir zu: „Was machen Sie da?“ Ich lasse meine kostbare Last entgleiten. Das Mädchen läuft ins Haus. Ich stoße einen Wutschrei aus, werfe mich lang auf den Fußboden hin und rühre mich nicht, soviel mich auch der Wächter rüttelt und schüttelt.
Ich hätte den Menschen ermorden mögen. Endlich stand ich auf und ging zu Bett, ohne ihm ein Wort zu sagen. Ich legte nicht einmal das Brett wieder an seinen Platz. Am Morgen kam der Vorsteher und erklärte uns für frei. Als ich mit blutendem Herzen fortging, sah ich noch einmal die Griechin, deren Augen in Tränen schwammen.
Ich verabredete mit dem Vater Steffano, daß wir uns an der Börse treffen wollten, und ging mit dem Juden, dem ich die Möbelmiete zu bezahlen hatte, nach dem Minimenkloster, wo der Vater Lazari mir zehn Zechinen gab und die Adresse des Bischofs mitteilte. Er hatte seine Quarantäne an der toskanischen Grenze abgemacht und mußte schon nach Rom unterwegs sein. Dort sollte ich ihn finden.
Ich bezahlte den Juden und nahm darauf in einem Wirtshaus ein bescheidenes Mahl ein. Als ich von dort mich zu meinem Barfüßer begeben wollte, lief ich unglücklicherweise dem albanischen Schiffer in den Weg. Er schimpfte mich gehörig aus, daß ich ihn in dem Glauben belassen hätte, ich hätte meinen Koffer vergessen. Ich beschwichtigte ihn, indem ich ihm mein Unglück erzählte, und gab ihm eine schriftliche Bescheinigung, daß ich nichts von ihm zu beanspruchen hätte. Nachdem ich mir dann ein Paar Schuhe und einen (blauen) Mantel gekauft hatte, ging ich zu Steffano. Ich sagte ihm, ich wolle nach Loreto gehen. Dort würde ich drei Tage auf ihn warten und wir könnten dann zusammen nach Rom reisen. Er antwortete mir, er wolle nicht über Loreto wandern; es werde mir noch leid tun, die Gnade des heiligen Franziskus verschmäht zu haben. Am anderen Tage marschierte ich jedoch ab und zwar bei bester Gesundheit.
Todmüde kam ich in der heiligen Stadt an; denn ich hatte zum erstenmal in meinem Leben fünfzehn Miglien (ungefähr 24 Kilometer) zu Fuß gemacht und unterwegs nur Wasser getrunken, weil der gekochte Wein, den man in jener Gegend trinkt, mir den Magen verbrannte. Dabei war es über alle Maßen heiß. Ich muß hier bemerken, daß ich trotz meiner Armut nicht wie ein Bettler aussah.
Als ich die Stadt betrat, sah ich einen alten Abbate von ehrwürdigstem Aussehen mir entgegenkommen. Da ich sah, daß er mich musterte, grüßte ich ihn, sobald er bei mir war, und fragte ihn, wo ich einen anständigen Gasthof finden könnte. „Ich sehe“, sagte er, „daß jemand wie Sie, der zu Fuß reist, aus Frömmigkeit hierher kommt. Kommen Sie mit.“ Er kehrte um, ich folgte ihm, und er führte mich in ein stattliches Haus. Nachdem er leise ein paar Worte mit einem Mann gesprochen hatte, der mir der Hausmeister zu sein schien, ging er wieder. Zum Abschied sagte er mir mit vornehmem Anstande: „Sie werden gut bedient werden.“ Ich dachte mir sofort, daß man mich für einen anderen hielt. Aber ich ließ den Dingen ihren Lauf.
Man führte mich in ein Appartement von drei Zimmern; das Schlafzimmer war mit Damast tapeziert, das Bett hatte einen Baldachin. Außerdem stand ein Schreibpult darin, das alles zum Schreiben Nötige enthielt. Ein Bedienter brachte nur einen leichten seidenen Schlafrock, ging hinaus und kam sofort mit einem anderen wieder, der Wäsche und eine große Wanne mit Wasser trug. Diese wurde vor mich hingestellt, man zog mir Schuhe und Strümpfe aus und wusch mir die Füße. Einen Augenblick darauf kam eine sehr gut gekleidete Frau mit einer Dienerin, machte mir eine tiefe Verbeugung und begann mein Bett zurechtzumachen. Gerade als ich mit dem Fußbade fertig war, ließ sich eine Glocke hören, alle knieten nieder, und ich folgte ihrem Beispiel. Es war das „Angelus“. Hierauf wurde ein Tischchen sehr sauber gedeckt, und man fragte mich, welchen Wein ich wünsche. Ich antwortete: „Chianti.“ Hierauf brachte man mir die Zeitung und zwei silberne Armleuchter. Eine Stunde später wurde mir ein köstliches Abendessen, bestehend aus Fastenspeisen, aufgetragen. Vor dem Schlafengehen fragte man mich, ob ich meine Schokolade vor oder nach der Messe tränke. Ich sagte, den Grund der Frage erratend: „Vor dem Ausgehen!“ und begab mich zur Ruhe.
Sobald ich im Bett lag, brachte man mir eine Nachtlampe mit einem Zifferblatt, und ich blieb allein. Ich fand mich in einem Bett liegen, wie ich es sonst nur in Frankreich gefunden habe; es war danach angetan, einen von der Schlaflosigkeit zu heilen. Aber an dieser Krankheit litt ich nicht. Ich schlief zehn Stunden.
An der Behandlung merkte ich leicht, daß ich nicht in einem Gasthof war. Aber wo war ich? Konnte ich erraten, daß ich mich in einem Hospital befand?
Nach der Schokolade erscheint ein geschniegelter und gebügelter Friseur, der vor Schwatzlust zappelt. Er errät, daß ich nicht rasiert sein will, und erbietet sich, mir mein Flaumhaar mit der Schere zu schneiden. Dadurch würde ich jünger aussehen.
„Wer hat Ihnen denn gesagt, daß ich mein Alter verbergen möchte?“
„Das ist doch ganz einfach. Wenn Monsignore nicht diese Absicht hätten, würden Sie sich schon längst haben rasieren lassen. Gräfin Marcolini ist hier. Kennen Monsignore die Dame? Ich soll sie heute mittag frisieren.“
Da er sah, daß die Gräfin Marcolini mich nicht interessierte, ging der Schwätzer zu einem anderen Thema über:
„Wohnen Monsignore zum erstenmal hier? In allen Staaten unseres Herrn ist kein so prachtvolles Hospital wie dieses.“
„Das glaube ich wohl, und ich werde Seiner Heiligkeit mein Kompliment darüber machen.“
„O, er weiß es selber sehr gut! Vor seiner Wahl hat er selbst hier gewohnt. Hätte Monsignore Caraffa Sie nicht gekannt, so würde er Sie nicht eingeführt haben.“
In solchen Dingen sind die Friseure in ganz Europa ausgezeichnet; aber man darf sie nicht ausfragen, denn dann mengen sie frech Wahrheit und Lügen durcheinander und forschen selber aus, anstatt sich ausforschen zu lassen.
Ich glaubte, Monsignore Caraffa meine Aufwartung machen zu müssen, und ließ mich zu ihm führen. Der Prälat empfing mich sehr gut, zeigte mir seine Bücherei und gab mir als Cicerone einen seiner Abbaten mit. Ich fand in ihm einen Altersgenossen und geistvollen Gesellschafter. Er zeigte mir alles. Zwanzig Jahre später wurde dieser Abbate mir in Rom nützlich; wenn er noch lebt, ist er Kanonikus bei San Giovanni in Laterano.
Am zweiten Tage nahm ich in der Santa Casa das Abendmahl; den dritten Tag verwandte ich auf die Besichtigung aller Wunderschätze des Heiligtums. Am anderen Morgen machte ich mich in aller Frühe wieder auf den Weg; ich hätte im ganzen nur drei Paoli für den Friseur ausgegeben.
Auf halbem Wege nach Macerata fand ich den Bruder Steffano wieder, der sehr langsam wanderte. Er war sehr erfreut, mich wiederzusehen, und sagte mir, er sei zwei Stunden nach mir von Ancona abmarschiert; er mache aber täglich nur drei Miglien, denn es sei ihm ganz recht, wenn er volle zwei Monate unterwegs bleibe, obgleich man sogar zu Fuß in acht Tagen nach Rom kommen könne.
„Ich will“, sagte er, „in Rom frisch und bei guter Gesundheit ankommen. Ich habe gar keine Eile, und wenn Sie Lust haben, in dieser Weise mit mir zu reisen, so wird es dem heiligen Franziskus nicht schwer fallen, uns beiden Unterhalt zu verschaffen.“
Der Kerl war ein rothaariger Bursche von dreißig Jahren, von starken Gliedern; ein richtiger Bauer, der nur Mönch geworden war, um bequem von Nichtstun zu leben. Ich antwortete ihm, ich habe Eile und könne daher nicht sein Begleiter sein.
„Ich werde heute eine doppelte Tagreise machen“, sagte er, „wenn Sie mir meinen Mantel tragen wollen; denn der drückt mich sehr.“
Ich fand die Geschichte spaßhaft, zog seinen Mantel an und ließ ihn meinen Überrock anlegen. In dieser Verkleidung sahen wir so komisch aus, daß alle Vorüberkommenden über uns lachten. Sein Mantel hätte wirklich eine volle Ladung für ein Maultier abgegeben. Es waren darin zwölf Taschen, und zwar alle voll. Dazu kam dann noch die hintere Tasche, die er il batticulo nannte; diese enthielt allein das Doppelte von dem, was in allen anderen zusammen war. Brot, Wein, frisches und gesalzenes Fleisch, Hühner, Eier, Käse, Schinken, Würste waren für mindestens vierzehn Tage vorhanden.
Als ich ihm erzählte, wie man mich in Loreto aufgenommen hatte, sagte er mir, wenn ich von Monsignore Caraffa einen Freischein für alle Hospitale bis Rom verlangt hätte, würde ich überall die gleiche Aufnahme gefunden haben. „Die Hospitäler“, fuhr er fort, „sind alle von San Francesco verflucht, weil in ihnen keine Bettelmönche aufgenommen werden; übrigens machen wir uns nichts aus ihnen, weil sie zu weit voneinander entfernt liegen. Wir ziehen die Häuser der unserem Orden ergebenen Frommen vor, die wir auf unserem Wege finden.“
„Warum suchen Sie nicht in Ihren Klöstern Unterkunft?“
„So dumm bin ich nicht. Erstens würde man mich nicht aufnehmen, denn als Flüchtling habe ich keinen schriftlichen Erlaubnisschein, und den wollen sie immer haben. Ich würde sogar in Gefahr sein, ins Gefängnis gesteckt zu werden; denn die Mönche sind ein verfluchtes Pack. Zweitens sind wir in unseren Klöstern nicht so gut aufgehoben wie bei unseren Wohltätern.“
„Wie? Sie sind Flüchtling? Warum denn?“
Er erzählte mir nun über seine Gefangenschaft und Flucht eine Geschichte voll von abgeschmackten Lügen. Dieser flüchtige Barfüßer war ein Dummkopf mit Harlekinswitz; er hielt aber seine Zuhörer für noch viel größere Dummköpfe, als er selber war. Bei all seiner Dummheit besaß er aber doch eine gewisse Verschmitztheit. Seine Religion war sehr eigenartig. Er wollte kein Frömmler sein und wurde dadurch skandalös; um seine Zuhörer zum Lachen zu bringen, erlaubte er sich die ekelhaftesten Bemerkungen. Er hatte gar kein Gefühl für das weibliche Geschlecht und für fleischliche Genüsse; aber das lag nur an seinem Mangel an Temperament. Dabei verlangte er jedoch, man solle diesen Mangel als Tugend der Enthaltsamkeit an ihm bewundern. Das ganze Gebiet des Geschlechtlichen war für ihn nur dazu da, Lachlust zu erregen. Wenn er etwas angetrunken war, richtete er an die Tischgenossen so unanständige Fragen, daß alle darüber erröteten. Der Kerl aber lachte nur dazu.
Als wir hundert Schritt vor dem Hause des Wohltäters entfernt waren, den er mit seinem Besuch beehren wollte, zog er seine schwere Kutte wieder an. Beim Eintritt gab er allen seinen Segen, und jeder küßte ihm die Hand. Da die Hausfrau ihn bat, ihnen eine Messe zu lesen, war der Mönch ihnen zu Willen uns ließ sich in die Sakristei führen; als ich ihm unbemerkt ins Ohr flüsterte: „Haben Sie denn vergessen, daß Sie schon gefrühstückt haben?“ antwortete er nur grob: „Das geht Sie nichts an.“
Ich wagte ihm hierauf nichts zu erwidern; ich wohnte der Messe bei und war begreiflicherweise sehr überrascht, als ich sah, daß er das Rituell nicht kannte. Dies fand er spaßhaft, aber das eigentlich Komische der Geschichte sollte erst noch kommen. Sobald er, so gut es eben ging, seine Messe zu Ende gelesen hatte, setzte er sich in den Beichtstuhl und nahm der ganzen Familie die Beichte ab. Dabei hatte er den Einfall, der Tochter des Hauses, einem reizend hübschen Kind von zwölf oder dreizehn Jahren, die Absolution zu verweigern. Und zwar machte er das öffentlich; er schult sie aus und drohte ihr mit der Hölle. Das arme Mädchen verließ voller Scham die Kapelle und vergoß heiße Tränen; sie tat mir leid, und in meinem Zorn konnte ich mich nicht enthalten, dem Bruder Steffano laut ins Gesicht zu sagen, er sei verrückt. Ich lief ihr nach, um sie zu trösten; aber sie war schon verschwunden und war nicht zu bewegen, sich mit uns zu Tische zu setzen. Sein unglaubliches Betragen brachte mich dermaßen auf, daß ich Lust hatte, ihn durchzuprügeln. Vor allen Leuten nannte ich ihn einen Betrüger und gemeinen Ehrabschneider an dem jungen Mädchen. Ich fragte ihn, warum er ihr die Absolution verweigert habe; er schloß mir aber den Mund, indem er kaltblütig antwortete, er dürfe das Beichtsiegel nicht verraten. Ich aß nicht mit und war fest entschlossen, mich von dem Schelm zu trennen. Als wir gingen, mußte ich einen Paolo für die von ihm gelesene falsche Messe annehmen. Ich mußte das traurige Amt seines Kassierers versehen. Sobald wir auf der Landstraße waren, sagte ich ihm, ich wolle mich von ihm trennen, weil ich auf die Galeeren zu kommen fürchte, wenn ich noch weiter mit ihm gehe. Unter anderem nannte ich ihn einen unwissenden Schurken; er sagte dagegen, ich sei bloß ein Bettler. Hierauf versetzte ich ihm eine kräftige Ohrfeige, auf die er mit einem Stockhieb antwortete. Ich entwaffnete ihn aber augenblicklich, ließ ihn stehen und ging nach Macerata zu. Eine Viertelstunde darauf erbot sich ein Kutscher, der mit leerem Wagen nach Tolentino fuhr, mich für zwei Paoli bis dahin mitzunehmen. Ich nahm das an. Von dort hätte ich für sechs Paoli nach Foligno kommen können, aber aus unglückseliger Sparwut schlug ich das Anerbieten aus. Ich befand mich wohl und glaubte leicht zu Fuß noch bis Valcimara gelangen zu können. Aber ich kam dort erst nach fünfstündigen. Marsch und todmüde an. Ich war kräftig und gesund, aber ein Weg von fünf Stunden genügte, um mich völlig zu erschöpfen, weil ich in meiner Kindheit niemals eine Meile zu Fuß gemacht hatte. Man kann gar nicht genug Wert darauf legen, die Jugend an Märsche zu gewöhnen.
Am anderen Morgen stand ich ausgeruht auf und wollte meinen Weg fortsetzen. Ich will den Wirt bezahlen – da gibt’s ein neues Unglück! Man stelle sich meine traurige Lage vor: ich erinnerte mich, daß ich meine Börse mit sieben Zechinen im Wirtshaus in Tolentino hatte auf dem Tisch liegen lassen, als ich, um zu bezahlen, eine Zechine wechseln ließ. Ich war trostlos. Erst wollte ich umkehren, um sie zu verlangen; aber ich gab diesen Gedanken auf, denn ich wußte ja nicht, ob man sie würde herausgeben wollen. Leider enthielt aber diese Börse all mein Geld mit Ausnahme einiger Kupfermünzen, die ich in der Tasche hatte. Ich bezahlte meine kleine Zeche und machte mich bekümmerten Herzens auf den Weg nach Serravalle. Ich war nur noch eine Stunde von diesem Ort entfernt, als ich beim überspringen eines Grabens mir den Fuß verrenkte. Ich muß mich an den Wegrain setzen und habe den einzigen Trost, den die Religion allen Bedrängten bietet. Ich bitte Gott, er wolle jemand vorübergehen lassen, der mir helfen könne.
So saß ich seit einer halben Stunde, als ein Bauer, der mit seinem Esel vorbeikam, sich bereit erklärte, mich für einen Paolo nach Serravalle zu bringen. Um mir Geld zu sparen, führte der Bauer mich zu einem Mann mit einem Verbrechergesicht, der gegen Vorauszahlung von zwei Paoli mich aufnahm. Ich bat ihn, einen Wundarzt zu beschaffen, konnte diesen aber erst am anderen Tage haben. Ich erhielt ein elendes Abendessen und legte mich hierauf in ein grausig aussehendes Bett. Ich hoffte schlafen zu können und im Schlummer einige Erleichterung zu finden; aber gerade dies Bett hatte mein böser Genius dazu ausersehen, mich Höllenqualen leiden zu lassen. Drei Männer mit Karabinern, die wie rechte Banditen aussahen, kamen nach einiger Zeit, sprachen ein Kauderwelsch, das ich nicht verstand, und fluchten und wetterten, ohne auf mich die geringste Rücksicht zu nehmen. Nachdem sie bis Mitternacht gezecht und gesungen hatten, legten sie sich auf Stroh nieder, und mein betrunkener Wirt kam, zu meiner großen Überraschung, und wollte sich neben mich legen. Empört, daß ich mit einem solchen Geschöpf in einem Bett liegen sollte, rief ich aus, ich würde ihn nicht neben mir dulden; er aber versetzte mit gräßlichen Flüchen, die ganze Hölle solle ihn nicht abhalten, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Ich mußte ihm Platz machen.
„Um des Himmels willen!“ schrie ich; „bei wem bin ich denn.?“
„Beim ehrenwertesten Sbirren im ganzen Kirchenstaat.“
Konnte ich ahnen, daß der Bauer mich zu diesen verfluchten Feinden des ganzen Menschengeschlechtes führen würde?
Der Mensch legt sich ins Bett; bald aber zwingt mich der gemeine Halunke, ihm einen so kräftigen Stoß vor die Brust zu geben, daß ich ihn aus dem Bett hinauswerfe. Er sieht auf und erneuert schamlos seinen Angriff. Ich fühle, daß ich nur mit eigener Lebensgefahr ihn zu Boden schlagen könne, stehe auf, da er sich dem zum Glück nicht widersetzt, schleppe mich so gut es geht zu einem Stuhl und verbringe auf diesem den Rest der Nacht, vier traurige Stunden. Bei Tagesanbruch wurde der Halunke von seinen Kameraden geweckt, er stand auf, und nachdem sie wieder getrunken und gelästert hatten, nahmen sie ihre Karabiner und gingen.
Nachdem das Lumpenpack fort war, verbrachte ich noch eine traurige Stunde. Vergebens rief ich nach Hilfe. Endlich kam ein kleiner Junge hinein und holte mir für ein paar Kupfermünzen einen Wundarzt. Dieser untersuchte mich und versicherte mir, eine drei- oder viertägige Ruhe würde mich völlig wiederherstellen. Er riet mir, mich in einen Gasthof bringen zu lassen; gern nahm ich diesen guten Rat an. Ich wurde hingetragen, in ein Bett gelegt und gut behandelt; aber ich befand mich in einer so unangenehmen Lage, daß ich den Augenblick meiner Wiederherstellung fürchtete. Ich befürchtete meinen Überrock verkaufen zu müssen, um den Wirt bezahlen zu können, und dieser Gedanke war mir entsetzlich. Unwillkürlich mußte ich denken: hätte ich meine Teilnahme für das von Steffano so schlecht behandelte Mädchen zurückgedrängt, so wäre ich nicht in eine so traurige Lage geraten. Ich fand jetzt meinen Eifer übel angebracht. Wenn ich mich dem Barfüßer hätte können… Ja! Wenn, wenn, wenn, alle diese Wenn zerreißen einem Unglücklichen das Herz, sobald er anfängt zu denken. Denn nachdem er seine Gedanken von allen möglichen Seiten betrachtet hat, ist er noch ebenso unglücklich wie zuvor. Ich will jedoch gestehen, daß solche vom Unglück angeregte Betrachtungen durchaus nicht ohne Vorteil für einen jungen Menschen sind; denn dadurch gewöhnt er sich ans Denken. Und aus einem Menschen, der nicht denkt, wird niemals etwas.
Am Morgen des vierten Tages fühlte ich mich wieder marschfähig, wie der Wundarzt es mir vorausgesagt hatte. Ich entschloß mich, den braven Mann zu bitten, er möge für mich meinen Überrock verkaufen. Dies war eine nicht sehr tröstliche Notwendigkeit, denn der Herbstregen begann. Meinem Wirt war ich fünfzehn Paoli schuldig und vier dem Chirurgen. Im Augenblick wo ich ihm den schmerzlichen Auftrag geben wollte, den Rock zu verkaufen, trat Bruder Steffano ein. Er lachte aus vollem Halse und fragte mich, ob ich den Stockhieb vergessen hätte.
Ich fiel aus den Wolken!
Ich bat den Wundarzt, mich mit dem Mönch allein zu lassen, und er ging.
Ich frage den Leser: wie kann man sich des Aberglaubens erwehren, wenn man solche Erlebnisse hat? Am erstaunlichsten ist in diesem Fall, wie es gerade auf die Minute eintraf: Der Mönch erschien gerade in dem Augenblick, wo ich den Mund auftun wollte. Noch mehr war ich erstaunt über die Macht der Vorsehung, des Glücks, des Zufalles oder wie man es nennen will, mit einem Wort über das ganz notwendige Zusammentreffen verschiedener Umstände, das mir keine andere Wahl ließ als alle meine Hoffnungen nur auf diesen Mönch zu setzen, der in Chiozza in demselben Augenblick, wo meine Not begann, mein Schutzgeist geworden war.
Und was für ein Schutzgeist, dieser Steffano! Ich muß in dieser Macht des Schicksals mehr eine Strafe als eine Gunst erkennen.
Sein Erscheinen war jedoch nur angenehm, denn ich zweifelte nicht einen Augenblick daran, daß er mich aus der Verlegenheit ziehen würde. Und mochte er mir vom Himmel oder von der Hölle zugesandt worden sein – ich fühlte, daß ich nichts Besseres tun konnte, mich seinem Einfluß zu unterwerfen. Seine ihm von Schicksal zugewiesene Bestimmung war es mich nach Rom zu bringen.
Chi va piano va sano, sagte nur der Mönch, sobald wir allein waren. Er hatte fünf Tage gebraucht, um den Weg zurückzulegen, den ich in einem Tage gemacht hatte; aber er war wohlauf und hatte keinerlei Unfall gehabt. Er erzählte nur, man habe ihm, als er vorübergekommen sei, gesagt, der Abbate, der als Sekretär beim venetianischen Botschafter eintreten solle, liege krank im Gasthof, nachdem er in Valcimara bestohlen worden sei. „Ich habe Sie aufgesucht, und da Sie ja wieder ganz gesund sind, so werden wir miteinander nach Rom gehen; Ihnen zu Gefallen werde ich täglich sechs Miglien machen. Alles möge vergessen sein, und nun schnell auf nach Rom!“
„Ich kann nicht. Ich habe meine Börse verloren und soll zwanzig Paoli bezahlen.“
„Die werde ich im Namen des heiligen Franziskus besorgen.“
Eine halbe Stunde darauf kam er zurück, aber mit wem? Mit meinem niederträchtigen Sbirren! Dieser sagte mir, wenn ich ihm anvertraut hätte, wer ich wäre, würde er mich gerne ganz bei sich behalten haben. „Ich gebe Dir“, sagte er weiter, „vierzig Paoli, wenn Du Dich verpflichtest, mir die Protektion Deines Gesandten zu besorgen; aber wenn Dir das nicht gelingt, mußt Du sie mir in Rom zurückgeben. Du mußt mir also einen Schuldschein darüber schreiben.“
„Gern.“
In einer Viertelstunde war alles abgemacht; ich erhielt das Geld, bezahlte meine Schulden und marschierte mit Steffano ab.
Es war kaum erst ein Uhr Mittag, als der Mönch eine armselige Hütte hundert Schritte vom Wege ab bemerkte und mir sagte: „Bis Collefiorito ist noch sehr weit; wir müssen hier haltmachen und die Nacht zubringen.“
Vergebens stellte ich ihm vor, wir würden in der Hütte schlecht aufgehoben sein; er schlug alles in den Wind, und ich mußte mich seinem Willen unterwerfen. Wir fanden einen ausgemergelten, schwindsüchtigen Greis, der auf einem elenden Bette lag, zwei häßliche Weiber von dreißig bis vierzig Jahren, drei nackte Kinder, eine Kuh und einen verdammten Köter, der fortwährend bellte. Ein des Elends. Aber der Mönch war hartnäckig; anstatt ihnen ein Almosen zu geben, verlangte er im Namen des heiligen Franziskus ein Abendessen. „Ihr müßt“, sagte der Sterbende zu den Weibern, „das Huhn kochen und die Flasche aus dem Keller holen, die ich seit 20 Jahren verwahre.“ Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so bekam er einen so starken Hustenanfall, daß ich glaubte, er würde vor unseren Augen sterben. Der Mönch trat an sein Bett und versprach ihm, San Francesco werde ihn wieder jung machen. Beim Anblick dieses Elends von Mitleid durchdrungen, wollte ich allein nach Collefiorito gehen und dort auf den Mönch warten, aber die Frauen widersetzten sich, und ich blieb. Nach Verlauf von vier Stunden schien das Huhn die besten Zähne herausfordern zu wollen und in der Flasche, die ich entkorkte, war Essig. Da verliere ich die Geduld, ich nehme den batticulo des Mönches her und lege ein gutes Abendessen auf den Tisch; beim Anblick unserer Eßwaren verklären sich die Gesichter der beiden Frauenzimmer.
Wir aßen alle mit gutem Appetit; dann wurden für uns zwei große Lagerstätten aus frischem Stroh zurechtgemacht, auf die wir uns im Dunkeln hinlegten, da das einzige Lichtstümpchen, das in der traurigen Behausung sich vorfand, erloschen war. Kaum liegen wir fünf Minuten auf unserem Stroh, da ruft der Mönch mir zu, ein Weib habe sich zu ihm gelegt, und im selben Augenblick umarmt mich die andere. Ich stoße sie zurück, der Mönch wehrt sich; die schamlose Vettel will nicht von mir ablassen: ich stehe auf, der Hund springt mir an die Kehle, und aus Furcht lege ich mich ruhig wieder auf mein Stroh. Die Unverschämte ließ sich durch nichts stören, mich zu Dingen aufzumuntern, zu denen ich keine Lust hatte. Der Spektakel aber, den der Mönch machte, sich die Seinige abzuwehren, ward mir so lächerlich, daß aller Zorn darüber verging. Der Narr rief laut den heiligen Franziskus um Hilfe an, weil er auf meine nicht rechnen konnte. Der Mönch schreit, flucht, schlägt um sich; der Hund bellt wie rasend, der Greis hustet; es ist ein Höllenlärm. Die Dirne bei mir sagte, sie würde wieder weggehen, wenn ich nur ein wenig gefälliger wäre. Ich dachte: sublata laterna nullum discrimen inter mulieres. – Im Dunkeln sind alle Weiber gleich. Endlich glückt es Steffano, den seine dicke Kutte schützt, sich den Liebkosungen seiner Megäre zu entziehen, dem Hunde zum Trotz steht er auf, und es gelingt ihm, seinen dicken Stock zu erwischen. Nun schlägt er nach rechts und links um sich; eins von den beiden Weibern schreit: „Au! Mein Gott!“ Der Barfüßer antwortet: „Die ist hin!“ Es wird wieder ruhig. Der Hund, den er ohne Zweifel totgeschlagen hatte, bellte nicht mehr; der Greis, dem er vielleicht den Garaus gemacht hatte, hustete nicht mehr; die Weiber, die vor den Liebenswürdigkeiten des Mönches Angst hatten, hielten sich still in der Ecke. Den übrigen Teil der Nacht hatten wir Ruhe.
Sobald der Morgen graut, stehe ich auf; Steffano folgt meinem Beispiel. Ich sehe mich überall um und bin im höchsten Grade erstaunt, als ich sehe, daß die Weiber verschwunden sind. Der Greis lag da, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben; er hatte eine große Beule auf der Stirn. Ich zeigte sie dem Mönch und sagte ihm, vielleicht hätte er ihn totgeschlagen. „Das kann wohl sein“, antwortete er, „aber wenn ich es getan habe, so geschah es nicht mit Absicht.“
Nun holte er seinen batticulo und geriet in eine fürchterliche Wut, als er die Riesentasche ganz leer fand. Ich freute mich sehr darüber, denn ich hatte befürchtet, die Weiber wären fortgegangen, um Hilfe zu holen und uns verhaften zu lassen. Das Verschwinden unserer Eßvorräte beruhigte mich, denn nun war es sicher, daß die elenden Weiber sich nur aus dem Staube gemacht hatten, um nicht wegen des Diebstahls zur Rechenschaft gezogen zu werden. Trotzdem unterließ ich es nicht, dem Mönch in lebhaften Farben die Gefahren zu schildern, die uns drohten, und es gelang mir, ihm so viel Angst zu machen, daß er sich bereit erklärte, mit mir fortzugehen. Dicht bei dem Hause trafen wir einen Fuhrmann, der nach Foligno wollte. Ich überredete Steffano, sich mit mir diese Gelegenheit zunutze zu machen, um uns schnell zu entfernen. Während wir in Foligno frühstückten, kam ein anderer Kutscher ebenfalls mit einem leeren Wagen, der uns für eine Kleinigkeit mitnahm. So gelangten wir nach Pisignano, wo ein frommer Mann uns sehr gutes Quartier gab. Hier tat ich einen guten Schlaf, denn ich hatte jetzt keine Furcht mehr, verhaftet zu werden.
In der Frühe des nächsten Tages kamen wir nach Spoleti, wo Bruder Steffano zwei Wohltäter hatte. Da er ihnen keinen Anlaß zur Eifersucht geben wollte, begünstigte er sie beide. Wir aßen zu Mittag bei dem einen, der uns wie Fürsten bewirtete, und nahmen Abendessen und Nachtlager bei dem anderen. Dieser war ein reicher Weinhändler, Vater einer zahlreichen und reizenden Familie. Er gab uns ein köstliches Abendessen, und alles wäre sehr nett verlaufen, wenn sich nicht der Mönch, der schon heim Mittagessen ein bißchen viel des Guten genossen hatte, völlig betrunken hätte; in diesem Zustand ließ er sich einfallen, von dem anderen Wohltäter schlecht zu reden; vielleicht dachte er, er tue damit unserem Wirt einen Gefallen. Dies konnte ich nicht ertragen. Als er behauptete, jener habe gesagt, alle Weine unseres Wirtes seien verfälscht und dieser sei ein Spitzbube, da nannte ich ihn ins Gesicht einen Lügner und Schuft. Unser Wirt und seine Frau beruhigten mich, indem sie mir versicherten, sie kennten ihren Nachbarn und wüßten wohl, was sie von ihm zu halten hätten. Der Mönch schmiß mir seine Serviette an den Kopf, als ich ihm seine Lügen vorwarf. Nun nahm ihn unser Wirt sachte unter den Arm, führte ihn in ein Schlafzimmer und schloß ihn ein. Ich legte mich in einem anderen Zimmer zu Bett.
Am anderen Morgen stand ich schon in aller Frühe auf und beschloß, allein weiterzureisen. Aber inzwischen hatte der Mönch seinen Rausch ausgeschlafen; er kam zu mir und sagte, in Zukunft müßten wir in gutem Einverständnis leben und uns nicht mehr erzürnen. Ich fügte mich meinem Schicksal. Wir machten uns wieder auf den Weg. In Sorna gab uns die Wirtin des Gasthauses, eine Frau von seltener Schönheit, ein gutes Mittagessen mit ausgezeichnetem Cypernwein; diesen bringen ihr die venetianischen Kuriere in Austausch gegen vortreffliche Trüffeln, die sie ihnen dafür gibt, und die von ihnen bei ihrer Rückkehr in Venedig vorteilhaft verkauft werden. Ich konnte nicht von ihr scheiden, ohne ihr ein Stückchen von meinem Herzen zurückzulassen.
Kaum kann ich die Entrüstung schildern, die mich erfaßte, als ein paar Miglien vor Terni der niederträchtige Mönch mir ein Säckchen mit Trüffeln zeigte, das zum Dank für ihre dienstbereite Gastfreundschaft das Ungeheuer der reizenden Frau gestohlen hatte. Die gestohlenen Trüffeln waren wenigstens zwei Zechinen wert. Außer mir vor Zorn, stieß ich ihm den Sack aus der Hand und sagte ihm, ich wolle diesen auf alle Fälle der Wirtin zurückschicken. Er hatte aber den Streich keineswegs ausgeübt, um sich den Genuß einer Zurückerstattung gestohlenen Guts zu verschaffen; er warf sich auf mich, und es entspann sich zwischen uns eine regelrechte Prügelei. Der Sieg blieb jedoch nicht lange ungewiß; ich nahm ihm seinen Stock weg, warf ihn rücklings in den Graben und ging. Von Terni aus schrieb ich einen Entschuldigungsbrief an die schöne Wirtin und schickte ihr ihre Trüffeln zurück.
Von Terni ging ich zu Fuß nach Otricoli, wo ich mich nur so lange aufhielt, um in aller Muße mir die schöne antike Brücke anzusehen. Dann nahm ein Vetturino mich für vier Paoli bis Castelnuovo mit, und von dort begab ich mich um Mitternacht zu Fuß nach Rom. Am ersten September um neun Uhr morgens kam ich in der berühmten Stadt an.
Ich darf hier einen sehr eigentümlichen Umstand nicht verschweigen, der mehr als einem Leser gefallen wird, obgleich er im Grunde nur lächerlich war.
Die Luft war ruhig und der Himmel heiter. Eine Stunde hinter Castelnuovo bemerkte ich in einer Entfernung von zehn Schritten an meiner Rechten eine spannenhohe, pyramidenförmige Flamme, die etwa vier oder fünf Fuß über dem Erdboden schwebte. Diese Erscheinung fiel mir auf, denn sie schien mich zu begleiten. Ich wollte sie genauer untersuchen und suchte mich ihr zu nähern, aber sie wich mir aus und blieb immer in der gleichen Entfernung. Sie blieb stehen, sobald ich stillstand; wenn der Rand der Straße mit Bäumen eingefaßt war, verschwand die Flamme und ich sah sie nicht mehr; aber ich fand sie wieder, sobald der Wegrain wieder frei wurde. Ich versuchte auch umzukehren, aber jedesmal verschwand sie und erschien erst wieder, wenn ich von neuem meine Schritte auf Rom zulenkte. Das eigenartige Feuerzeichen verließ mich erst, als das Tageslicht die Schatten der Finsternis verscheuchte.
Welch einen Tummelplatz hätte nicht der unwissende Aberglaube gefunden, wenn ich Zeugen für das Ereignis gehabt hätte und später in Rom sich mir eine glänzende Laufbahn aufgetan hätte! Die Weltgeschichte ist voll von Kleinigkeiten, die genau so viel Wichtigkeit haben, und die Welt ist voll von Leuten, die noch immer viel auf so etwas geben, trotz der vorgeblichen Aufklärung, die der menschliche Geist durch die Wissenschaft empfängt. Ich muß aufrichtig gestehen, daß trotz meinen physikalischen Kenntnissen der Anblick des kleinen Irrlichtes mir doch recht eigentümliche Gedanken eingeflößt hat. Ich war so vorsichtig, keinem Menschen je davon zu sprechen.
Ich hatte bei meinem Eintreffen in der alten Hauptstadt der Welt nur sieben Paoli in der Tasche. Daher ließ ich mich denn auch durch nichts aufhalten: weder das schöne Eingangtor, das Pappeltor, das von der Unwissenheit pomphaft porta del popolo genannt wird, noch von dem ebenso benannten schönen Platz, noch von den Portalen der schönen Kirchen, mit einem Wort: gar nichts von allen imposanten Denkmälern der schönen Stadt machte beim ersten Sehen Eindruck auf mich. Ich ging auf dem nächsten Weg nach Monte-Magna-Napoli, wo ich – so stand es in der Adresse – meinen Bischof finden sollte. Man sagte mir, er sei vor zehn Tagen abgereist und habe Befehl hinterlassen, mich kostenfrei nach Neapel zu befördern an eine Adresse, die mir ubergeben wurde. Ein Wagen dorthin ging schon am nächsten Tage ab; ich machte mir nichts daraus, Rom zu sehen, und blieb bis zum Augenblick der Abfahrt im Bett liegen. Meine Reisegenossen waren drei ungeschliffene Lümmel; ich fuhr mit ihnen den ganzen Weg zusammen und sprach kein einziges Wort mit ihnen. Am sechsten September kam ich in Neapel an.
Kaum aus dem Wagen gestiegen, begebe ich mich nach dem auf der Adresse genannten Ort: der Bischof ist nicht da. Ich gehe sofort zu den Minimen und erfahre bei diesen, daß er nach Martorano abgereist ist. Vergebens erkundige ich mich, ob er nicht Aufträge in bezug auf mich hinterlafsen hahe. Niemand kann mir Bescheid geben. Da stehe ich nun in der Riesenstadt, wo ich keinen Menschen kenne, mit acht Carlinen in der Tasche, und weiß nicht, wo ich mein Haupt niederlegen soll. Einerlei! Mein Schicksal ruft mich nach Martorano. Dorthin werde ich gehen. Die Entfernung beträgt nur zweihundert Miglien (Etwa fünfzig deutsche Meilen).
Ich finde einige Vetturini, die nach Cosenza fahren wollen. Als sie aber hören, daß ich keinen Koffer habe, wollen sie nichts von mir wissen, wenn ich nicht vorausbezahle. Ich mußte ihnen innerlich recht geben. Aber ich mußte nach Martorano. Ich entschloß mich, den Spaziergang zu Fuß zu machen und ganz frech um Essen und Nachtlager zu betteln, wie es der hochwürdigste Bruder Steffano tat. Zunächst nehme ich für den vierten Teil meines Geldes ein bescheidendes Mahl ein. Das weitere wird sich finden. Ich erfahre, daß ich über Salerno gehen muß, und schlage die Richtung nach Portici ein, wo ich nach anderthalb Stunden anlange. Schon begann sich die Müdigkeit fühlbar zu machen; ich wollte es eigentlich nicht, aber meine Beine lenkten mich zu einem Gasthaus, wo ich ein Zimmer und Abendessen verlangte. Ich werde sehr gut bedient, esse mit gutem Appetit und verbringe eine ausgezeichnete Nacht in einem guten Bett. Am andern Morgen sage ich, nachdem ich mich angezogen habe, zum Wirt, ich würde zu Mittag speisen, und gehe aus, um mir das Königliche Schloß anzusehen. Am Eingang desselben werde ich von einem orientalisch gekleideten Mann mit einnehmenden Gesichtszügen angesprochen. Er sagt mir, wenn ich den Palast besichtigen wollte, würde er mir alles zeigen; auf diese Weise sparte ich mein Geld. Ich war in der Lage, nichts abschlagen zu dürfen; so nahm ich denn sein freundliches Anerbieten dankend an.
Als ich im Laufe der Unterhaltung ihm mitteilte, ich sei Venetianer, sagte er mir, dann sei er mein Untertan, denn er sei von Zante. Ich nahm das Kompliment für das, was es wert war, und machte ihm nur eine leichte Verbeugung.
„Ich habe“, sagte er, „ausgezeichneten Muskatwein aus der Levante, den ich Ihnen billig verkaufen könnte.“
„Ich würde vielleicht welchen kaufen, aber ich bin Kenner.“
„Um so besser. Welchen ziehen Sie vor?“
„Cerigo.“
„Sie haben recht. Ich habe ausgezeichneten Cerigo. Wir werden ihn beim Mittagessen versuchen, wenn es Ihnen recht ist, daß wir miteinander speisen.“
„Recht gern.“
„Ich habe Samos und Kephalonier. Ich habe auch ein Quantum Mineralien: Vitriol, Zinnober, Antimon und hundert Zentner Quecksilber.“
„Alles hier?“
„Nein, in Neapel.“
„Ich werde auch Quecksilber kaufen.“
Es ist ganz natürlich und geschieht ohne jede Absicht einer Täuschung, wenn ein junger Mensch, der an Armut nicht gewöhnt ist und sich schämt, arm zu erscheinen, im Gespräch mit einem Reichen von seinem Vermögen, seinen Mitteln erzählt. Während wir uns unterhielten, fiel mir ein, daß das Quecksilber sich mit Blei und Wismut verbindet. Es nimmt durch die Mischung um ein Viertel zu. Ich sagte nichts davon, aber ich dachte, wenn der Grieche das Geheimnis nicht kennte, würde ich vielleicht Vorteil daraus ziehen können. Ich fühlte, daß ich geschickt vorgehen müßte und daß er sich aus meinem Geheimnis nichts machen würde, wenn ich ihm ohne weiteres vorschlüge, es mir abzukaufen. Ich mußte ihn also mit dem Wunder der Vermehrung überraschen, darüber lachen und ihn an mich herankommen lassen. Schwindelei ist ein Laster, aber ehrenhafte List kann für Klugheit des Geistes gelten. Freilich ist sie eine Tugend, die wie Spitzbüberei aussieht; aber darüber muß man sich hinwegsetzen und wer sie im Fall der Not nicht mit Anstand anzuwenden weiß, der ist ein Dummkopf.
Nachdem wir das Schloß besichtigt hatten, gingen wir nach dem Gasthof; der Grieche führte mich auf sein Zimmer und ließ dort zwei Gedecke auflegen. Im Nebenzimmer sah ich große Flaschen Muskateller und vier Flaschen Quecksilber, von denen jede zehn Pfund wog. Da ich meinen Plan im Kopf hatte, bat ich ihn um eine Flasche Quecksilber zum Marktpreis und trug sie in mein Zimmer. Der Grieche ging aus, um seine Geschäfte zu besorgen; wir würden uns zum Mittagessen wiedersehen, sagte er. Ich ging ebenfalls aus und kaufte zweieinhalb Pfund Blei und ebensoviel Wismut; mehr hatte der Drogist nicht. Ich ging ins Wirtshaus zurück, ließ mir einige große Flaschen geben und nahm meine Mischung vor.
In heiterer Laune speisen wir zu Mittag, und der Grieche ist entzückt, daß ich seinen Cerigo-Muskateller ausgezeichnet finde. Plötzlich fragt er mich lachend, warum ich ihm denn eine Flasche von seinem Quecksilber abgekauft habe. „Das können Sie in meinem Zimmer sehen!“ antworte ich. Nach dem Essen kommt er mit mir und sieht sein Quecksilber auf zwei Flaschen verteilt. Ich verlange ein Gemsleder, seihe das Quecksilber durch und fülle die Flasche des Griechen. Er war ganz verblüfft, als er sah, daß ich noch eine viertel Flasche schönes Quecksilber übrig hatte, außerdem eine gleiche Menge eines gepulverten Metalls, das er nicht kannte; es war das Wismut. Über sein Erstaunen lache ich laut auf, rufe den Kellner und schicke ihn zum Drogisten, um das übriggebliebene Quecksilber zu verkaufen. Einen Augenblick darauf kam der Kellner zurück und brachte mir fünfzehn Carlinen.
Der Grieche war ganz starr vor Überraschung; er bat mich, ihm seine ganz volle Flasche zurückzugeben; sie kostete sechzig Carlinen. Lachend gab ich sie ihm, indem ich mich bedankte, daß er mich fünfzehn Carlinen habe verdienen lassen. Zugleich sagte ich ihm mit gutem Vorbedacht, am nächsten Morgen würde ich in aller Frühe nach Salerno abreisen.
„So werden wir also heute abend noch zusammen speisen“, sagte er. Am Nachmittag gingen wir in der Richtung nach dem Vesuv spazieren. Wir sprachen von Tausenderlei, aber vom Quecksilber war nicht die Rede; es kam mir jedoch vor, als mache mein Grieche ein sehr nachdenkliches Gesicht. Beim Abendessen sagte er nur lachend, ich könnte noch den nächsten Tag bleiben, um mit den übrigen drei Flaschen Quecksilber fünfundvierzig Carlinen zu verdienen. Ich antwortete ihm in vornehmem und ernstem Ton, ich hätte das nicht nötig; ich hätte die Vermehrung an der einen Flasche nur vorgenommen, um ihn durch eine angenehme Überraschung zu ergötzen.
„Aber dann müssen Sie ja reich sein?“
„Nein; denn ich arbeite an der Vermehrung des Goldes, und das kostet uns viel.“
„Sie sind also mehrere?“
„Mein Oheim und ich.“
„Was brauchen Sie Gold zu vermehren? Die Vermehrung des Quecksilbers muß Ihnen genügen. Sagen Sie nur bitte, ob das von Ihnen vermehrte sich in gleicher Weise noch weiter vermehren läßt.“
„Nein; wenn das möglich wäre, so wäre es ja eine unerschöpfliche Goldgrube.“
„Ihre Aufrichtigkeit freut mich sehr.“
Nach dem Essen bezahlte ich den Wirt und bat ihn, mir für den nächsten Morgen in aller Frühe einen zweispännigen Wagen nach Salerno zu besorgen. Ich dankte dem Griechen für seinen ausgezeichneten Muskateller, ließ mir seine Adresse in Neapel geben und sagte ihm, in vierzehn Tagen werde er mich wiedersehen, denn ich wolle auf alle Fälle ihm ein Faß von seinem Cerigo abkaufen.
Hierauf umarmten wir uns, und ich ging zu Bett; ich freute mich, mir meinen Unterhalt für den Tag verdient zu haben, und war keineswegs überrascht, daß der Grieche mir nicht den Vorschlag machte, ihm mein Geheimnis zu verkaufen; denn ich war überzeugt, daß er wegen dieser Angelegenheit die Nacht nicht würde schlafen können, und daß ich ihn am nächsten Morgen bei mir würde erscheinen sehen. Auf alle Fälle hatte ich Geld genug, um bis Torre del Greco zu kommen, und dort würde die Vorsehung sich schon meiner annehmen. Es dünkte mir unmöglich, mich wie ein Mönch bis Martorano durchzubetteln; denn so wie ich aussah, konnte ich kein Mitleid erregen. Ich konnte nur Leute interessieren, die überzeugt waren, daß ich nicht in Not sei; und das taugt nicht für richtige Bettler.
Wie ichs vorausgesehen hatte, kam der Grieche schon in der Morgendämmerung zu mir. Ich nahm ihn sehr freundlich auf und sagte ihm, wir würden miteinander Kaffee trinken.
„Gern. Aber sagen Sie, Herr Abbate – würden Sie mir nicht ihr Geheimnis verkaufen?“
„Warum nicht? Wenn wir uns in Neapel wiedertreffen…“
„Warum nicht heute?“
„Ich werde in Salerno erwartet. Außerdem kostet das Geheimnis viel Geld, und ich kenne Sie nicht.“
„Das ist kein Grund; denn ich bin hier so gut bekannt, daß ich bar bezahlen kann. Wieviel verlangen Sie?“
„Zweitausend Unzen (ungefähr 21.000 Mark).“
„Ich gebe sie Ihnen, aber unter der Bedingung, daß ich selber an den hier in meinen Händen befindlichen dreißig Pfund die Vermehrung vornehmen kann. Sie werden mir angeben, welche Bestandteile dazu nötig sind, und ich werde diese einkaufen.“
„Das ist nicht möglich; denn hier sind die Bestandteile nicht zu haben; aber in Neapel findet man sie in jeder gewünschten Menge.“
„Wenn es sich um ein Metall handelt, werden wir es in Torre del Greco finden. Wir können zusammen dorthin fahren. Können Sie mir sagen, wieviel die Vermehrung kostet?“
„Anderthalb Prozent. Aber sind Sie auch in Torre del Greco bekannt? Ich möchte nicht gerne meine Zeit verlieren.“
„Ihr Mißtrauen tut mir leid.“
Mit diesen Worten ergreift er eine Feder, schreibt einige Zeilen und übergibt mir eine Anweisung, die folgendermaßen lautet: „Bei Vorweisung zahlen Sie dem Überbringer fünfzig Unzen in Gold und stellen Sie sie auf Rechnung von Panagiotti“ usw. usw.
Er sagte mir, der Bankier wohne zwei Minuten vom Gasthof, und forderte mich auf, persönlich hinzugehen. Ich ließ mich nicht lange Bitten und erhielt fünfzig Unzen. Ich kehrte nach meinem Zimmer zurück, wo er mich erwartete, und ich legte das Geld auf den Tisch, indem ich ihm sagte, wir könnten nach Torre del Greco fahren, dort einen schriftlichen Vertrag machen und dann alles in Ordnung bringen. Er hatte Pferde und Wagen und ließ sofort anspannen. Wir fuhren ab, nachdem er mich in sehr anständiger Weise aufgefordert hatte, die fünfzig Unzen in meine Tasche zu stecken.
Als wir in Torre del Greco angekommen waren, verpflichtete er sich schriftlich in aller Form, mir zweitausend Unzen zu bezahlen, sobald ich ihm gesagt hätte, mit welchen Zutaten und in welcher Weise er Quecksilber, gleich dem, das ich in Portici in seiner Gegenwart verkauft hätte, um ein Viertel vermehren könnte, ohne daß dadurch dessen Güte vermindert würde.
Er stellte mir daraufhin einen Wechsel aus, der acht Tage nach Sicht bei Herrn Gennaro de Carlo zu bezahlen war. Hierauf nannte ich ihm Blei und Wismut als die erforderlichen Bestandteile; das Blei verbindet sich seiner Natur nach mit dem Quecksilber und durch das Wismut wird es so flüssig gemacht, wie es notwendig ist, um es durch das Seihleder treiben zu können. Sofort ging mein Grieche aus, um bei irgendeinem Bekannten die Operation vorzunehmen. Ich speiste allein. Am Abend kam er mit sehr traurigem Gesicht zurück. Das hatte ich erwartet.
„Die Operation ist gemacht“, sagte er; „aber das Quecksilber ist nicht tadellos.“
„Es ist gleich dem, das ich in Portici verkauft habe; Ihre schriftliche Verpflichtung spricht klar und deutlich.“
„Aber mein Schriftstück besagt ebenfalls: ohne daß dadurch dessen Güte vermindert würde. Nun geben Sie zu, daß die Güte geringer geworden ist. Der Beweis liegt schon darin, daß es sich nicht zur weiteren Vermehrung verwenden läßt.“
„Das wußten Sie ja. Übrigens halte ich mich an die Stelle, wo von der Gleichheit der Güte die Rede ist. Wir werden einen Prozeß führen, und Sie werden verlieren. Es tut mir leid, daß dadurch das Geheimnis bekannt wird. Sie können sich Glück wünschen, mein werter Herr! Sollten Sie gewinnen, so haben Sie mir mein Geheimnis umsonst abgenommen. Ich hielt Sie nicht für fähig, mich anführen zu wollen.“
„Ich bin überhaupt nicht der Mann, Herr Abbate, irgendeinen Menschen anzuführen.“
„Kennen Sie jetzt das Geheimnis oder nicht? Würde ich es Ihnen gesagt haben, wenn wir nicht den Vertrag miteinander gehabt hätten? Neapel wird lachen, und die Advokaten werden Geld verdienen. Die ganze Geschichte ist mir bereits sehr zuwider, und es tut mir sehr leid, daß ich mich durch Ihre schönen Worte habe bereden lassen. Einstweilen haben Sie hier ihre fünfzig Unzen wieder.“
Während ich, in Todesangst, er könnte es annehmen, das Geld aus der Tasche zog, ging er hinaus, indem er mir sagte, er wolle es nicht haben. Er kam wieder herein, und wir aßen in demselben Zimmer, aber an zwei verschiedenen Tischen. Wir waren in offenem Kriegszustand; aber ich war sicher, daß wir Frieden schließen würden. Den ganzen Abend sprachen wir kein Wort mehr miteinander; aber am anderen Morgen kam er zu mir, als ich schon meine Vorbereitungen zur Abreise traf, und wollte mit mir sprechen. Ich sprach von neuem den Wunsch aus, ihm die fünfzig Unzen zurückzugeben, er antwortete mir, ich solle sie behalten, noch fünfzig dazu empfangen und ihm dafür seinen Wechsel über die zweitausend zurückgeben. Nun fingen wir an, vernünftig zu verhandeln, und nach zwei Stunden gab ich nach. Ich bekam noch fünfzig Unzen, wir aßen als gute Freunde zusammen zu Mittag und umarmten uns herzlich. Beim Abschied gab er mir für sein Lagerhaus in Neapel eine Anweisung auf ein Faß Muskateller und schenkte mir ein prachtvolles Kästchen, das zwölf Rasiermesser mit silbernen Heften aus der Fabrik von Torre del Greco enthielt. Wir trennten uns also in voller Freundschaft und waren gegenseitig vollkommen miteinander zufrieden.
In Salerno blieb ich zwei Tage, um mir Wäsche anzuschaffen und was ich sonst brauchte. Ich war gesund, hatte über hundert Zechinen in der Tasche und war stolz auf meinen Erfolg, über den ich mir meiner Meinung nach keine Vorwürfe zu machen brauchte. Denn mein geschicktes Verhalten beim Verkauf meines Geheimnisses konnte nur von einer zynischen Moral mißbilligt werden, und diese hat im alltäglichen Leben keine Geltung. Als ich mich nun unabhängig und reich sah und sicher war, vor dem Bischof anständig auftreten zu können und nicht wie ein Bettler dazustehen, da gewann ich meine ganze fröhliche Laune wieder und wünschte mir Glück, auf eigene Kosten gelernt zu haben, wie man sich vor Leuten wie Vater Corsini, vor Falschspielern und vor feilen Dirnen in acht zu nehmen hat und besonders vor jenen unverschämten Schmeichlern, die ihre auserkorenen Opfer frech ins Gesicht loben. Diese Art Gauner findet man fast überall in der Welt, sogar in der sogenannten guten Gesellschaft.
Von Salerno fuhr ich mit zwei Priestern, die in Geschäften nach Cosenza reisten, und wir machten die hundertzweiundvierzig Miglien in zweiundzwanzig Stunden. Am Tage nach meiner Ankunft in der Hauptstadt Calabriens nahm ich ein Wägelchen und fuhr nach Martorano. Während der Fahrt weidete ich meine Blicke an dem berühmten Mare Ausonium; mit Freuden sah ich mich in jenem Großgriechenland, das vor vierundzwanzig Jahrhunderten Pythagoras durch seinen Aufenthalt berühmt gemacht hatte. Mit Erstaunen aber sah ich in einem Lande, das wegen seiner Fruchtbarkeit berühmt und von der Natur verschwenderisch mit Gaben überschüttet war, nichts als jämmerliches Elend und völligen Mangel an jenem angenehmen Überflüssigen, wodurch das Leben erst erträglich wird. Dazu die Entartung der spärlichen Bevölkerung, die doch in dieser Gegend so zahlreich sein könnte und die ich nur mit Erröten als Abkömmlinge meiner eigenen Rasse anerkennen konnte. Aber so ist nun einmal die Terra di lavoro, wo Arbeit ein Gegenstand des Abscheus zu sein scheint, aber alles unglaublich billig ist, wo die unglücklichen Bewohner es als eine Erlösung von einer Last ansehen, wenn sie jemanden finden, der ihnen die Früchte abnimmt, die das Land fast ohne jede Bestellung in allzu großem Überfluß hervorbringt und für die sie nichts bekommen können, weil sie gar keine Ausfuhrwege besitzen. Ich mußte gestehen, daß die Römer nicht ungerecht gewesen waren, indem sie sie bruti statt Brutii nannten. Die guten Priester, mit denen ich reiste, lachten über meine Angst vor den Taranteln und Skorpionen; denn die durch diese Insekten hervorgerufene Krankheit erschien mir fürchterlicher als jene andere, die ich bereits kannte. Sie versicherten mir, es sei alles Fabel, was man über die Tiere erzähle; sie lachten über die Verse, die Vergil in seinen Georgica ihnen gewidmet hat, und über die anderen, die ich ihnen zitierte, um meine Furcht zu rechtfertigen.
Ich fand den Bischof Bernardo de Bernardis auf einem schlechten Stuhl vor einem armseligen Tisch sitzen, an dem er arbeitete. Ich kniete nieder, wie es Brauch ist; aber anstatt mir seinen Segen zu geben, stand er auf, nahm mich in seine Arme und drückte mich an seine Brust. Er war aufrichtig getrübt, als ich ihm sagte, daß ich in Neapel keine Auskunft gefunden hätte, um zu ihm zu gelangen und mich ihm zu Füßen zu werfen. Aber seine Betrübnis verschwand, als ich ihm sagte, ich sei keinem Menschen etwas schuldig und befinde mich wohlauf. Er ließ mich Platz nehmen, seufzte, sprach gefühlvoll von der Armut und befahl einem Diener, ein drittes Gedeck aufzulegen. Außer diesem Bedienten hatte der Bischof nur noch eine Magd in höchst kanonischem Alter und einen Priester, der nach den wenigen Worten, die er bei Tisch sagte, mir ein großer Ignorant zu sein schien. Das von Seiner Gnaden bewohnte Haus war geräumig, aber schlecht gebaut und schlecht gehalten. Es war so schlecht möbliert, daß der arme Bischof eine von den beiden Matratzen seines Bettes abtreten mußte, damit für mich in einem Zimmer neben dem seinen ein armseliges Lager bereitet werden konnte! Sein Essen entsetzte mich – um nicht mehr davon zu sagen. Da er sehr fest an der Observanz seines Ordens hielt, so gab es nur Fastenspeisen, und das Öl war abscheulich. Übrigens war Monsignore ein kluger Mann und, was mehr ist, ein Ehrenmann. Er sagte mir zu meiner großen Überraschung, sein Bistum, das keineswegs zu den kleinsten gehörte, bringe ihm jährlich nur 500 Ducati di regno (ungefähr 1.700 Mark) und zum Unglück habe er obendrein noch 600 Ducati Schulden. Seufzend setzte er hinzu, er habe nur das einzige Glück, daß er den Klauen der Mönche entgangen sei, deren Verfolgungen ihm die letzten fünfzehn Jahre zu einem wahren Fegefeuer gemacht hätten. Alle diese vertraulichen Mitteilungen betrübten mich, denn ich sah, daß ich hier nicht das gelobte Land der Mitra gefunden hatte, und ich fühlte, daß ich dem Bischof sehr zur Last fallen mußte. Ich sah daß er selber sehr niedergeschlagen war, mir ein so trauriges Geschenk gemacht zu haben.
Ich fragte ihn, ob er gute Bücher habe, Umgang mit wissenschaftlich gebildeten Leuten und eine vornehme Gesellschaft, mit der man ein paar Stunden angenehm verbringen könne. Er lächelte und sagte mir, in seinem ganzen Sprengel sei tatsächlich niemand, der sich rühmen könnte, gut zu schreiben, noch weniger guten Geschmack oder einen Begriff von guter Literatur zu haben. Es gebe keinen einzigen richtigen Buchhändler, ja es gebe sogar niemanden, der Interesse am Zeitungslesen habe! Er versprach mir jedoch, wir wollten zusammen die Wissenschaften pflegen, sobald er die in Neapel bestellten Bücher erhalten hätte.
Das hätte ja wohl sein können; aber ohne eine gute Bücherei, ohne einen auserlesenen Verkehrskreis, ohne geistigen Wetteifer, ohne literarischen Briefwechsel – war dies das Land, wo ich im Alter von achtzehn Jahren mich fest niederlassen konnte? Als der gute Bischof sah, daß ich nachdenklich wurde, daß ich wie betäubt war von der Aussicht auf das traurige Leben, das ich bei ihm zu führen erwarten mußte, da glaubte er mich ermutigen zu müssen, indem er mir versicherte, er werde alles tun, was in seinen Kräften stehe, um mein Glück zu machen.
Am anderen Morgen hatte der Bischof in vollem Ornat Hochamt abzuhalten; hierdurch erhielt ich Gelegenheit, den ganzen Klerus zu sehen, sowie die Frauen und Männer, die den Dom füllten. Dieser Anblick brachte mich zum Entschluß, dies traurige Land zu verlassen. Ich glaubte eine Herde von stumpfsinnigem Vieh zu sehen, das sich über meine ganze äußere Erscheinung aufregte. Wie häßlich waren die Frauen! Wie stumpfsinnig und plump sahen die Männer aus! In den bischöflichen Palast zurückgekehrt, sagte ich dem guten Prälaten, ich fühlte keinen Beruf in mir, binnen wenigen Monaten in seiner traurigen Stadt als Märtyrer zu sterben. „Geben Sie mir“, fuhr ich fort, „Ihren Segen und meinen Abschied; oder besser noch: gehen Sie mit mir zusammen fort; ich verspreche Ihnen, wir werden anderswo unser Glück machen.“
Über diesen Vorschlag lachte er im Lauf des Tages noch zu wiederholten Malen. Hätte er ihn angenommen, so wäre er nicht zwei Jahre darauf in der Blüte seines Lebens gestorben. Der wackere Mann fühlte wohl, wie sehr mein Widerstreben gegen den Aufenthalt bei ihm begründet war, und er bot mich um Verzeihung, daß er den Fehler begangen habe, mich nach Martorano kommen zu lassen. Er hielt es für seine Pflicht, mich nach Venedig zurückzubefördern; da er aber kein Geld hatte und nicht wußte, daß ich welches besaß, so sagte er mir, er würde mich in Neapel an einen dortigen Bürger empfehlen, der mir sechzig Dukaten (ungefähr 2.000 Mark) auszahlen würde; hiermit könnte ich nach meiner Vaterstadt heimreisen. Dankbar nahm ich sein Anerbieten an und holte dann schnell aus meinem Koffer das schöne Etui mit den Rasiermessern, das mir der Grieche gegeben hatte. Ich bat den Bischof, es zur Erinnerung anzunehmen. Es kostete mich sehr große Mühe, ihn zur Annahme dieses Geschenkes zu bewegen; denn es war seine sechzig Dukaten wert; um seinen Widerstand zu besiegen, mußte ich ihm schließlich drohen, ich würde dableiben, wenn er es nicht annähme.
Er gab mir einen sehr schmeichelhaften Brief an den Erzbischof von Cosenza, den er bat, mich auf seine, des Bischofs Kosten, nach Neapel zu befördern. So verließ ich Martorano sechzig Stunden nach meiner Ankunft dortselbst. Ich beklagte den zurückbleibenden Bischof, der unter Tränen mir hundertmal seinen Segen spendete.
Der Erzbischof von Cosenza, ein geistvoller und reicher Prälat, war so freundlich, mich als seinen Gast bei sich zu behalten. Bei Tisch sang ich aus überströmendem Herzen das Lob des Bischofs von Martorano; aber unbarmherzig zog ich über seinen Sprengel und über das ganze Calabrien los, und meine Bemerkungen waren so bissig, daß der Erzbischof und seine Gäste herzlich darüber lachten. Unter diesen Gästen befanden sich zwei Damen, Verwandte des hohen Herrn, die bei Tisch die Honneurs machten. Die jüngere von ihnen ärgerte sich über meine Beschreibung ihrer Heimat und erklärte mir deswegen den Krieg. Ich fand aber das rechte Mittel sie zu beruhigen, indem ich ihr sagte, Calabrien wäre ein entzückendes Land, wenn der vierte Teil seiner Bewohner ihr gliche. Vielleicht um mir das Gegenteil meiner Behauptungen zu beweisen, gab Monsignore am nächsten Tage ein glänzendes Abendessen.
Cosenza ist eine Stadt, wo ein Angehöriger der guten Gesellschaft sich wohl unterhalten kann. Denn er findet dort einen reichen Adel, hübsche Frauen und recht gebildete Leute, die ihre Erziehung in Rom oder Neapel erhalten haben. Am dritten Tage reiste ich ab; der Erzbischof gab mir einen Brief an den berühmten Genovesi mit.
Ich hatte fünf Reisegefährten, die ich nach ihrem Aussehen für Seeräuber oder gewerbsmäßige Spitzbuben hielt. Ich brauchte daher die Vorsicht, sie nicht sehen oder auch nur ahnen zu lassen, daß ich eine wohlgefüllte Börse hei mir hatte. Auch glaubte ich im Bette stets meine Kleider anbehalten zu müssen, in jenem Lande eine ausgezeichnete Vorsichtsmaßregel für einen jungen Mann.
Am 16. September 1743 kam ich in Neapel an und bestellte sofort den Brief des Bischofs von Martorano an seine Adresse. Sie lautete auf Herrn Gennaro Polo in Sant’ Anna. Dieser Herr, der weiter keine Aufgabe hatte, als mir sechzig Reichsdukaten auszuzahlen, sagte mir, nachdem er den Brief gelesen hatte, er wünsche mich in seinem Hause zu beherbergen, damit ich seinen Sohn kennenlerne, der ebenfalls Dichter sei. Der Bischof schreibe ihm, ich sei ein ausgezeichneter Poet. Nachdem ich aus Höflichkeit einige Umstände gemacht hatte, nahm ich die Einladung an und ließ meinen Koffer nach seinem Hause bringen.
Tartane ist ein Schiff, das nur Haupt- und Fockmast hat und dreieckige Segel führt.
Batticulo ist die Tasche, die gegen den Culo (Hintern) schlägt.