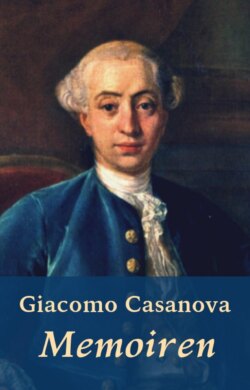Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 18
Dreizehntes Kapitel
ОглавлениеKomische Begegnung in Orsera. – Reise nach Korfu. – Aufenthalt in Konstantinopel. – Bonneval. – Meine Rückkehr nach Korfu. – Frau F. – Der falsche Prinz. – Meine Flucht aus Korfu. – Meine tollen Streiche auf der Insel Casopo. – Ich begebe mich nach Korfu in Arrest. – Meine schnelle Freilassung und meine Triumphe. – Meine Erfolge bei Frau F.
Ich behaupte, ein dummer Diener ist gefährlicher als ein boshafter, vor allem fällt er mehr zur Last; gegen einen boshaften kann man auf der Hut sein, nie aber gegen einen dummen. Eine Nichtswürdigkeit kann man bestrafen, eine Dummheit aber niemals anders, als indem man den Dummen oder die Dumme wegjagt. Und durch den Wechsel gerät man gewöhnlich von der Charybdis in die Scylla.
Dies Kapitel und die beiden folgenden waren vollendet; sie enthielten im Detail das, was ich nun ohne Zweifel nur in allgemeinen Zügen niederschreiben werde, denn das dumme Mädchen, das mich bedient, hat sich derselben zu ihrem Gebrauch bemächtigt. Als Entschuldigung führte sie mir an, diese Papiere wären beschrieben, beschmutzt und voller durchstrichener Stellen gewesen, deshalb hätte sie diese den nicht beschriebenen vorgezogen, da diese mir nach ihrer Meinung doch viel wertvoller sein müßten. Ich geriet in Zorn, doch ich hatte unrecht, denn das arme Mädchen hatte ihrer Meinung nach richtig gehandelt; ihr Urteil allein hatte sie irregeführt. Bekanntlich bewirkt der Zorn zuerst den Verlust der Urteilsfähigkeit. Denn Zorn und Überlegung sind nicht vom gleichen Stamm. Glücklicherweise ist der Zorn bei mir stets nur von kurzer Dauer: Irasci celerem tamen et placabilem esse – ebenso schnell versöhnt wie erzürnt. Nachdem ich meine Zeit damit verloren hatte, sie auszuzanken, was auf sie keinen besonderen Eindruck machte, und ihr zu beweisen, daß sie ein dummes Tier wäre, widerlegte sie alle meine Gründe durch das vollkommenste Stillschweigen. Ich mußte einen Entschluß fassen und mit einem Rest schlechter Laune machte ich mich von neuem an die Arbeit. Sie wird ohne Zweifel nicht so gut ausfallen wie die, bei der ich guter Laune war, doch der Leser möge sich zufrieden geben; denn nach dem Gesetz der Mechanik wird er an Zeit gewinnen, was er an Kraft verliert.
Ich war also in Orsera ans Land gegangen, wahrend man den Ballast in unser Schiff brachte, dessen zu große Leichtigkeit dem notwendigen Gleichgewicht für die Fahrt Eintrag tat, und bemerkte einen Mann von gewinnendem Aussehen, der mich mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. Ich wußte genau, daß es kein Gläubiger sein konnte, und meinte, mein stattliches Aussehen interessiere ihn, und da ich dies nicht übelnehmen konnte, wollte ich meines Weges gehen, als er mich ansprach.
„Herr Hauptmann, dürfte ich mir die Frage erlauben, ob Sie zum erstenmal in diese Stadt kommen?“
„Nein, mein Herr, zum zweitenmal.“
„Waren Sie nicht im vergangenen Jahr hier?“
„Sehr richtig!“
„Aber damals trugen Sie nicht den Soldatenrock?“
„Auch das ist wahr. Doch Ihre Fragen beginnen mir etwas indiskret zu erscheinen.“
„Sie müssen mir verzeihen, mein Herr, denn meine Neugier ist die Tochter meiner Erkenntlichkeit. Sie sind der Mann, dem ich in höchstem Maße verpflichtet bin, und ich denke, die Vorsehung hat Sie nur wieder hierhergefuhrt, um mir noch größere Verpflichtungen aufzulegen.“
„Was habe ich denn für Sie getan, und was kann ich noch tun? Ich vermag es nicht zu erraten!“
„Haben Sie die Güte und frühstücken Sie mit mir. Dort ist meine Wohnung. Ich besitze vortrefflichen Refosco, kommen Sie und kosten Sie ihn. Ich werde Sie mit wenigen Worten überzeugen, daß Sie mein wahrer Wohltäter sind, und daß ich zu der Hoffnung berechtigt hin, Sie seien nur hierher zurückgekommen, um Ihre Wohltaten zu erneuern.“
Ich konnte diesen Menschen nicht für närrisch halten, aber ich begriff auch nichts von seinen Äußerungen und bildete mir ein, er wolle mich bewegen, seinen Refosco zu kaufen; ich nahm also die Einladung an. Wir gingen in sein Zimmer hinauf, wo er mich einen Augenblick allein ließ, um das Frühstück zu bestellen. Ich sah hier mehrere chirurgische Instrumente und schloß daraus, daß er Chirurg wäre; sobald er zurückkam, fragte ich ihn, ob dem so wäre.
„Ja, Herr Hauptmann, seit zwanzig Jaren betreibe ich dieses Handwerk in hiesiger Stadt, wo ich im Elend lebte, da ich nur selten einmal einen Aderlaß vorzunehmen, einen Schröpfkopf zu setzen, ein paar Schrammen zu verbinden und einige Glieder einzurenken hatte. Was ich erwarb, reichte nicht zum Leben aus. Doch hat sich, ich kann es sagen, seit vergangenem Jahr meine Lage geändert, ich verdiente viel Geld, habe es gut angelegt, und Ihnen Herr Hauptmann, Ihnen, den der liebe Gott segnen möge habe ich meinen gegenwärtigen Wohlstand zu verdanken.“
„Wieso?“
„Folgendermaßen, Herr Hauptmann. Sie haben die Haushälterin des Don Geronimo gekannt und ihr bei der Abreise ein Liebesandenken hinterlassen, das sie einem Freunde mitteilte, der ohne Arg damit seine Frau beschenkte. Diese wollte ohne Zweifel nicht zurückstehen und übertrug es auf einen Liebhaber, der seinerseits damit so freigebig war, daß ich in weniger als einem Monat einige fünfzig Patienten bekam. Die folgenden Monate waren nicht minder fruchtbar, und ich kurierte alle Leute und ließ mich, wie recht und billig, gut bezahlen. Noch jetzt habe ich einige Patienten, doch nach einem Monat werde ich niemand mehr haben, denn die Krankheit ist erloschen. Sie werden jetzt die Freude begreifen, die mich bei Ihrem Anblick erfüllte. Sie schienen mir Glück zu verkünden. Darf ich mir schmeicheln, daß Sie einige Tage hier bleiben werden, um die Quelle meines Glücks von neuem hervorsprudeln zu lassen?“
Ich mußte über seine Erzählung lachen, betrübte ihn aber durch meine Erklärung, daß ich mich sehr wohl befinde. Er versicherte mir, ich würde das nach meiner Rückkehr nicht mehr behaupten können, denn das Land, in das ich mich begäbe, wäre voller schlechter Ware; doch niemand besäße so wie er das Geheimnis, das Übel auszurotten. Er bat mich, auf ihn zu zählen und mich nicht an Quacksalber zu wenden, die mir ihre Mittel anpreisen würden. Ich versprach ihm das alles, dankte ihm und ging an Bord zurück. Ich erzählte meine Geschichte Herrn Dolfino, der darüber herzlich lachte. Am nächsten Tage gingen wir unter Segel und am vierten bekamen wir hinter Gurzola einen Sturm, der mir beinahe das Leben gekostet hätte. Dies ging auf folgende Weise zu:
Ein flawonischer Priester, der als Kaplan auf dem Schiffe war, ein ganz unwissender, frecher und roher Mensch, über den ich bei jeder Gelegenheit spottete, war natürlich mein Feind geworden. Die Seele eines Betbruders kann so gallig sein! Während des stärksten Unwetters plazierte er sich auf das oberste Deck und trieb, sein Gebetbuch in der Hand, beschwörend die Teufel davon, die er in den Wolken zu sehen glaubte und die er allen Matrosen zeigte. Sie hielten sich für verloren, weinten, waren verzweifelt und vernachlässigten so die nötigen Manöver, um das Schiff vor den Felsen zu bewahren, die man rechts und links sah.
Ich erkannte die Gefahr, die wir liefen, und die böse Wirkung seiner Exorzismen auf die Mannschaft, die der einfältige Priester entmutigte, anstatt ihr Mut einzuflößen, und hielt es für klug, mich einzumischen. Ich stieg in die Takelage, rief die Matrosen an die Arbeit und sagte ihnen, es gäbe gar keine Teufel, und der Priester, der sie ihnen zeigen wollte, wäre ein Narr. Ich konnte sprechen, was ich wollte, mich selber der größten Gefahr aussetzen und ihnen zeigen, daß nur von tatkräftigem Eingreifen die Rettung zu hoffen sei: ich vermochte nicht den Priester zu hindern, mich für einen Atheisten zu erklären und den größten Teil der Mannschaft gegen mich aufzuhetzen. Die Winde wühlten während der zwei folgenden Tage die Wogen unaufhörlich auf, und der Schurke wußte den Matrosen, die aufmerksam ihm zuhörten, einzureden, das Unwetter würde sich nicht legen, solange ich auf dem Schiff wäre. Von diesem Gedanken durchdrungen, hielt einer von ihnen den Augenblick für günstig, um die Wünsche des Priesters zu erfüllen, und versetzte mir, der ich am Rande des Oberdecks stand, einen so heftigen Schlag mit einem Tau, daß ich hinfiel. Es wäre um mich geschehen gewesen, hätte sich nicht die Spitze eines Ankers in meinem Rock verfangen und mich so vor dem Sturz ins Meer bewahrt; es war im eigentlichsten Wortsinn mein Rettungsanker. Man kam mir zu Hilfe, und ich wurde gerettet. Ein Korporal zeigte mir den Matrosen, der den mörderischen Anschlag auf mich gemacht hatte, ich nahm den Korporalstock und prügelte den Kerl tüchtig durch; doch die Matrosen und der wütende Priester eilten auf sein Geschrei herbei und ich würde unterlegen sein, wenn die Soldaten sich nicht auf meine Seite gestellt hätten. Der Kapitän des Schiffes kam mit Herrn Dolfino hinzu, sie mußten den Priester anhören und der Bande zu deren Beruhigung versprechen, mich sobald als möglich ans Land zu setzen. Damit noch nicht zufrieden, forderte der Priester, ich sollte ihm ein Pergament überliefern, das ich in Malamocco im Augenblick der Einschiffung von einem Griechen gekauft hatte. Ich erinnerte mich dessen nicht mehr, aber es war wahr. Lachend ühergab ich es Herrn Dolfino, und dieser lieferte es dem fanatischen Kapellan aus, der ein Siegesgeschrei ausstieß, sich das Kohlenbecken aus der Küche holen ließ und darauf ein auto da fé hielt. Das unglückselige Pergament wand und krümmte sich eine halbe Stunde lang, es zerfiel, und der Priester stellte das als eine wundersame Erscheinung dar, die alle Matrosen überzeugte, es sei ein Höllenpakt gewesen. Die angebliche Kraft dieses Pergaments sollte darin bestehen, alle Frauen in den Mann, der es trug, verliebt zu machen. Ich hoffe, der Leser wird mir die Gunst schenken und glauben, daß ich nicht im mindesten an Zaubertränke, Talismane und Amulette glaubte. Ich hatte das Pergament nur aus reinem Scherz gekauft.
In ganz Italien, in Griechenland und im allgemeinen überall, wo die Massen unwissend sind, gibt es Griechen, Juden, Astrologen und Exorzisten, die den Dummköpfen Wische und Tand verkaufen, die nach ihrem Glauben wunderbare Eigenschaften besitzen; Zauber, um sich unverwundbar zu machen, Lumpen, um sich vor dem Behexen zu sichern, kleine Kräuterkissen, um die sogenannten bösen Geister abzuhalten, und tausend ähnliche Albernheiten. Diese Waren sind in Frankreich, Deutschland und England, überhaupt im ganzen Norden, wertlos; dagegen aber verübt man in diesen Ländern andere Betrügereien von noch viel bedeutenderem Umfange.
Das Unwetter nahm gerade ein Ende, als das unschuldige Pergament verbrannt wurde; die Matrosen glaubten die bösen Geister gebannt, dachten nicht mehr daran, sich meiner Person zu entledigen, und nach acht Tagen einer glücklichen Fahrt kamen wir nach Korfu. Sobald ich mir eine gute Wohnung genommen hatte, brachte ich meine Briefe Seiner Eminenz, dem Generalprovveditore, und allen höheren Beamten, an die ich empfohlen war; dann machte ich meinem Obersten meine Aufwartung, und nachdem ich mit den Offizieren des Regiments Bekanntschaft geschlossen hatte, dachte ich darauf, wie ich mich bis zur Ankunft des Ritters Veniero, der mich nach Konstantinopel mitnehmen sollte, möglichst gut unterhalten könnte. Er kam gegen Mitte Juli, da ich mich aber inzwischen dem Brettspiel hingegeben hatte, verlor ich all mein Geld und verkaufte oder verpfändete all meine Schmuckgegenstände.
Das ist das Geschick eines jeden, der zu Hazardspielen geneigt ist, wenn er nicht das Glück zu fesseln versteht, indem er mit einem sicheren Vorteil spielt, der von der Berechnung oder der Geschicklichkeit ahhängt, vom Zufall aber unabhängig ist. Ich glaube, ein verständiger und vorsichtiger Spieler kann beides tun, ohne sich dadurch dem Tadel auszusetzen oder ein Betrüger genannt werden zu dürfen.
Während des Monats, den ich in Korfu in der Erwartung des Ritters Veniero verbrachte, beschäftigte ich mich nicht im mindesten mit der Erforschung des Landes weder in physischer noch in moralischer Beziehung; denn abgesehen von den Tagen, an denen ich auf Wache ziehen mußte, lebte ich im Kaffeehause, an der Pharaobank und unterlag natürlich dem Unglück, dem ich zu trotzen unternahm. Nicht ein einziges Mal kam ich mit dem Trost, gewonnen zu haben, nach Hause, und erst wenn ich nichts mehr besaß, hatte ich die Kraft, aufzuhören. Der einzige alberne Trost, den ich zu hören bekam, und der vielleicht nicht frei von Spott war, war das Lob des Bankhalters, der mich stets einen noblen Spieler nannte, wenn ich eine entscheidende Karte verlor. So befand ich mich in einer trostlosen Lage, und ich atmete erst wieder auf, als ich die Kanonenschüsse hörte, die die Ankunft des Bailo meldeten. Er befand sich auf dem Linienschiff Europa, das 72 Kanonen führte; es hatte nur acht Tage zur Fahrt von Venedig bis Korfu gebraucht. Kaum war der Anker ausgeworfen, als er seine Flagge als Generalkapitän der Seestreitkräfte der Republik hissen und der Provveditore die seine streichen ließ. Die Republik Venedig hat auf dem Meere keine Autorität, die über der des Bailo bei der ottomanischen Pforte steht. Ritter Veniero hatte ein glänzendes und distinguiertes Gefolge und die venezianischen Nobili Graf Annibale Gambera und Graf Carlo Zenobio, sowie der Marchese d’Anchetti aus Brescia begleiteten ihn aus Neugier nach Konstantinopel. Er verbrachte acht Tage auf Korfu, und alle Befehlshaber zur See gaben nach der Reihe ihm und seinem Gefolge ein Fest, so daß die großen Soupers und die Bälle nicht aufhörten. Sobald ich mich Seiner Exzellenz vorstellte, sagte er mir, er hätte schon mit dem Generalprovveditore gesprochen, der mir einen Urlaub von sechs Monaten gewährte, um ihn als Adjutant zu begleiten; sobald ich den Urlaub erhielt, ließ ich mein geringes Gepäck an Bord bringen, und das Schiff lichtete gleich am nächsten Tage die Anker.
Wir gingen mit anhaltendem, gutem Winde unter Segel, und nach sechs Tagen lagen wir vor Cerigo, wo wir vor Anker gingen, um frisches Wasser einzunehmen. Neugierig, das alte Cythere zu sehen, begleitete ich die Matrosen auf ihrem Dienstweg; doch ich hätte besser getan, wenn ich an Bord geblieben wäre, denn ich machte eine schlechte Bekanntschaft. Ich war in Gesellschaft des Kapitäns der die Truppen des Schiffes befehligte.
Sobald wir an Land waren, kamen zwei Menschen von verdächtigem Aussehen und in schlechter Kleidung auf uns zu und baten uns um ein Almosen. Ich fragte sie, was sie wären, und der eine, der gewandtere von beiden, antwortete mir folgendermaßen: „Wir sind auf dieser Insel zu leben und vielleicht auch zu sterben verdammt durch den Despotismus des Rats der Zehn und mit uns gegen vierzig Unglückliche wie wir, ebenfalls allesamt geborene Untertanen der Republik.
Unser vorgebliches Verbrechen, das sonst nirgendwo eins ist, bestand in unserer Gewohnheit, mit unseren Geliebten zusammenzuleben und nicht eifersüchtig auf solche Freunde zu sein, die sie hübsch fanden und mit unserer Zustimmung sich ihre Gunstbezeiungen verschafften. Da wir nicht reich waren, machten wir uns keine Gewissensbisse, daraus Vorteil zu ziehen, aber man behandelte unseren Wandel als unerlaubt und schickte uns hierher, wo wir täglich zehn Soldi in kleiner Münze empfangen. Man nennt uns Mangiamarroni – Kastanienesser, und wir sind schlimmer dran als Galeerensträflinge, denn die Langeweile reibt uns auf und oft wissen wir nicht, wie wir unseren Hunger stillen sollen. Mein Name ist Don Anronio Pocchini, ich bin Edelmann aus Padua, und meine Mutter stammt von der erlauchten Familie von Camo San-Piero.“
Wir gaben ihnen ein Almosen, durchstreiften dann die Insel und kehrten, nachdem wir die Festung besucht hatten, an Bord zurück. Ich werde von diesem Pocchini nach fünfzehn Jahren wieder sprechen.
Die stets günstigen Winde brachten uns in acht oder zehn Tagen zu den Dardanellen; dort nahmen uns türkische Bote auf, um uns nach Konstantinopel zu bringen. Der Anblick der Stadt auf die Entfernung von einer Stunde ist staunenerregend, und ich glaube, die ganze Welt bietet nirgends ein so entzückendes Schauspiel. Dieser prachtvolle Anblick war auch der Grund des Untergangs des römischen Reichs und des Beginns des griechischen Reichs; als Konstantin der Große nämlich zu Schiff nach Byzanz kam, rief er, verführt durch die Schönheit der Lage der Stadt, aus: „Hier ist der Herrschersitz des Weltreichs!“ Und um seine Prophezeiung wahr zu machen, verließ er Rom und verlegte seine Residenz hierher. Hätte er die Prophezeiung des Horaz gelesen oder vielmehr daran geglaubt, so würde er wahrscheinlich diese Torheit nie begangen haben. Der Dichter hatte geschrieben, das römische Kaiserreich würde seinem Untergang erst dann entgegengehen, wenn ein Nachfolger des Augustus auf den Gedanken käme, den Sitz desselben dorthin zu verlegen, wo er geboren wäre. Troja ist aber von Thrakien nicht weit entfernt.
Wir kamen im venetianischen Palast zu Pera gegen Mitte Juli an und man sprach, was sehr selten ist, in diesem Augenblick in Konstantinopel nicht von der Pest. Wir wurden alle sehr gut untergebracht; doch die große Hitze bestimmte die Baili, die Frische in einem Landhause zu genießen, das der Bailo Dona gemietet hatte. Es lag in Buyukdere. Ich erhielt sofort den Befehl, niemals ohne Wissen des Bailo und ohne Begleitung eines Janitscharen auszugehen. Ich gehorchte aufs Wort. Zu dieser Zeit hatten die Russen noch nicht die Unverschämtheit des türkischen Volkes gezügelt. Jetzt können, wie man erzählt, die Fremden in voller Sicherheit überall hingehen, wo sie wollen.
Am Tag nach meiner Ankunft ließ ich mich zu Osman Pascha von Karamanien führen, diesen Namen hatte Graf von Bonneval nach seinem Ubertritt zum Islam angenommen. Sobald ich ihm meinen Brief hatte überreichen lassen, wurde ich in ein französisch möbliertes Zimmer des Erdgeschosses geführt, wo ich einen dicken, französisch gekleideten, bejahrten Herrn sah, der, sobald ich erschien, sich erhob, mir lächelnd entgegenkam und mich fragte, was er in Konstantinopel für den Schützling eines Kardinals der römischen Kirche, die er nicht mehr seine Mutter nennen könnte, zu tun imstande wäre. Ich erzählte ihm ganz ausführlich meine Geschichte, wie ich in einem Augenblick der Verzweiflung den Kardinal um Empfehlungsbriefe für Konstantinopel gebeten hätte, und fügte hinzu, nach deren Empfang hätte ich aus Aberglauben mich für verpflichtet gehalten, sie zu überbringen. „Also würden Sie ohne diesen Brief“, meinte er, „niemals hierher gekommen sein, wo Sie meiner nicht bedürfen.“
„Das ist wahr, aber ich halte mich für sehr glücklich, daß mir so die Ehre der Bekanntschaft Euer Exzellenz zuteil geworden ist, eines Mannes, von dem ganz Europa gesprochen hat, von dem es noch spricht und noch lange sprechen wird.“
Nachdem wir Betrachtungen über das Glück eines jungen Menschen in meiner Lage angestellt hatten, der ohne alle Sorgen, ohne Absicht und bestimmten Zweck, sich mit einem furchtlosen Vertrauen dem Glück überläßt, sagte er mir, der Brief des Kardinals Acquaviva verpflichte ihn, etwas für mich zu tun, und er wollte mich daher mit drei oder vier seiner türkischen Freunde, bei denen sich dies der Mühe lohne, bekannt machen. Er lud mich ein, jeden Donnerstag bei ihm das Mittagsmahl einzunehmen, und versprach mir, einen Janitscharen mir zu schicken, der mich gegen die Unverschämtheit des Pöbels schützen und mir alle Sehenswürdigkeiten zeigen würde.
Der Brief des Kardinals bezeichnete mich als Gelehrten; er erhob sich und sagte mir, er wolle mir seine Bibliothek zeigen. Ich folgte ihm quer durch den Garten, und wir betraten ein mit vergitterten Schränken gefülltes Zimmer; hinter den Gittern von Eisendraht sah man Vorhänge, und hinter diesen Vorhängen befanden sich ohne Zweifel Bücher.
Er zog einen Schlüssel aus der Tasche und öffnete; aber statt Foliobänden sah ich Flaschen der besten Weine aufgereiht, und wir lachten beide von ganzem Herzen. „Das hier“, sagte mir der Pascha, „ist meine Bibliothek und mein Harem; denn da ich alt bin, würden die Frauen mein Leben verkürzen, während der gute Wein es mir nur erhalten kann oder wenigstens es angenehmer gestalten muß.“
„Ich vermute, Euer Exzellenz haben einen Dispens vom Mufti erhalten.“
„Sie irren, der Papst der Türken hat bei weitem nicht soviel Macht wie der Papst der Christen. Er kann in keinem Fall etwas im Koran Verbotenes erlauben; doch das hindert niemanden, sich in Verdammnis zu stürzen, wenn ihm das Vergnügen macht. Die frommen Türken beklagen die Freidenker, aber sie verfolgen sie nicht. Es gibt in der Türkei keine Inquisition. Wer die Vorschriften der Religion nicht beachtet, sagen sie, wird im andern Leben schon unglücklich genug sein, so daß man ihm nicht noch in diesem Leben Leiden zuzufügen braucht. Der einzige Dispens, den ich erbeten und erlangt hahe, obgleich man es kaum so nennen kann, ist der von der Beschneidung; denn in meinem Alter hätte sie gefährlich sein können. Das ist eine Zeremonie, die man im allgemeinen beohachtet, die aber nicht vorgeschrieben ist.“
Während der zwei Stunden, die ich mit ihm verbrachte, fragte er mich nach mehreren ihm befreundeten Venetianern und besonders nach Marco Antonio Diedo. Ich erwiderte ihm, man liebe ihn immer noch und beklage nur seinen Abfall; er antwortete mir, er wäre Türke, wie er Christ gewesen, und er wüßte nicht mehr vom Koran, als er vom Evangelium gewußt hätte. „Ich bin überzeugt“, erklärte er, „daß ich ruhig sterben werde und daß ich in diesem Augenblick viel glücklicher sein werde als Prinz Eugen. Ich habe sagen müssen: Gott ist Gott und Mohammed ist sein Prophet. Ich habe es gesagt, und die Türken kümmern sich nicht darum, ob ich es auch gedacht habe. Ich trage den Turban, wie ein Soldat die Uniform seines Gebieters tragen muß. Ich verstand nur das Kriegshandwerk und entschloß mich erst dann Generalleutnant des Großtürken zu werden, als ich nicht mehr wußte, wovon ich leben sollte. Als ich Venedig verließ, war die Suppe samt der Schüssel verzehrt; und hätte die jüdische Nation mir das Kommando über fünfzigtausend Mann angetragen, so würde ich Jerusalem belagert haben.“
Bonneval war ein schöner Mann, aber etwas zu wohlbeleibt. Er hatte einen Säbelhieb in den Unterleib empfangen und war dadurch gezwungen, beständig eine Binde mit einer silbernen Platte zu tragen. Er war nach Asien verbannt gewesen, doch nur für kurze Zeit; „denn“, so sagte er, „in der Türkei sind die Intrigen nicht so hartnäckig wie in Europa und besonders am Wiener Hof.“ Als ich ihn verließ, hatte er die Güte, mir zu erklären, er habe seit seiner Ankunft in der Türkei noch nicht zwei so angenehme Stunden wie die verbrach, die ich ihm verschafft, und er werde dem Bailo dafür danken.
Der Bailo Dona, der ihn in Venedig gut gekannt hatte, beauftragte mich, ihm tausend Grüße zu sagen, und Herr Veniero bedauerte sehr, nicht seine Bekanntschaft machen zu können.
Der zweite Tag nach meinem ersten Besuch war ein Donnerstag, und der Pascha verfehlte nicht, seinem Versprechen gemäß mir einen Janitscharen zu schicken. Er kam gegen elf Uhr, ich folgte ihm und fand diesmal den Pascha türkisch gekleidet. Seine Gäste fanden sich bald ein, und wir setzten uns, acht an der Zahl, zu Tisch, sämtlich in heiterer Stimmung. Die Mahlzeit war ganz französisch, im Zeremoniell sowohl wie in der Zubereitung der Speisen, sein Staatshofmeister und sein Koch waren zwei rechtschaffene französische Renegaten.
Er stellte mich allen Tischgenossen vor und nannte mir ihre Namen; doch zu sprechen bot sich hier erst am Ende der Mahlzeit Gelegenheit. Die Unterhaltung wurde ausschließlich italienisch geführt, und ich beobachtete, daß die Türken nicht ein einziges Wort in ihrer Sprache redeten, um sich die geringste Bemerkung mitzuteilen. Jeder Gast hatte zu seiner Rechten eine Flasche stehen, welche Weißwein oder auch Hadromel enthalten konnte. Ich weiß nur so viel, daß ich wie auch Herr Bonneval, der zu meiner Rechten saß, ausgezeichneten weißen Burgunder trank.
Ich mußte von Venedig, besonders aber von Rom erzählen, und das brachte das Gespräch auf die Religion, doch nicht auf das Dogma. Man beschränkte sich auf die Lehren und liturgischen Zeremonien. Einer der Gäste, den man Effendi nannte, weil er Minister der auswärtigen Angelegenheiten gewesen war, sagte, er hätte in Rom einen Freund in dem Gesandten Venedigs, von dem er mit Lob sprach. Ich stimmte als Echo ein und sagte ihm, ich hätte von demselben einen Brief an einen muselmännischen Herrn, den er ebenfalls seinen Freund nenne. Er fragte nach dessen Namen, doch da ich ihn vergessen hatte, blätterte ich in meiner Brieftasche, um in ihr den Brief zu suchen, und bereitete ihm große Freude, als ich seinen auf der Adresse verzeichneten Namen nannte. Er bat mich um Erlaubnis, den Brief lesen zu dürfen, und erhob sich, nachdem er die Unterschrift geküßt hatte, um mich zu umarmen. Dieser Auftritt rührte Herrn von Bonneval und die ganze Gesellschaft. Der Effendi, namens Ismail, lud Osman Pascha ein, mich an einem von ihm bestimmten Tage zu ihm zum Essen zu begleiten.
Trotz aller Zuvorkommenheit des edlen Effendi interessierte mich am meisten während dieses reizenden Mahls ein schöner Mann, der etwa sechzig Jahre alt zu sein schien und dessen Physiognomie den Ausdruck der Weisheit mit dem der vollendetsten Sanftmut vereinte. Zwei Jahre später fand ich seine Züge in dem schönen Kopf des venezianischen Senators Herrn von Bragadino wieder, von dem ich sprechen werde, wenn wir so weit gekommen sind. Er hatte mich mit der größten Aufmerksamkeit angehört, ohne das geringste Wort zu sprechen. In einer Gesellschaft reizt ein Mann, dessen Gesicht und Haltung interessieren, gewaltig die Neugier derer, die ihn nicht kennen, wenn er ein auffallendes Schweigen beobachtet. Als wir den Speisesaal verließen, fragte ich Herrn von Bonneval, wer er wäre. Er antwortete mir: es wäre ein reicher Mann, ein Philosoph von anerkannter Rechtschaffenheit, dessen Sittenreinheit ebenso groß wäre, wie seine Achtung für seine Religion. Er riet mir, seinen Umgang zu pflegen, wenn er mir entgegenkommen sollte.
Dieser Rat erfreute mich, und nachdem wir einen Gang durch die Alleen seines Gartens gemacht hatten und wieder in den nach türkischer Art möblierten Salon zurückgekehrt waren, setzte ich mich absichtlich in die Nähe von Jussuff Ali. Dies war der Name des Türken, der mich interessiert hatte. Er bot mir mit freundlichstem Wesen seine Pfeife an. Ich wies sie artig zurück und nahm die, die mir ein Diener Bonnevals reichte. Ich habe stets in Gesellschaft von Rauchern geraucht oder mich entfernt; denn sonst hätte ich mir eingebildet, den Rauch der andern zu schlucken; und dieser Gedanke, der ebenso wahr wie widerlich ist, empörte mich. Ich habe daher auch nie begreifen können, wie das übrigens so liebenswürdige schöne Geschlecht in Deutschland den erstickenden Qualm einer Menge von Rauchern einatmen kann.
Jussuff, erfreut, mich an seiner Seite zu sehen, richtete sogleich ähnliche Fragen an mich, wie die bei Tisch behandelten, besonders aber fragte er nach den Gründen, die mich bewogen hätten, den friedlichen geistlichen Stand aufzugeben, um Soldat zu werden; um seine Negier zu befriedigen, ohne mich bei ihm herabzusetzen, erzählte ich ihm mit Vorsicht die hauptsächlichsten Züge aus der Geschichte meines Lebens; denn ich glaubte ihn überzeugen zu müssen, daß ich die geistliche Laufbahn nicht aus innerem Drang eingeschlagen hätte. Er schien durch meine Erzählung befriedigt zu sein, und da er als stoischer Philosoph von der Berufung gesprochen hatte, erkannte ich deutlich, daß er Fatalist war. Ich war so klug, sein System nicht geradezu anzugreifen; meine Einwände gefielen ihm ohne Zweifel, weil er sich für stark genug hielt, um sie zu widerlegen.
Ich mußte wohl dem wackeren Muselmann große Achtung eingeflößt haben, daß er mich für wert hielt, sein Schüler zu werden; denn da ich erst neunzehn Jahre zählte und, wie er glauben mußte, in einen Unglauben verstrickt war, konnte er unmöglich daran denken, der meinige zu werden.
Nachdem er eine Stunde damit hingebracht hatte, mich zu katechisieren und meine Grundsätze anzuhören, sagte er mir, er hielte mich dazu geboren, die Wahrheit zu erkennen, denn er sähe, daß ich mich damit ernstlich beschäftigte und nicht überzeugt zu sein glaubte, sie schon erreicht zu haben. Er lud mich ein, einen Tag bei ihm zuzubringen, und bezeichnete mir die Tage der Woche, an denen ich ihn unfehlbar treffen würde. „Ehe Sie mich aber besuchen“, setzte er hinzu, „ziehen Sie Osman Pascha zu Rate.“ Ich entgegnete ihm, er hätte schon mit mir von ihm gesprochen und mich für ihn eingenommen, was ihm sehr schmeichelte. Nachdem ich ihm versprochen hatte, ihn an dem und dem Tage zu besuchen, trennten wir uns.
Ich teilte alles Herrn von Bonneval mit, der sich sehr darüber freute und mir sagte, sein Janitschar sollte sich täglich im venezianschen Hotel einfinden, um meinen Befehlen nachzukommen.
Die Herren Baili, denen ich von meinen Bekanntschaften erzählte, beglückwünschten mich, und Ritter Veniero riet mir, in einem Lande, wo die Langeweile für die Fremden fürchterlicher ist als die Pest, derartige Bekanntschaften nicht zu vernachlässigen. Am verabredeten Tage begab ich mich früh zu Jussuff, doch er war ausgegangen. Sein Gärtner, den er benachrichtigt hatte, bezeigte mir alle möglichen Aufmerksamkeiten, und ich verbrachte in angenehmer Weise zwei Stunden mit der Besichtigung aller Schönheiten des Gartens und besonders der Blumen. Dieser Gärtner war ein Neapolitaner, der dem Effendi seit dreißig Jahren gehörte. Nach seinem Benehmen nahm ich an, daß er wohl unterrichtet und von guter Familie war, er sagte mir aber offen, er hätte nie lesen gelernt, wäre Matrose gewesen, als er zum Sklaven gemacht worden wäre, und fühlte sich im Dienst Jussuffs so glücklich, daß er es für eine Strafe ansehen würde, wenn er ihm die Freiheit gäbe. Ich hütete mich wohl, ihn über die Angelegenheit seines Herrn zu befragen; denn wäre er verschwiegen gewesen, so hätte ich vielleicht wegen meiner Neugier erröten müssen.
Jussuff kam zu Pferde zurück, und nach den gewöhnlichen Komplimenten speisten wir ganz allein in einem Pavillon, von dem wir das Meer sehen konnten und wo wir uns eines angenehmen, die große Hitze mildernden Windes erfreuten. Dieser Wind, der sich täglich zur selben Stunde erhebt, ist der Nordwest, den man Mistral nennt. Wir aßen sehr gut, obwohl alle Gerichte nach Landesart zubereitet waren. Ich trank Wasser und Honigwasser und versicherte Jusuff, ich zöge dies Getränk dem Wein vor, von dem ich damals überhaupt nur wenig genoß. „Ihr Honigwasser“, sagte ich ihm, „ist ausgezeichnet, und die Muselmänner, die das Gesetz verletzen, indem sie Wein trinken, verdienen kein Mitleid, denn sie können nur von ihm trinken, weil er verboten ist.“
„Es gibt viele Gläubige“, versetzte er, „die ihn wie Arznei genießen zu können glauben. Der Leibarzt des Großherrn hat diese Arznei in Mode gebracht und dadurch sein Glück gemacht, denn er gewann die ganze Gunst seines Herrn, der beständig krank ist, zweifellos aber nur, weil er beständig betrunken ist.“
Ich sagte ihm, bei uns wären die Trunkenbolde selten und Trunksucht nur in den niedersten Klassen der Bevölkerung zu finden. Das überraschte ihn sehr.
„Ich verstehe nicht“, meinte er, „wie der Wein durch alle Religionen außer der unsrigen erlaubt sein kann, da er den Menschen des Gebrauchs seiner Vernunft beraubt.“
„Alle Religionen“, erwiderte ich, „verbieten seinen übermäßigen Genuß, und das Verbrechen kann also nur in dem damit getriebenen Mißbrauche bestehen.“ Ich überzeugte ihn davon, indem ich darauf hinwies, daß das Opium dieselben Wirkungen, ja sogar noch viel stärker hervorbrächte, und das, der Islam folglich auch dessen Gebrauch hätte verbieten müssen.
„Ich“, sagte er, „habe, solange ich lebe, weder Wein noch Opium genossen.“
Nach dem Essen brachte man die Pfeifen, die wir uns selbst stopften. Ich rauchte mit Vergnügen, aber ich spuckte dabei aus. Jussuff, der auf Türkenart rauchte, d.h. ohne zu spucken, sagte zu mir:
„Der Tabak, den Sie rauchen, ist ein ausgezeichnetes Gewächs, und Sie tun unrecht, den balsamischen Teil, der sich mit dem Speichel mischt, nicht zu verschlucken.“
„Ich glaube es; denn man kann nur dann einen Genuß an der Pfeife haben, wenn der Tabak vortrefflich ist.“
„Diese Vortrefflichkeit ist ohne Zweifel zum Vergnügen des Rauchens notwendig; doch das Vergnügen hieran ist nicht das größte, da es nur sinnlich ist. Die wahren Freuden sind die, die nur die Seele berühren und von den Sinnen ganz unabhängig sind.“
„Ich kann mir, lieber Jussuff, keine Freuden denken, die die Seele ohne Vermittlung der Sinne erfreuen.“
„Höre mich an! Wenn du deine Pfeife stopfst, macht dir das Vergnügen?“
„Ja.“
„Welchem deiner Sinne schreibst du das zu, wenn nicht deiner Seele? Weiter. Ist es nicht wahr, daß du dich befriedigt fühlst, wenn du sie erst fortlegst, nachdem du sie ganz ausgeraucht hast? Freut es dich nicht, wenn du siehst, daß nur Asche übrigbleibt?“
„Das ist wahr!“
„Das sind also zwei Genüsse, an denen die Sinne gewiß keinen Anteil haben; aber ich bitte dich, den dritten, den wesentlichsten, zu erraten.“
„Den wesentlichsten? Das ist der Wohlgeruch.“
„Durchaus nicht. Das ist ein Vergnügen des Geruchsorgans, er ist also sinnlich.“
„Ich wüßte nicht.“
„Höre! Das größte Vergnügen beim Rauchen besteht im Anblick des Rauches. Du darfst ihn nie aus der Pfeife kommen sehen, sondern nur aus dem Mundwinkel in bestimmten Zwischenräumen und nie zu oft. Daß dieses Vergnügen das größte ist, geht daraus hervor, daß du nie einen Blinden wirst rauchen sehe. Versuche selbst in deinem Zimmer nachts, ohne Licht, zu rauchen: einen Augenblick, nachdem du die Pfeife angezündet hast, wirst du sie weglegen.“
„Was du sagst, ist sehr wahr; doch du mußt mir verzeihen, wenn ich finde, daß mehrere Freuden, die die Sinne reizen, den Vorzug vor denen verdienen, die nur die Seele berühren.“
„Vor vierzig Jahren dachte ich so wie du; wenn du in vierzig Jahren weise geworden bist, wirst du wie ich denken. Die Freuden, mein teurer Sohn, die die Sinne erregen, stören die Ruhe der Seele; und das muß dir beweisen, daß sie als wahre Genüsse nicht genannt zu werden verdienen.“
„Mir scheint aber, als genügte es, sie zu wirklichen Genüssen zu machen, wenn sie mir als solche erscheinen.“
„Zugestanden; doch wenn du dir die Mühe nehmen wolltest, sie nach dem Genuß zu prüfen, würdest du sie nicht mehr dafür halten.“
„Das ist möglich, aber wozu sollte ich mir eine Mühe machen, die lediglich nur der Minderung meiner Freuden dienen würde?“
„Das Alter wird kommen, in dem du ein Vergnügen daran finden wirst, dir diese Mühe zu machen!“
„Mir scheint, mein teurer Vater, du ziehst das Alter der Jugend vor.“
„Sage kühn: das Greisenalter.“
„Du überraschst mich. Soll ich glauben, daß du in deiner Jugend unglücklich warst?“
„Weit entfernt. Ich war stets glücklich und wohlauf, niemals ein Opfer meiner Leidenschaften; doch was ich bei meinen Altersgenossen sah, war eine gute Schule, die mich lehrte, den Menschen kennenzulernen und den Weg zum Glück zu unterscheiden. Der glücklichste Mensch ist aber nicht der wollüstigste, sondern der, der die höchste Wollust zu wählen versteht; die großen Freuden, ich wiederhole es dir, sind nur die, die nicht die Leidenschaften aufregen und den Frieden der Seele mehren.“
„Diese Wollüste nennst du rein?“
„Ja, und ein solcher Genuß ist der Anblick einer weiten grünen Wiese. Die grüne Farbe, die unser göttlicher Prophet so hoch gepriesen hat, trifft mein Auge, und in diesem Augenblick fühle ich meinen Geist in einer so köstlichen Ruhe schwimmen, daß er sich mir dem Schöpfer der Natur zu nähern scheint. Ich empfinde denselben Frieden, eine gleiche Ruhe, als säße ich am Ufer eines Flusses und betrachtete die ruhige und doch stets sich bewegende Woge, die unablässig flieht, ohne meinen Augen doch je zu entschwinden, ohne daß ihre unaufhörliche Bewegung ihr etwas von ihrer Klarheit nimmt. Sie zeigt nur das Bild meines Lebens und die Seelenruhe, die ich mir wünsche, um gleich dem Wasser, das ich betrachte, ans Ziel zu gelangen, das ich nicht sehe und das erst am Ende seines Laufes liegt.“
So urteilte dieser Türke, und mit einem auf diesen Ton gestimmten Gespräch brachten wir vier Stunden hin. Er hatte zwei Frauen gehabt, die ihm zwei Söhne und eine Tochter geboren hatten. Der älteste Sohn hatte den ihm gebührenden Anteil an den Gütern seines Vaters erhalten und sich in Saloniki niedergelassen, wo er einen Großhandel betrieb; er war reich. Der zweite war im Serail im Dienste des Großherrn und sein Erbteil befand sich in den Händen eines Vormunds. Seine fünfzehnjährige Tochter Zelmi sollte die Erbin all seines Gutes werden. Er hatte ihr eine Erziehung gegeben, die zum Glück des ihr vom Himmel zum Gatten bestimmten Mannes genügen mußte. Wir werden bald von dieser Tochter sprechen. Die Mütter dieser drei Kinder waren tot. Seit fünf Jahren hatte er eine dritte Gattin genommen, aus Chios gebürtig, jung, eine vollkommene Schönheit. Er sagte mir aber, er könnte von ihr weder Sohn, noch Tochter erhoffen, da er zu alt wäre. Er zählte indes nur sechzig Jahre. Ehe ich ihn verließ, mußte ich ihm versprechen, jede Woche wenigstens einen Tag bei ihm zuzubringen.
Beim Abendessen erzählte ich den Herren Baili, welch einen angenehmen Tag ich verlebt hatte. „Wir beneiden Sie“, erklärten sie mir, „daß Sie die Aussicht haben, drei Monate angenehm in einem Lande zu verbringen, in dem wir als Beamte dazu verurteilt sind, vor Langeweile zu vertrocknen.“
Wenige Tage darauf nahm mich Herr von Bonneval mit sich zum Essen zu Ismail, wo ich in großem das Bild des asiatischen Luxus sah; doch die Gesellschaft war zahlreich, die Unterhaltung wurde beinahe ganz in türkischer Sprache geführt, was mich ebenso wie Herrn von Bonneval sehr langweilte. Ismail, der das hatte, bat mich nach der Tafel, mit ihm, so oft ich wollte, zu frühstücken, indem er mir versicherte, daß ich ihm damit ein großes Vergnügen bereiten würde. Ich versprach es ihm und ging zehn oder zwölf Tage später hin. Ich werde den Leser bitten, an der Partie teilzunehmen, wenn wir soweit sind; doch jetzt muß ich zu Jussuff zurückkehren, der bei meinem zweiten Besuch einen Charakter offenbarte, der mich mit der größten Achtung und Zuneigung für ihn erfüllte.
Nachdem wir wie das erstemal allein miteinander gegessen hatten, kam das Gespräch auf die Künste, und ich sagte meine Ansicht über eine Vorschrift des Korans, die die Mohammedaner des unschuldigen Vergnügens beraubt, Erzeugnisse der Malerei und Bildhauerei zu genießen. Er sagte mir, Mohammed hätte als weiser Gesetzgeber alle Bilder von den Augen der Moslemiten entfernen müssen. „Denke daran, mein Sohn, daß alle Nationen, die der Prophet mit Gott bekannt machte, Götzendiener waren. Die Menschen sind schwach; hätten sie dieselben Gegenstände gesehen, so hätten sie leicht in dieselben Irrtümer zurückfallen können.“
„Ich glaube, mein teurer Vater, daß niemals irgendeine Nation ein Bild angebetet hat, sondern nur die Gottheit, an die sie dadurch erinnert wurde.“
„Ich will es glauben, aber da Gott nicht Stoff sein kann, muß man von gewöhnlichen Köpfen den Gedanken fernhalten, daß er es sein könnte. Ihr Christen seid die einzigen, die Gott zu sehen glauben!“
„Das ist wahr, wir sind dessen sicher, doch merke wohl, bitte, was uns diese Gewißheit gibt, ist nur der Glaube.“
„Ich weiß es, aber ihr seid darum nicht weniger Götzendiener, denn was ihr seht, ist nur Stoff; ihr seid aber eurer Vision vollständig gewiß, es sei denn, daß du behaupten willst, daß der Glaube sie schwächt.“
„Gott bewahre mich davor! Ganz im Gegenteil: der Glaube stärkt sie.“
„Das ist eine Täuschung, deren wir, Gott sei Dank, nicht bedürfen, und es gibt keinen Philosophen auf der Welt, der mir die Notwendigkeit davon beweisen könnte.“
„Das, mein teurer Vater, gehört nicht zur Philosophie, sondern zur Theologie, die hoch über ihr steht.“
„Du redest dieselbe Sprache, wie unsere Theologen, die sich von den euren nur dadurch unterscheiden, daß sie ihre Wissenschaft dazu anwenden, die Wahrheiten, die wir kennen lernen müssen, deutlicher zu machen, während die eurigen es sich angelegen sein lassen, sie zu verdunkeln.“
„Bedenkt, mein teurer Jussuff, daß es sich um ein Mysterium handelt.“
„Die Existenz Gottes ist eins, und zwar ein so großes, daß die Menschen es nicht wagen dürfen, etwas hinzuzufügen. Gott kann nur eins sein. Jede Zusammensetzung würde sein Wesen zerstören, und er ist der Gott, den der Prophet uns verkündet hat und der für alle Menschen und für alle Zeiten derselbe sein muß. Gib zu, daß man der Einheit Gottes nichts zuzusetzen weiß. Wir sagen, er ist der alleinige Gott: das ist ein Bild der Einfachheit. Ihr sagt, er ist Eins und Drei zugleich. Und das erscheint mir als eine widerspruchsvolle, lächerliche und gottlose Erklärung.“
„Es ist ein Mysterium!“
„Sprichst du von Gott oder von der Definition? Ich spreche von der Definition, die kein Mysterium sein darf und die der Verstand verwerfen muß. Der gesunde Verstand, mein Sohn, muß eine Versicherung, die auf einer Abgeschmacktheit beruht, unverschämt finden. Beweise mir, daß Drei keine Zusammensetzung ist oder es nicht sein kann, und ich werde Christ!“
„Meine Religion gebietet mir zu glauben, ohne zu urteilen, und ich bebe, mein teurer Jussuff, bei dem Gedanken, daß ich durch eine tiefgründige Beweisführung dazu gebracht werden könnte, die Religion meines Vaters abzuschwören. Zunächst müßte ich die Überzeugung haben, daß er im Irrtum gelebt hat. Sag’ mir, ob ich, wenn ich sein Andenken ehre, mich selbst zu seinem Richter machen darf mit der Absicht, seine Verurteilung auszusprechen?“
Dieser lebhafte Widerspruch rührte den wackeren Jussuff, doch nach einigen Augenblicken des Schweigens sagte er mir:
„Mit diesen Gesinnungen, mein Sohn, kannst du Gott nur wert sein, und mußt folglich auserkoren sein. Bist du im Irrtum, so kann nur Gott dich demselben entreißen; denn ich kenne keinen rechtschaffenen Menschen, der imstande wäre, das Gefühl, das du mir gegenüber ausgesprochen hast, zu widerlegen.“
Wir sprachen noch von tausend anderen freundlichen Dingen, und gegen Abend trennten wir uns mit den Versicherungen der aufrichtigsten Freundschaft und Ergebenheit.
Als ich, den Kopf noch ganz voller Gedanken an unsere Unterhaltung, mich zurückzog, dachte ich nach und fand, daß alles, was Jussuff mir über das Wesen Gottes gesagt hatte, wohl wahr sein könnte, denn ganz sicher konnte das Wesen aller Wesen in seiner Wesenheit nur das einfachste aller Wesen sein; doch ich fand es auch unmöglich, mich wegen eines Irrtums der christlichen Religion überreden zu lassen, die türkische anzunehmen, die wohl eine wahre Ansicht von Gott haben konnte, die aber meine Lachlust herausforderte, weil sie ihre Existenz nur dem ausschweifendsten aller Betrüger verdankte. Übrigens hatte, wie ich glaubte, Jussuff auch nicht die Absicht, aus mir einen Proselyten zu machen.
Als ich zum drittenmal bei ihm aß, kam das Gespräch noch einmal auf die Religion.
„Bist du überzeugt, mein teurer Vater, daß man nur in deiner Religion sein Heil finden kann?“
„Nein, mein teurer Sohn, diese Gewißheit habe ich nicht, und kein Mensch würde sie haben, doch habe ich die Überzeugung, daß die christliche Religion falsch ist, denn sie kann nicht allgemein werden!“
„Warum nicht?“
„Weil es auf drei Vierteln der Erde weder Brot noch Wein gibt. Bemerke, daß der Koran überall befolgt werden kann.“
Ich wußte ihm nichts zu antworten und glaubte keine Umschweife machen zu dürfen.
„Wenn Gott nicht Stoff ist“, sagte ich ihm, „muß er also Geist sein?“
„Wir wissen, was er nicht ist, aber nicht, was er ist, und der Mensch kann nicht behaupten, daß er Geist ist, denn wir können uns nur einen abstrakten Begriff von ihm machen. – Gott ist immateriell, das ist alles, was wir wissen, und mehr werden wir niemals erfahren.“
Das erinnerte mich an Plato, der genau dasselbe gesagt hatte, und ganz gewiß hatte Jussuff niemals Plato gelesen.
Er sagte mir am selben Tage, daß die Existenz Gottes nur denen nützlich sein könnte, die an ihr nicht zweifelten, und daß folglich die unglücklichsten Sterblichen die Atheisten wären. „Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen, damit unter allen Wesen, die er schuf, eins sei, das ihm huldigte. Ohne den Menschen hätte Gott keinen Zeugen seines eigenen Ruhms; und der Mensch muß folglich begreifen, daß seine erste Pflicht darin besteht, ihn zu rühmen, indem er Gerechtigkeit übt und sich seiner Vorsehung anvertraut.
Bemerke, daß Gott nie den Menschen verläßt, der sich in seinem Unglück vor ihm niederwirft und seine Hilfe anfleht, und daß er so oft den Unglücklichen untergehen läßt, der das Gebet für unnütz hält.“
„Es gibt indes auch glückliche Atheisten.“
„Das ist wahr, doch trotz der Ruhe ihrer Seele scheinen sie mir beklagenswert, da sie nichts nach diesem Leben hoffen und sich folglich dem Tiere nicht überlegen halten können. Sind sie Philosophen, so müssen sie außerdem noch in der Ungewißheit schmachten. Und wenn sie an nichts glauben, haben sie keine Hilfe im Mißgeschick. Endlich hat Gott den Menschen so geschaffen, daß er nur glücklich sein kann, indem er nicht an seiner göttlichen Existenz zweifelt. In welchem Zustand er sich auch befinden möge, er hat das unbedingte Bedürfnis, dies zuzugestehen; sonst hätte der Mensch niemals einen Gott als Schöpfer aller Dinge zugestanden.“
„Doch ich möchte wissen, warum der Atheismus niemals anders als im System irgendeines Weisen bestanden hat, während es kein Beispiel gibt, daß er jemals im System einer ganzen Nation existierte.“
„Das kommt daher, daß der Arme viel mehr als der Reiche seine Bedürfnisse fühlt. Es gibt unter uns eine Menge Gottloser, die die Gläubigen verspotten, weil diese ihr ganzes Vertrauen in die Pilgerfahrt nach Mekka setzen. Die Unglücklichen! Sie müßten die Denkmäler ehren, die die Frömmigkeit der glaubensfreudigen Seelen erwecken, sie in ihrer Religion nähren und sie zur Erduldung des Mißgeschickes ermutigen. Ohne diese tröstlichen Gegenstände würde das Volk sich bei jedem Anlaß einem Übermaß der Verzweiflung hingeben.“
Entzückt von der Aufmerksamkeit, mit der ich ihn anhörte, überließ Jussuff sich seiner Neigung, mich zu belehren, und ich meinerseits fühlte mich zu ihm durch die Anziehungskraft hingezogen, die die liebenswürdige Tugend auf alle Herzen ausübt; so brachte ich meine Tage ohne besondere Einladung bei ihm zu, und Jussuffs Freund- schaft wurde zur zärtlichsten Neigung.
Eines Morgens befahl ich meinem Janitscharen, mich zu Ismail Effendi zu begleiten, um meinem Versprechen gemäß bei ihm zu frühstücken. Nachdem er mich mit dem edelsten Anstand empfangen hatte, lud er mich zu einem Spaziergang in einem kleinen Garten ein; von hier aus traten wir in ein Landhaus ein, wo er Einfälle bekam, die ich nicht nach meinem Geschmack fand, so daß ich ge- zwungen war, ihn zurückzuweisen, indem ich etwas hastig aufstand. Nun erklärte der Türke, er habe nur mein Zartgefühl auf die Probe stellen und sich nur einen Scherz machen wollen. Wenige Augen- blicke später verließ ich ihn mit der Absicht, nicht mehr zu ihm zurückzukehren. Ich war indes genötigt, ihn wiederzusehen, und werde später erzählen, weshalb. Sobald ich den Grafen von Bonneval sah, erzählte ich ihm dies Geschichtchen, und er sagte mir, nach türkischen Sitten hätte Ismail mir einen großen Beweis seiner Freundschaft geben wollen; doch dürfte ich überzeugt sein, daß ich von seiner Seite keinen Rückfall zu befürchten hätte, und in dieser Uberzeugung erforderte es die Höflichkeit, daß ich ihn noch weiterhin besuchte; übrigens wäre Ismail ein vollkommener Ehrenmann und hätte die schönsten Sklavinnen der Türkei zu seiner Verfügung.
Als unser vertrauter Umgang etwa fünf oder sechs Wochen ge- dauert hatte, fragte Jussuff mich eines Tags, ob ich verheiratet wäre. Als ich ihm verneinend geantwortet hatte, wandte sich die Unterhaltung verschiedenen Gegenständen der Moral zu und fiel endlich auf die Keuschheit, die seiner Ansicht nach nur unter dem Gesichtspunkte der Enthaltung als eine Tugend angesehen werden könnte, doch weit entfernt, Gott angenehm zu sein, ihm vielmehr nicht gefallen müßte, da sie das erste den Menschen gegebene Gebot verletzte.
„Ich möchte wissen“, sagte er, „was die Keuschheit eurer Malteserritter ist. Sie legen das Gelübde der Keuschheit ab, doch verzichten sie damit nicht auf die Frauen, sondern nur auf die Ehe. Ihre Keuschheit und folglich die Keuschheit überhaupt kann also nur durch die Ehe verletzt werden; und doch ist die Ehe eines eurer Sakramente. Diese Herren versprechen also nur, das Werk des Fleisches in dem einzigen ihnen von Gott gestatteten Fall nicht zu vollbringen; aber sie behalten sich vor, diese Freiheit auf unerlaubte Weise sich anzumaßen, so oft es ihnen beliebt und gut scheint. Und diese unerlaubte und unmoralische Freiheit ist ihnen in so hohem Grade gewährt, daß sie einen Sohn anerkennen dürfen, den sie nur bekommen konnten, indem sie ein doppeltes Verbrechen begingen. Besonders empörend ist, daß sie diese Kinder des Verbrechens, die ohne Zweifel unschuldig sind, natürliche Kinder nennen, wie wenn die aus der ehelichen, als Sakrament anerkannten Verbindung auf widernatürliche Weise geboren würden. Endlich, mein lieber Sohn, ist das Gelübde der Keuschheit der göttlichen Moral und menschlichen Natur derart widersprechend, daß es weder Gott noch der Gesellschaft oder den Personen, die es ablegen, angenehm sein kann; und da es diesem allem widerspricht, ist es notwendigerweise ein Verbrechen.“
Er wiederholte die Frage, ob ich verheiratet wäre, und als ich ihm verneinend geantwortet hatte und hinzufügte, ich glaubte, daß ich nie gezwungen sein würde, das Band der Ehe zu knüpfen, unterbrach er mich mit den Worten:
„Wie? Ich muß also glauben, daß du kein vollkommener Mann bist oder daß du dich selbst verdammen willst, wenn du mir nicht wenigstens sagst, daß du nur scheinbar ein Christ bist!“
„Ich bin vollkommener Mann und bin Christ. Ich will dir sogar sagen, daß ich das schöne Geschlecht anbete und durchaus keine Lust habe, die süßesten Freuden abzuschwören.“
„Du wirst nach deiner Religion verdammt sein.“
„Sicherlich nicht, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, müssen uns unsere Priester ledig sprechen.“
„Ich weiß es; doch gib mir zu, daß es eine Einfalt ist, zu behaupten, Gott verzeihe dir ein Verbrechen, das du vielleicht nicht begehen würdest, wenn du nicht den Glauben hättest, daß ein Priester, ein Mensch wie du, dich, wenn du es beichtest, absolvieren wird. Gott sieht nur auf die Reue.“
„Das ist nicht zweifelhaft, und die Beichte setzt es voraus; wäre dem nicht so, so ist die Absolution unwirksam.“
„Ist die Masturbation bei euch auch eine Sünde?“
„Eine viel größere als die außereheliche fleischliche Vermischung.“
„Ich weiß es, und das hat mich stets überrascht; denn jeder Gesetzgeber, der ein Gesetz erläßt, dessen Ausübung unmöglich ist, ist ein Dummkopf. Ein Mann, der sich wohl befindet und keine Frau hat, muß unbedingt zur Masturbation kommen, wenn die gebieterische Natur sie ihm zur Notwendigkeit macht; und wer aus Furcht, seine Seele zu beflecken, sich derselben enthielte, würde einer tödlichen Krankheit verfallen.“
„Man glaubt bei uns das gerade Gegenteil. Man ist überzeugt, daß die jungen Leute durch dies Verfahren ihr Temperament verderben und ihr Leben verkürzen. In manchen Erziehungsanstalten überwacht man sie und nimmt ihnen soviel wie tunlich die Möglichkeit, dies Verbrechen an sich zu begehen.“
„Diese Aufpasser sind einfältige Dummköpfe, und die Leute, die sie dafür bezahlen, sind noch dümmer; denn das Verbot muß den Drang mehren, ein so tyrannisches, auch widernatürliches Gesetz zu verletzen.“
„Doch mir scheint, das Übermaß dieser Unordnung muß der Gesundheit schädlich sein, denn es entnervt und schwächt.“
„Gewiß, denn alles Übermaß ist schädlich und verderblich. Aber dies Übermaß kann nur da vorkommen, wo dazu herausgefordert wird, und durch das Verbot fordert man dazu heraus. Wenn man in dieser Beziehung bei euch die Mädchen nicht hindert, so sehe ich nicht ein, warum man gegen die Knaben anders verfährt.“
„Das kommt daher, weil die Mädchen bei weitem nicht die gleiche Gefahr laufen; denn sie haben nur einen geringen Verlust; außerdem strömt dieser nicht aus der gleichen Quelle, aus der der Same der Männer kommt.“
„Davon weiß ich nichts, doch wir haben Ärzte, die behaupten, die bleiche Farbe rühre bei den Mädchen nur von dem Mißbrauch dieses Vergnügens her.“
Nachdem Jussuff Ali diese und andere Gespräche mit mir gepflogen hatte, bei denen er mich sehr vernünftig zu finden schien, selbst wenn ich seiner Ansicht widersprach, machte er mir fast wörtlich folgenden Vorschlag, der mich in großes Staunen versetzte. „Ich habe“, sagte er nur, „zwei Söhne und eine Tochter. Ich denke nicht mehr an die Söhne, da sie schon den ihnen gebührenden Teil von meinen Gütern erhielten. Meine Tochter wird nach meinem Tode all meinen Besitz erhalten; außerdem bin ich imstande, das Glück des Mannes zu machen, den sie zu meinen Lebzeiten heiraten wird. Ich habe vor fünf Jahren eine junge Frau genommen, doch hat sie mir keine Nachkommen gegeben, und ich bin überzeugt, daß sie mir auch keine mehr schenken wird. Meine Tochter Zelmi ist fünfzehn Jahre, sie ist schön, hat schwarze und glänzende Augen wie ihre Mutter, die schönsten schwarzen Haare, eine Brust wie Alabaster, ist groß, wohlgewachsen und von sanftem Charakter, ich habe ihr eine Erziehung gegeben, die sie würdig machen würde, das Herz unseres Gebieters zu besitzen. Sie spricht fließend Griechisch und Italienisch; sie singt zum Entzücken und begleitet sich dazu auf der Harfe; sie zeichnet, stickt und ist stets köstlich heiter. Kein Mann auf Erden kann sich rühmen, je ihr Gesicht gesehen zu haben, und sie selbst kennt nur meinen Willen. Diese Tochter ist ein Schatz, und ich biete sie dir an, wenn du ein Jahr in Adrianopel bei einem meiner Verwandten wohnen willst, wo du unsere Sprache und unsere Sitten lernen könntest. Nach Verlauf eines Jahres kommst du zurück und sobald du dich zum Islam bekehrt hast, wird meine Tochter deine Frau werden. Du findest ein eingerichtetes Haus, Sklaven, deren Gebieter du bist, und ein Einkommen, von dem du im Überfluß leben kannst. Das ist alles. Du sollst mir nicht heute, auch nicht morgen, noch an einem bestimmten Tage antworten. Du sollst mir antworten, wenn du dich durch deinen Geist dazu getrieben fühlst, und deine Antwort wird die Annahme meines Anerbietens sein. Wenn du es zurückweisest, brauchen wir nicht mehr davon zu sprechen. Ich empfehle dir auch nicht, an diese Angelegenheit zu denken; denn von dem Augenblick an, wo ich den Keim in deine Seele senkte, wirst du nicht mehr Herr sein, deren Erfüllung zuzugestehen oder dich ihr zu widersetzen. Ohne dich zu übereilen, ohne zu zögern, ohne dich zu beunruhigen, wirst du nur den Willen Gottes tun, indem du dem unwiderruflichen Ausspruch deines Schicksals folgst. So wie ich dich kenne, bedarfst du nur der Gesellschaft Zelmis, um glücklich zu werden, und du wirst, ich sehe es voraus, eine Säule des ottomanischen Reiches werden.“
Nachdem Jussuff diese Worte gesprochen hatte, drückte er mich an sein Herz, und um mir keine Zeit zur Antwort zu gewähren, verließ er mich. Was ich gehört hatte, beschäftigte mich so daß ich heimkam, ohne es zu merken. Die Baili fanden mich nachdenklich und fragten mich nach dem Grunde; aber wie man sich denken kann, hütete ich mich wohl, ihre Neugierde zu befriedigen. Ich fand Jussuffs Worte nur zu wahr; die Sache war so wichtig, daß ich sie nicht nur niemandem mitteilen durfte, sondern daß ich mich sogar des Gedankens daran enthalten mußte, bis mein Geist ruhig genug war, um mir die Überzeugung zu gewähren, daß nichts Fremdes in die Wagschale fallen und meine Entscheidung beeinflussen könnte. Alle meine Leidenschaften mußten schweigen; Vorurteile, Befangenheit, Liebe und persönliches Interesse, alles mußte in der vollkommensten Ruhe und Untätigkeit bleiben.
Am nächsten Tage drängte sich mir beim Erwachen eine kleine Betrachtung über die Sache auf, und ich sah, daß ich ganz gewiß nicht daran denken durfte, wollte ich mich entschließen; eine derartige Entscheidung durfte mir nur wie durch Eingebung und ohne alle Überlegung kommen. Es war der Fall des Sequere deum – Gib dich Gott anheim – der Stoiker.
Ich verbrachte vier Tage, ohne Jussuff zu sehen, und als ich am fünften bei ihm war, plauderten wir heiter miteinander, ohne von der Sache mit einem Wort zu sprechen, obwohl wir ganz unbedingt daran denken mußten. Wir verlebten so vierzehn Tage einander gegenüber, ohne über das, was uns am meisten beschäftigte, zu sprechen; doch da unser Schweigen nicht von Heuchelei, noch von irgendeinem unserer gegenseitigen Achtung und Freundschaft widersprechenden Gefühle herrührte, sagte er mir eines Tags, er dächte sich, ich hätte seinen Vorschlag irgendeinem Weisen mitgeteilt, um mich durch einen guten Rat zu stärken. Ich beeilte mich, ihm das Gegenteil zu versichern, indem ich ihm sagte, bei einer Sache von so zarter Natur glaubte ich nicht dem Rat irgendeines andern folgen zu dürfen. „Ich habe mich Gott überlassen, mein teurer Jussuff, und da ich ihm volles Vertrauen schenke, bin ich überzeugt, daß ich das Richtige wählen werde, sei es, daß ich mich entschließe, dein Sohn zu werden, sei es, daß ich glaube bleiben zu müssen wie ich bin. Inzwischen beschäftigte der Gedanke an diese Sache meine Seele morgens und abends und in allen Augenblicken, wo ich mit mir ganz allein ruhig und gesammelt bin. Wenn ich entschlossen bin, werde ich nur dir allein die Kunde mitteilen, und von diesem Augenblick an sollst du über mich die Autorität eines Vaters ausüben.“ Bei diesen Worten legte der tugendhafte Jussuff, die Augen voller Tränen, seine linke Hand auf meinen Kopf und die beiden ersten Finger der rechten Hand auf meine Stirn mit den Worten: „Fahre so fort, mein teurer Sohn, und sei überzeugt, daß du dich nicht täuschen wirst.“
„Aber“, sagte ich ihm, „könnte es nicht geschehen, daß Zeltmi mich nicht nach ihrem Geschmack fände?“
„Darüber beruhige dich. Meine Tochter liebt dich, sie hat dich gesehen. Sie sieht dich mit meiner Frau und ihrer Gouvernante, so oft wir zusammen essen, und hört dir mit Vergnügen zu.“
„Aber sie weiß nicht, daß du mich ihr zum Gatten zu geben gedenkst?“
„Sie kennt meinen Wunsch, daß du ein Gläubiger werdest, um dein Geschick mit dem ihrigen zu verbinden.“
„Es freut mich, daß es dir nicht erlaubt ist, sie mich sehen zu lassen; denn sie könnte mich blenden, und dann gäbe die Leidenschaft den Ausschlag für die Wagschale. Ich könnte mir nicht mehr schmeicheln, mich in der ganzen Reinheit meiner Seele entschieden zu haben.“
Als Jussuff mich so sprechen hörte, freute er sich außerordentlich, und ich meinte es gewiß ganz aufrichtig. Schon der Gedanke, Zelmi zu sehen, ließ mich erbeben. Ich fühlte, ich wäre, wenn ich in sie verliebt gewesen wäre, Muselmann geworden, um sie zu besitzen, und hätte es zweifellos bereut; denn die mohammedanische Religion bot meinen Augen und meinem Geist nur ein unangenehmes Bild, sowohl in bezug auf dieses wie auf jenes Leben. Und der Reichtum rechtfertigte meiner Meinung nach keinen Schritt gleich dem von mir geforderten. Übrigens konnte ich gleiche Reichtümer in ganz Europa finden, ohne deshalb meiner Stirn den schmachvollen Flecken der Abtrünnigkeit aufzudrücken. Ich hielt auf die Achtung der ausgezeichneten Personen, die mich kannten, und wollte mich derselben nicht unwürdig zeigen. Außerdem ward ich von dem Wunsch getrieben, mir bei den zivilisiertem und gebildeten Nationen entweder in den schönen Künsten oder in der Literatur oder in einer anderen ehrenvollen Laufbahn Ruhm zu erwerben, und ich konnte mich nicht entschließen, meinen Zeitgenossen die Triumphe zu überlassen, die meiner vielleicht warteten, wenn ich in ihrer Mitte lebte. Es erschien mir und erscheint mir noch, als könnte der Entschluß, den Turban zu nehmen, nur einem verzweifelten Christen beikommen, und ein solcher war ich zum Glück nicht. Besonders empörte mich der Gedanke, ein Jahr in Adrianopel leben zu müssen, um dort eine barbarische Sprache zu lernen, gegen die ich nur Widerwillen empfand und die ich folglich schlecht gelernt hätte. Wie konnte ich auch in meinem Alter auf das für mein Selbstgefühl schmeichelhafte Vorrecht verzichten, für einen Schönredner zu gelten? Und diesen Ruf hatte ich überall, wo ich bekannt war. Außerdem dachte ich manchmal, Zelmi, dies achte Wunder in den Augen ihres Vaters, könnte den meinen nicht ebenso erscheinen, und das würde zu meinem Unglück genügt haben; denn Jussuff konnte leicht noch zwanzig Jahre leben, und ich fühlte, daß Achtung und Dankbarkeit mir nie gestattet haben würden, den guten Greis zu kränken, was gewiß geschehen wäre, wenn ich seiner Tochter nicht alle Rücksichten eines guten Gatten gezeigt hätte. Das waren die Gedanken, die mich beschäftigten, und da Jussuff sie nicht erraten konnte, brauchte ich sie ihm nicht anzuvertrauen.
Wenige Tage danach fand ich bei Osman Pascha meinen Ismail Effendi zum Essen. Er bekundete mir große Freundschaft, und ich antwortete darauf, indem ich über seine Vorwürfe, solange nicht bei ihm gefrühstückt zu haben, hinwegglitt. Ich konnte es nicht abschlagen, bei ihm zu essen, und er gewährte mir ein reizendes Schauspiel: neapolitanische Sklaven beider Geschlechter führten eine Pantomine auf und tanzten Kalabreser Tänze. Herr von Bonneval sprach von dem venezianischen Tanz Furlana, und da Ismail mir das lebhafte Verlangen kundgab, diesen kennenzulernen, sagte ich ihm, es wäre mir unmöglich, ihn zu befriedigen, wenn ich nicht eine Tänzerin aus meinem Lande hätte und einen Violinisten, der die Melodie kenne. Danach ergriff ich selbst eine Violine und spielte die Melodie des Tanzes. Aber selbst wenn eine Tänzerin gefunden worden wäre, hätte ich doch nicht zugleich tanzen und spielen können.
Ismail erhob sich und sprach heimlich mit einem seiner Eunuchen. Dieser ging hinaus, kam wenige Minuten danach zurück und sagte ihm etwas ins Ohr. Darauf sagte mir der Effendi, die Tänzerin wäre gefunden; ich entgegnete ihm, der Violinspieler wurde sich ebenfalls bald finden, wenn er ein Briefchen in den venezianischen Botschaftspalast schicken wollte, was auch sogleich geschah. Der Bailo Dona schickte mir einen seiner Leute, einen trefflichen Violinisten. Sobald der Musiker bereit war, öffnete sich eine Pforte, und herein trat eine schöne Frau, das Gesicht mit einer jener Samtmasken bedeckt, die man in Venedig Moretta nennt. Die Erscheinung dieser schönen Maske überraschte und entzückte die Anwesenden, denn es ist unmöglich, sich eine einnehmendere Erscheinung zu denken. Vollendet schön war, was man von ihrem Gesicht sehen konnte, und die größte Teilnahme erregte die Anmut ihrer Formen, die Schönheit ihres Wuchses, die wollüstige Weichheit ihrer Umrisse und der ausgezeichnete Geschmack ihres Putzes. Die Nymphe wählte ihre Stellung, ich machte es wie sie, und wir tanzten hintereinander sechs Furlanen.
Ich war sehr erhitzt und außer Atem, denn es gibt keinen feurigeren Nationaltanz. Die Schöne aher stand da, ohne das mindeste Zeichen der Ermüdung zu geben, und schien mich herauszufordern. Bei der Ronde des Balletts, dem schwierigsten Teil, schien sie zu schweben. Ich war vor Erstaunen außer mir, denn ich konnte mich nicht erinnern, dies Ballett selbst in Venedig je so schön tanzen gesehen zu haben. Nach einigen Minuten der Ruhe trat ich ein wenig beschämt über meine Ermüdung an sie heran und sagte: „Ancora sei, e poi basta, se non volete vedermi a morire – Noch sechs, aber dann nicht mehr, wenn Sie mich nicht wollen sterben sehen.“ Sie hätte mir, wenn sie gekonnt hätte, geantwortet, doch sie trug eine jener barbarischen Masken, die jedes Sprechen unmöglich machen. In Ermanglung eines Wortes ließ ein Druck der Hand, den niemand sehen konnte, mich alles erraten. Sobald die zweiten sechs Furlanen beendet waren, öffnete ein Eunuch die Tur, und meine schöne Partnerin verschwand.
Ismail erschöpfte sich in Danksagungen und doch hätte ich sie ihm machen sollen, denn dies war das einzige wahre Vergnügen, das ich in Konstantinopel hatte. Ich fragte ihn, ob die Dame Venezianerin wäre; doch er antwortete mir nur durch ein bedeutungsvolles Lächeln. Gegen Abend trennten wir uns.
„Der gute Mann“, sagte mir Herr von Bonneval, als wir uns zurückzogen, „hat sich heute von seiner Prachtliebe verleiten lassen, und ich bin überzeugt daß, er schon seine Tat bereut hat, seine schöne Sklavin mit Ihnen tanzen zu lassen! Nach dem Vorurteil des Landes gefährdet das seinen guten Ruf; denn Sie haben ganz sicher das arme Mädchen in Flammen gesetzt. Ich rate Ihnen, auf der Hut zu sein und sich in acht zu nehmen, denn sie wird mit Ihnen einen Liebeshandel anzuknüpfen versuchen. Doch seien Sie klug, denn nach den hierzulande herrschenden Sitten sind derartige Umtriebe stets gefährlich.“
Ich versprach ihm, keinen falschen Schritt zu machen, doch ich hielt nicht Wort; denn drei oder vier Tage später begegnete mir eine alte Sklavin auf der Straße und bot mir einen goldgestickten Tabaksbeutel für einen Piaster an, und indem sie ihn mir in die Hände drückte, ließ sie mich fühlen, daß er einen Brief enthielt.
Ich bemerkte, daß sie die Augen des hinter mir gehenden Janitscharen vermied. Ich gab ihr einen Piaster, sie ging davon, und ich setzte meinen Weg nach dem Hause Jussuffs fort. Da ich den guten Türken nicht fand, ging ich in seinem Garten spazieren, um in aller Ruhe den Brief lesen zu können. Er war versiegelt und ohne Adresse, die Sklavin konnte sich getäuscht haben. Das vermehrte meine Neugier. Ich brach das Siegel und las folgende Zeilen in richtig geschriebenem Italienisch: „Wenn Sie neugierig sind, die Person zu sehen, die mit Ihnen die Furlana getanzt hat, so machen Sie gegen Abend im Garten jenseits des Teiches einen Spaziergang, und machen Sie sich mit der alten Magd des Gärtners bekannt, indem Sie um Limonade bitten. Sie können sie vielleicht sehen, ohne Gefahr zu laufen, selbst wenn Ismail Sie sehen sollte; sie ist Venezianerin. Es ist wichtig, daß Sie von dieser Einladung zu niemandem sprechen.“
„Ich bin nicht so einfältig, meine schöne Landsmännin!“ rief ich, als wäre sie zugegen gewesen, und steckte den Brief in meine Tasche. Da trat eine schöne alte Frau hinter einem Gebüsch hervor, nannte meinen Namen und fragte mich, was ich wünschte und wie ich sie bemerkt hätte. Ich antwortete ihr lächelnd, ich hätte in die Luft gesprochen, da ich nicht geglaubt hätte, daß mich jemand hörte. Nun sagte sie geradeheraus, sie wäre erfreut, mich zu sprechen, denn sie wäre Römerin, hätte Zelmi erzogen und sie singen und Harfe spielen gelehrt. Dann sprach sie mir lobend von den Schönheiten und vortrefflichen Eigenschaften ihrer Schülerin und sagte, ich würde gewiß in sie verliebt werden, wenn ich sie sähe, und es verdrösse sie, daß es nicht erlaubt wäre. „Sie sieht uns in diesem Augenblick“, fügte sie hinzu, „hinter dieser grünen Jalousie, und wir lieben Sie, seit uns Jussuff gesagt hat, Sie könnten Zelmis Gatte werden.“
„Darf ich zu Jussuff von unserer Unterhaltung sprechen?“ fragte ich sie.
„Nein.“
Dies Nein gab mir zu verstehen, daß, wäre ich nur ein wenig in sie gedrungen, sie sich hätte bestimmen lassen, mir ihre reizende Schülerin zu zeigen, und vielleicht hatte sie sogar in dieser Hoffnung mich aufgesucht. Der Gedanke aber, einen meinem teuren Gastfreunde mißfallenden Schritt zu tun hielt mich zurück. Außerdem, und noch mehr als das sicherlich, fürchtete ich den Eintritt in ein Labyrinth, wo der Anblick eines Turbans schon mich hätte erbeben lassen.
Jussuff kam hinzu und weit entfernt böse darüber zu sein, daß er mich mit der Frau zusammenfand, wünschte er mir Glück zu dem Vergnügen, das es mir machen müßte, mich mit einer Römerin zu unterhalten. Er gratulierte mir dann noch zu dem Vergnügen, daß ich bei dem Tanz mit einer der Schönheiten des Harems des wollüstigen Ismail hatte finden müssen!
„Ist denn das eine so seltene Sache, da man davon spricht?“
„Sehr selten, weil bei uns das Vorurteil besteht, die Schönheiten des Harems nicht den Augen Neidischer auszusetzen; doch jeder kann im eigenen Haus nach Belieben handeln. Ismail ist übrigens ein Ehrenmann und ein kluger Mann.“
„Kennt man die Dame, mit der ich getanzt habe?“
„O, das glaube ich nicht. Ubrigens war sie maskiert, und man weiß, daß Ismail ein halbes Dutzend hat, die alle sehr schön sind.“
Wir verbrachten den Tag heiter, und als ich von ihm schied, ließ ich mich zu Ismail führen. Da man mich hier kannte, ließ man mich eintreten, und ich ging nach dem Ort, den der Zettel mir angezeigt hatte. Als der Eunuch mich sah, kam er mir entgegen und sagte mir, sein Herr wäre ausgegangen; doch würde er sehr erfreut sein, wenn er vernähme, daß ich bei ihm einen Spaziergang gemacht hätte. Ich erklärte ihm, ich wünschte ein Glas Limonade zu trinken, und er führte mich nach dem Kiosk, wo ich die alte Botin erkannte. Der Eunuch ließ mir ein köstliches Getränk reichen und hinderte mich, der Alten ein Silberstück zu geben. Nun gingen wir auf der andern Seite des Teiches spazieren, doch der Eunuch sagte mir, wir müßten umkehren, da er drei Damen, die er mir zeigte, kommen sähe; der Anstand verlange, ihnen auszuweichen. Bald darauf dankte ich ihm für seine Gefälligkeit, trug ihm auf, Ismail meine Komplimente auszurichten, und zog mich zurück, recht zufrieden mit meinem Spaziergang und voller Hoffnung, ein anderes Mal glücklicher zu sein.
Am nächsten Morgen erhielt ich von Ismail ein Billett, worin er mich bat, am Tage darauf mit ihm zum Fischen zu fahren, und mir erklärte, wir würden bis tief in die Nacht hinein bei Mondenschein fischen. Ich hoffte, was ich wünschte, und ging so weit, Ismail zuzutrauen, daß er mich mit meiner schönen Landsmännin bekannt machen wollte. Die Gewißheit, daß er zugegen sein würde, konnte mich nicht abstoßen. Ich bat den Ritter Veniero um die Erlaubnis, eine Nacht außerhalb verbringen zu dürfen, und nur mit vieler Mühe gab er sie mir, denn er fürchtete irgendein Liebesabenteuer und die daraus folgenden Zufälle. Wie man sich wohl denken kann, beruhigte ich ihn so gut wie ich konnte, aber ich setzte ihn trotzdem nicht von allem in Kenntnis; denn Verschwiegenheit schien mir bei diesem Anlaß sehr notwendig.
Zur festgefetzten Stunde fand ich mich pünktlich ein, und Ismail empfing mich mit den herzlichsten Freundschaftsbezeigungen; doch als ich ins Boot stieg, fand ich zu meiner Uberraschung mich mit ihm allein. Er hatte zwei Ruderer und einen Steuermann, und wir fingen einige Fische, die wir in einem Kiosk in Öl braten ließen und aßen. Wir hatten Vollmond, und es war eine jener köstlichen Nächte, von denen man sich keine Vorstellung machen kann, wenn man sie nicht selber gesehen hat. Ganz allein mit Ismail und wohlbekannt mit seiner widernatürlichen Geschmacksrichtung, fühlte ich mich nicht ganz behaglich; denn trotz den Versicherungen des Herrn von Bonneval fürchtete ich, der Türke würde Lust bekommen, mir Beweise einer allzu großen Freundschaft zu geben, und dies Alleinsein beunruhigte mich. Doch es kam eine überraschende Wendung.
„Wir wollen ganz sacht gehen“, sagte er mir, „ich höre ein Geräusch, das mich irgendetwas Amüsantes ahnen läßt.“ Er schickte seine Leute fort, nabm mich dann bei der Hand und sagte zu mir: „Wir wollen in ein Kabinett gehen, zu dem ich glücklicherweise den Schlüssel habe; doch dürfen wir nicht das geringste Geräusch machen. Das Kabinett hat ein Fenster nach dem Teich hinaus, wo, wie ich glaube, zwei oder drei meiner jungen Mädchen in diesem Augenblicke ein Bad nehmen. Wir werden sie sehen und uns eines sehr hübschen Schauspiels erfreuen, denn sie wissen nicht, daß sie gesehen werden. Sie wissen, daß außer mir niemandem dieser Ort zugänglich ist.“ Wir traten ein und sahen bei dem Licht des Mondes, das voll auf die Wasser des Teiches fiel, drei Nymphen, die bald schwimmend bald aufrecht oder auf den Marmorstufen sitzend, sich unsern Augen von allen möglichen Seiten, in allen Stellungen der Anmut und Wollust darboten. Ich muß mir, lieber Leser, die Einzelheiten des Gemäldes ersparen; doch wenn die Natur dir ein feuriges Herz und entzündbare Sinne gegeben hat, mußt du die Verwirrung erraten, die dies einzigartige und entzückende Schauspiel in meinem armen Leibe anrichten mußte.
Einige Tage nach dieser herrlichen Mondscheinpartie mit Fischen und Badenden war ich schon früh zu Jussuff gegangen, und da ein leichter Regen mich an einem Spaziergang im Garten hinderte, trat ich in den Saal, in dem wir speisten, und wo ich bisher niemals einen Menschen gefunden hatte. Sobald ich erschien, stand ein reizendes weibliches Wesen auf und bedeckte sein Gesicht mit einem dichten Schleier, der bis auf den Boden fiel. Eine Sklavin, die am Stickrahmen neben dem Fenster saß, regte sich nicht. Ich entschuldigte mich und tat, als wollte ich gehen; doch sie hielt mich zurück und sagte mir mit lieblicher Stimme, Jussuff, der ausgegangen wäre, hätte ihr befohlen, mich zu unterhalten. Sie lud mich ein, Platz zu nehmen, und deutete auf ein kostbares auf zwei andern größeren liegendes Kissen; ich gehorchte, während sie selbst, die Beine kreuzend, sich auf ein anderes mir gegenüber setzte. Ich glaubte Zelmi vor mir zu haben und dachte mir, Jussuff hätte sich vielleicht entschlossen, mir zu zeigen, daß er ebenso mutig wäre wie Ismail; doch überraschte mich dieser Schritt, der seinen Grundsätzen widersprach, da er die Reinheit meiner Zustimmung zu gefährden drohte, indem er mich verliebt machte. Indes brauchte ich hier keine Furcht zu haben, denn um mich zu entschließen, hätte ich ihr Gesicht sehen müssen.
„Ich glaube“, sagte die schöne Verschleierte, „du weißt nicht, wer ich bin?“
„Ich kann es in der Tat nicht erraten.“
„Ich bin seit fünf Jahren die Gattin deines Freundes und bin in Chios geboren. Ich war dreizehn Jahr alt, als ich seine Frau wurde.“
Ich war sehr überrascht, daß mein philosophischer Muselmann sich so weit über alle Vorurteile hinwegsetzte, mir eine Unterhaltung mit seiner Frau zu gestatten; doch fühlte ich mich ruhiger und glaubte das Abenteuer weiter treiben zu können. Dazu hätte ich indes ihr Gesicht sehen müssen; denn ein bekleideter schöner Körper, dessen Kopf man nicht sieht, kann nur Begierden erwecken, die leicht zu befriedigen sind. Das Feuer der Begierden gleicht dem Strohfeuer; sobald es brennt, hat es auch schon seine größte Höhe erreicht. Ich sah ein reizendes Bild, doch nicht die Seele, denn ein dichter Flor verbarg sie meinen gierigen Blicken. Ich sah Alabasterarme, die die Grazien gerundet hatten, und ihre Hände glichen denen Alcinens, „an denen man weder Muskel noch Ader sah“, und meine tätige Einbildungskraft schuf alles übrige in Harmonie zu diesen schönen Mustern; denn die anmutigen Falten des Musselins ließen den Umrissen ihren ganzen Zauber und verbargen mir nur den lebenden Abriß der Oberfläche: Alles mußte schön sein, doch ich empfand das Bedürfnis in ihren Augen zu lesen, daß alles, was ich mir einbildete, Leben habe und mit Gefühl begabt sei. Die orientalische Tracht ist nur ein schöner über eine Porzellanvase gezogener Firniß, um die Farben der Blumen und Figuren der Berührung zu entziehen, ohne dem Vergnügen der Augen irgendetwas zu nehmen. Jussuffs Frau war nicht als Sultana gekleidet; sie trug das Kostüm von Chios, mit einem Rock, der mich weder hinderte, die Vollkommenheit ihres Beins noch die Rundung ihrer Schenkel und den wollüstig gerundeten Vorsprung ihrer Hüften zu sehen, auf die sich ein schlanker und wohlgebildeter Rumpf stützte, den ein prächtiger silbergestickter und mit Arabesken bedeckter Gürtel umspannte. Über dem allen sah ich zwei Halbkugeln, die Apelles zum Modell für die seiner schönen Venus hätte nehmen können, und ihre lebhafte, doch ungleiche Bewegung zeigte mir, daß diese bezaubernden Hügel belebt seien. Der kleine Raum zwischen ihnen, den ich mit meinen Augen verschlang, schien mir eine Nektarquelle zu sein, nach der meine heißen Lippen mit größerer Gier sich sehnten, als nach dem Göttertrank, um ihren Durst zu stillen.
Entzückt und außer mir, streckte ich mit einer beinah unwillkürlichen Bewegung meinen Arm aus, und meine kühne Hand wollte schon den Schleier heben, da hinderte sie mich daran, indem sie sich leicht auf die Spitzen ihrer schönen Füße erhob und mir mit gebieterischer Stimme und Haltung meine treulose Keckheit vorwarf. „Verdienst du“, sagte sie mir, „Jussuffs Freundschaft, da du die Gastfreundschaft durch eine Beschimpfung seiner Frau verletzest?“
„Sie müssen mir verzeihen, Signora, denn ich hatte nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Nach unseren Sitten kann der niedrigste Mensch seine Augen auf das Gesicht der Königin heften.“
„Ja, aber ihr nicht den Schleier fortreißen, wenn sie mit ihm verhüllt ist. Jussuff wird mich rächen.“
Diese Drohung und der Ton, in dem sie ausgesprochen wurde, erfüllte mich mit Furcht. Ich warf mich ihr zu Füßen und wußte sie schließlich auch zu beruhigen. „Setze dich!“ sagte sie zu mir. Und sie setzte sich selbst, indem sie die Beine mit so großer Nachlässigkeit kreuzte, daß ich Reize erblickte, die mir den Kopf verdreht haben würden, hätte ich sie noch einen einzigen Augenblick länger sehen können. Ich sah nun, daß ich mich ungeschickt benommen hatte, und bereute es, obwohl zu spät. „Bist du entflammt?“ fragte sie mich.
„Wie sollte ich es nicht sein“, antwortete ich ihr, „wenn du mich mit dem heißesten Feuer brennst?“
Klüger geworden ergriff ich ihre Hand, ohne mich mehr um ihr Gesicht zu kümmern. „Da kommt mein Gatte“, rief sie mir zu; und Jussuff trat ein. Wir erhoben uns, Jussuff umarmte mich; ich begrüßte ihn, die stickende Sklavin entfernte sich. Er dankte mir, daß ich seiner Frau Gesellschaft geleistet hatte, und bot ihr seinen Arm, um sie in ihr Gemach zu führen. Sie verließ das Zimmer, doch neben der Tür hob sie ihren Schleier, umarmte ihren Gatten und ließ mich, scheinbar unabsichtlich, ihr schönes Profil sehen. Ich folgte ihr mit den Augen bis zum letzten Zimmer, wo Jussuff sie verließ. Sobald er wieder hei mir war, erklärte er mir lächelnd, seine Frau hätte sich erboten, mit uns zu essen.
„Ich glaubte“, bemerkte ich ihm, „mich Zelmi gegenüber zu befinden.“
„Das hätte unseren guten Sitten zu sehr widersprochen. Was ich tat, hat gar nichts zu sagen. Doch ich kenne keinen anständigen Mann, der kühn genug wäre, seine Tochter den Blicken eines Fremden auszusetzen.“
„Ich glaube, deine Gattin ist schön; ist sie schöner als Zelmi?“
„Die Schönheit meiner Tochter ist lächelnd und sanft, Sophias Schönheit trägt den Charakter des Stolzes. Sie wird nach meinem Tode glücklich sein. Wer sie heiratet, wird sie jungfräulich finden.“
Ich erzählte mein Abenteuer Herrn von Bonneval, indem ich besonders die Gefahr hervorhob, die ich hätte laufen können, als ich den Schleier der schönen Chiotin hob. „Die Griechin“, sagte mir der Graf, „hat sich nur über Sie lustig machen wollen; von Gefahr war keine Rede. Sie war, glauben Sie mir, ärgerlich, daß sie mit einem Neuling zu tun gehabt hat. Sie haben eine französische Posse gespielt, während Sie gerade auf das Ziel hätten losgehen sollen. Wozu brauchten Sie ihre Nase zu sehen? Sie wußte ganz gut, daß sie, wenn Sie die gesehen hätten, nichts dabei gewonnen haben würde. Sie hätten auf das Wesentliche gehen sollen. Wäre ich jung, so würde es mir vielleicht gelingen, Sie zu rächen und meinen Freund Jussuff zu strafen. Sie haben der Schönen einen traurigen Begriff von der italienischen Tüchtigkeit beigebracht. Der sittsamsten Türkin wohnt Schamhaftigkeit nur auf dem Gesicht; sobald sie ihren Schleier vor hat, weiß sie bestimmt, daß sie über nichts erröten wird. Ich bin überzeugt, die Dame trägt ihr Gesicht stets bedeckt, wenn ihr Mann mit ihr kosen will.“
„Sie ist Jungfrau!“
„Das ist schwer zu glauben, lieber Freund; ich kenne die Chiotinnen. Sie besitzen aber die Kunst, den äußeren Anschein der Jungfräulichkeit zu bewahren.“
Jussuff kam nie mehr auf den Gedanken, mir eine ähnliche Höflichkeit erweisen zu wollen, und gewiß hatte er recht.
Einige Tage später war ich bei einem armenischen Kaufmann wo ich einige schöne Waren besah, als Jussuff hinzukam; er lobte meinen Geschmack bei der Auswahl der Sachen, die ich schön fand, aber nicht kaufte, da sie meiner Ansicht nach zu teuer waren. Jussuff dagegen behauptete, die Waren wären nicht teuer, er kaufte sie alle, und wir trennten uns. Am nächsten Morgen sah ich alle Waren bei mir: das war eine Galanterie Jussuffs, und damit ich keine Veranlassung haben konnte, dies Geschenk zurückzuweisen, hatte er einen hübschen Brief hinzugefügt, worin er mir schrieb, bei meiner Ankunft in Korfu würde ich erfahren, wem ich diese Sachen zuzustellen hätte. Es waren mit Gold und Silber durchwebte glänzende Damaststoffe, Börsen, Brieftaschen, Gürtel, Schärpen, Taschentücher und Pfeifen: alles zusammen im Werte von vier- bis fünfhundert Piastern. Als ich ihm danken wollte, nötigte ich ihn zu dem Geständnis, es wäre ein Geschenk der Freundschaft, das er mir machen wollte.
Am Tage vor meiner Abreise brach der wackere Mann in Tränen aus, als er von mir Abschied nahm; doch die, die ich vergoß, waren ebenso aufrichtig und reichlich wie die seinigen. Er sagte mir: dadurch, daß ich sein Anerbieten nicht angenommen, hätte ich seine Achtung so sehr gewonnen, daß er sich nur schwer denken könnte, daß er mich mehr geachtet hätte, wenn ich sein Sohn geworden wäre. Sobald ich auf dem Schiff war, auf dem ich mich mit dem Bailo Giovanni Dona einschiffte, fand ich eine Kiste, die er mir noch zum Geschenk machte, und die zwei Zentner Mokkakaffee bester Güte, hundert Pfund Blättertabak und zwei große Krüge enthielt, von denen der eine mit Zapanditabak, der andere mit Camussade gefüllt war; außerdem noch ein prachtvolles Pfeifenrohr von Jasminholz, mit Goldfiligran verziert, das ich in Korfo um hundert Zechinen verkaufte. Ich konnte dem freigebigen Türken erst von Korfu aus die Versicherung meiner Dankbarkeit geben und versäumte es nicht. Ich verkaufte alle seine Geschenke, was mir ein kleines Vermögen einbrachte.
Ismail gab mir einen Brief für den Ritter von Lezze, doch konnte ich diesen nicht bestellen, da ich ihn verlor. Auch schenkte er mir ein Faß Honigwasser, das ich ebenfalls zu Geld machte. Herr von Bonneval übergab mir einen Brief für den Kardinal von Acquaviva. Ich sandte ihm denselben samt einer Beschreibung meiner Reife, aber Seine Eminenz glaubte nicht mir zur Bestätigung des Empfangs verpflichtet zu sein. Bonneval schenkte mir zwölf Flaschen Ragusaner Malvasiers und zwölf andere echten Scopolos. Es war eine seltene Gabe, die mir in Korfu dazu diente, ein Geschenk zumachen, das mir, wie man später sehen wird, von großem Nutzen wurde.
Der einzige fremde Gesandte, den ich oft in Konstantinopel sah, war der Lord Marishal von Schottland, der berühmte Keith, der für den König von Preußen hier residierte und dessen Bekanntschaft mir sechs Jahre später zu Paris sehr nützlich ward.
Wir segelten anfangs September auf demselben Kriegsschiff ab, das uns nach Konstantinopel gebracht hatte, und kamen nach vierzehn Tagen in Korfu an. Der Bailo Dona blieb an Bord; er führte acht prächtige türkische Pferde mit sich, von denen ich im Jahre 1773 in Görz noch zwei am Leben fand.
Kaum war ich mit meinem Gepäck gelandet und hatte mich ziemlich ärmlich einquartiert, als ich mich Herrn Andrea Dolfin, dem Generalprovveditore, vorstellte, der mir abermals die Versicherung gab, daß ich bei der ersten Truppenbesichtigung Leutnant werden sollte. Von ihm begab ich mich zu meinern Kapitän, Herrn Camporeggio, der mich sehr freundlich empfing. Mein dritter Besuch galt dem Befehlshaber der Galeassen, Herrn D. R., dem Herr Dolfin, mit dem ich von Venedig nach Korfu gekommen war, mich zu empfehlen die Güte gehabt hatte. Nach den ersten üblichen Höflichkeitsformeln fragte er mich, ob ich hei ihm als Adjutant bleiben wollte. Ich antwortete ihm sogleich, daß sein Anerbieten mich ehrte, daß ich es annähme und daß er mich stets zu seinem Befehl finden würde. Ohne weitere Umstände ließ er mich nach dem mir von ihm bestimmten Zimmer führen, und schon am nächsten Tag sah ich mich bei ihm eingerichtet. Ich erhielt von meinem Kapitän einen französischen Soldaten zu meiner Bedienung, und da dieser von Beruf Friseur und außerdem ein großer Schwätzer war, machte er mir viel Vergnügen, denn er konnte mein schönes Haar pflegen, und ich bedurfte der Übung in der französischen Sprache. Mein Soldat war ein Bauer aus der Picardie, ein Taugenichts, Trunkenbold und Wüstling; er konnte kaum seinen Namen kritzeln; doch das machte mir wenig aus, denn es genügte mir, daß er ziemlich gut sprechen konnte. Er war ein unterhaltender Narr; er kannte eine Menge Schwänke und schlüpfrige Geschichten, die er zum Totlachen zu erzählen wußte.
Als ich meine aus Konstantinopel mitgebrachten Sachen verkauft hatte, indem ich nur den Wein zurückbehielt, sah ich mich im Besitz von ungefähr fünfhundert Zechinen. Ich löste von den Juden alles ein, was ich versetzt hatte, und machte es zu Geld, fest entschlossen, nicht mehr als Dummkopf zu spielen, sondern nur mit allen Vorteilen, die ein vorsichtiger junger Mann sich verschaffen kann, ohne daß man seine Ehre antasten könnte.
Hier ist der Ort, meine Leser mit der Lebensweise in Korfu bekannt zu machen. Uber die Örtlichkeiten, die sie aus so vielen Schilderungen anderer kennenlernen können, sage ich nichts.
Eine unumschränkte Regierungsgewalt übte damals in Korfu der Generalprovveditore aus, der in großer Pracht lebte. Das Amt bekleidete zurzeit Herr Dolfin, ein Greis von zweiundsiebzig Jahren, streng, starrköpfig und unwissend. Er kümmerte sich nicht mehr um die Frauen, aber er liebte es noch, wenn sie ihm den Hof machten. Er empfing alle Abend Gesellschaft und hielt offene Tafel für vierundzwanzig Personen.
Drei hohe Offiziere befehligten die leichten Truppen, die besonders zur Besatzung der Galeeren bestimmt sind, und drei andere die Linientruppen, die die Besatzung der großen Kriegsschiffe bildeten. Jede Galeere mußte einen Befehlshaber, den sogenannten sopracomito haben, und es gab deren zehn; jedes Linienschiff stand unter einem Kommandanten, und es gab deren ebenfalls zehn, darin inbegriffen drei Seechefs oder Admirale. Alle diese Herren waren venezianische Edelleute. Zehn andere junge Männer von zwanzig bis zweiundzwanzig Jahren waren ebenfalls venezianische Edelleute und hielten sich auf der Insel auf, um das Seewesen zu studieren. Außerdem waren noch etwa zehn Nobili im Zivildienst, bei der Polizei der Insel oder bei der Justiz beschäftigt. Sie hießen Großoffiziere des Festlandes. Die mit hübschen Frauen Verheirateten genossen das Vergnügen, ihre Häuser häufig von Herren besucht zu sehen, die nach ihrer Gunst strebten. Aber man sah nirgends lebhafte Leidenschaften, vielleicht weil damals in Korfu sich viele Phrynen aufhielten, deren Reize käuflich waren. Die Glücksspiele waren überall erlaubt, und die habgierige Leidenschaft des Spiels mußte den Gefühlen des Herzens großen Eintrag tun.
Unter den Damen zeichnete sich Frau F. am meisten durch Schönheit und Galanterie aus. Ihr Gatte, Kapitän einer Galeere, war das Jahr vorher nach Korfu gekommen, und die Dame hatte alle Admirale in Staunen versetzt. Sie glaubte Herrin ihrer Wahl zu sein und gab Herrn D. R. den Vorzug mit Ausschluß aller Galane, die sich ihr sonst noch boten. Herr F. hatte sie an dem Tage geheiratet, an dem sie, siebzehn Jahre alt, das Kloster verließ, und sich mit ihr am selben Tag auf seiner Galeere eingeschifft.
Ich sah sie zum erstenmal bei Tisch am Tag meiner Einführung und war von ihrem Anblick betroffen. Ich glaubte etwas Übernatürliches zu sehen, etwas über alle mir bis dahin begegneten Frauen so hoch Erhabenes, daß es mir unmöglich vorkam, mich in sie zu verlieben. Sie schien mir von einer ganz anderen Art zu sein als ich und so hoch zu stehen, daß es mir unmöglich vorkam, mich bis zu ihr zu erheben. Ich ging so weit, daß ich mich überredete, zwischen ihr und Herrn D. R. könnte nur eine platonische Freundschaft bestehen, und ich fand, daß Herr F. mit Recht nicht eifersüchtig war. Übrigens war dieser Herr F. ein ausgemachter Dummkopf und gewiß wenig für eine derartige Frau geschaffen. Die erste Auffassung, die ich von Frau F. hatte, war zu kindisch, als daß sie lange hätte anhalten können; sie änderte denn auch bald ihre Natur, und zwar auf eine mir ganz neue Weise.
Meine Eigenschaft als Adjutant verschaffte mir die Ehre, am selben Tisch mit ihr zu essen, doch das war alles. Der andere Adjutant, Fähnrich wie ich und lächerlich dumm, teilte diese Ehre mit; aber wir wurden nicht als Tischgenossen betrachtet, denn niemand sprach mit uns, man gönnte uns nicht einmal einen Blick. Ich hielt das nicht aus. Ich wußte sehr wohl, daß das nicht von einer absichtlichen Geringschätzung herrühre; doch davon ganz abgesehen, fand ich es zu hart. Mein Kamerad Sanzogno, schien mir, konnte sich nicht darüber beklagen, denn er war ein Tölpel, doch ich hatte keine Lust, zu dulden, daß man mich mit ihm auf eine Stufe stellte. Als nach acht oder zehn Tagen Frau F. mich noch immer keines Blickes gewürdigt hatte, begann sie mir zu mißfallen. Ich war betroffen, gereizt und ungeduldig, um so mehr als ich weit entfernt war, zu glauben, es könnte Absicht sein; denn in diesem Fall hätte es mir nicht mißfallen. Ich kam zu der Überzeugung, daß ich in ihren Augen eine Null wäre, und da ich meinen Wert kannte, so nahm ich mir vor, ihr diesen klarzumachen. Endlich bot sich die Gelegenheit, da sie ein Wort an mich richten zu können meinte und mir ins Gesicht sehen mußte.
Herr D. R. bemerkte, daß ich vor mir einen prächtigen Truthahn stehen hatte; er sagte mir, ich möchte ihn zerlegen, und ich tat das sogleich. Ich war aber nicht geschickt darin, und Frau F. lachte über mein linkisches Benehmen und sagte mir, da ich mich nicht mit Ehren aus der Sache ziehen könnte, hätte ich sie nicht übernehmen sollen. Da ich ihr nicht antworten konnte, wie mein Unwille erfordert hätte, setzte ich mich ganz verwirrt nieder und fühlte mein Herz von Haß gegen sie erfüllt. Um das Maß voll zu machen, fragte sie mich eines Tags, als sie meinen Namen nennen wollte, wie ich hieße. Seit vierzehn Tagen schon versah ich nun meinen Dienst bei Herrn D. R., sie sah mich jeden Tag und hätte meinen Namen wissen müssen. Überdies hatte das Glück, das mich beim Spiel begünstigte, meinen Namen schon in Korfu berühmt gemacht. Mein Unwille erreichte den höchsten Grad.
Ich hatte mein Geld einem gewissen Maroli gegeben, Platzmajor und Spieler von Profession, der im Kaffeehause die Pharaobank hielt. Wir spielten auf Halbpart; ich machte seinen Croupier, wenn er abzog, und er leistete mir denselben Dienst, wenn ich die Karten hielt; und das geschah oft, denn man liebte ihn nicht. Er hielt die Karten auf eine Weise, die Angst einflößte, während bei mir das Gegenteil der Fall war und ich viel Glück hatte. Überdies war ich gern gefällig, verlor lächelnd und gewann, ohne Habgier zu zeigen, und das gefällt stets den Mitspielern.
Dieser Maroli war derselbe, der mir während meines ersten Aufenthalts mein ganzes Geld abgewonnen hatte, und da er mich nach meiner Rückkehr von Konstantinopel entschlossen sah, mich nicht mehr von ihm betrügen zu lassen, hielt er mich für würdig, mich an den weisen Grundsätzen teilnehmen zu lassen, ohne die die Glückspiele alle, die sich ihnen überlassen, zugrunde richten. Indessen flößte mir der Herr Offizier nicht allzuviel Vertrauen ein, ich war daher auf meiner Hut. Jede Nacht, wenn das Spiel beendet war, zählten wir, die Schatulle blieb in den Händen des Kassierers, das gewonnene Geld wurde geteilt und jeder nahm seinen Anteil mit.
Glücklich im Spiel, im Genuß einer guten Gesundheit und der Freundschaft meiner Kameraden, die mich bei Gelegenheit stets gefällig und freigebig fanden, hätte ich mit meinem Los zufrieden sein können, wäre ich an der Tafel des Herrn D. R. von seiner schönen Dame mit ein wenig mehr Auszeichnung und mit weniger Stolz behandelt worden; aber sie schien mich ohne Grund von Zeit zu Zeit demütigen zu wollen. Dies verletzte mein Selbstgefühl so sehr, daß ich sie verabscheute, und in dieser Gemütsverfassung fand ich sie um so dümmer, jemehr ich ihre körperlichen Vorzüge bewunderte. Sie hätte sich meines Herzens versichern können, ohne mich lieben zu müssen, denn ich machte keine weiteren Ansprüche; nur wollte ich nicht gezwungen sein, sie zu hassen, und ich sah nicht ein, was sie dadurch, daß sie sich verabscheuenswert machte, gewinnen könnte, während es ihr mit einfachem Wohlwollen so leicht gewesen wäre, sich anbeten zu lassen. Ich konnte ihr Benehmen nicht einem Geist der Koketterie zuschreiben, denn ich hatte ihr nie im geringsten gezeigt, daß ich ihr Gerechtigkeit widerfahren ließ, und ich hatte keinen Grund, ihr Benehmen daraus zu erklären, daß meine Leidenschaft mich in ihren Augen hätte unangenehm machen können; denn Herr D. R. interessierte sie nur wenig, und aus ihrem Manne machte sie sich sehr wenig. Kurz, die reizende Frau machte mich unglücklich, und was mich besonders gegen mich selber aufbrachte, war das Gefühl, daß ich gar nicht an sie gedacht haben würde, wenn ich sie nicht wegen ihres Benehmens gehaßt hätte. Meine Marter vermehrte noch der Umstand, daß ich an mir einen gehässigen Charakter entdeckte, ein Gefühl, das ich bis dahin nicht bei mir geahnt hatte und dessen Entdeckung mich sehr beunruhigte.
Eines Tages überbrachte mir jemand eine Rolle Gold, die er auf Ehrenwort verloren hatte, und als wir vom Tisch aufstanden, fragte sie mich geradezu:
„Was machen Sie mit Ihrem Geld?“
„Ich bewahre es auf, gnädige Frau, um damit Verluste auszugleichen, die ich etwa haben könnte.“
„Aber wenn Sie keine Ausgaben haben, täten Sie besser, gar nicht zu spielen, denn Sie verlieren dabei Ihre Zeit.“
„Die dem Vergnügen gewidmete Zeit ist nie verloren. Verloren ist nur die langweilig verbrachte. Ein junger Mensch, der sich langweilt, setzt sich dem Unglück aus, sich zu verlieben und sich verschmäht zu sehen.“
„Das ist leicht möglich, aber indem Sie nur zum Spaß den Kassierer Ihres Geldes machen, zeigen Sie sich geizig, und ein Geizhals ist nicht achtenswerter als ein Verliebter. Weshalb kaufen Sie sich keine Handschuhe?“
Bei diesen Worten waren, wie man sich wohl denken kann, die Lacher auf ihrer Seite; und das verwirrte mich um so mehr, als ich mir nicht verhehlen konnte, daß sie vollkommen recht hatte; denn es gehörte zu den Pflichten eines Adjutanten, eine Dame bis zu ihrem Wagen zu führen, indem er ihren Arm stützte, und es war nicht schicklich, dies ohne Handschuhe zu tun. Ich war gedemütigt und der Vorwurf des Geizes schnitt mir in die Seele. Tausendmal lieber hätte ich gesehen, wenn sie meinen Fehler einem Mangel an Erziehung zugeschrieben hätte; trotzdem, unerklärlicher Widerspruch des menschlichen Herzens, machte ich meinen Fehler nicht gut, indem ich mir den Luxus gestattete, zu dem meine Lage mich wohl berechtigte. Ich kaufte keine Handschuhe und faßte den Entschluß, sie zu meiden und die alberne und widerwärtige Galanterie Sanzogno zu überlassen, der zwar Handschuhe trug, aber schlechte Zähne hatte, aus dem Munde roch, eine Perücke trug und dessen Gesicht einem verschrumpelten Schafleder glich.
Ich verbrachte meine Tage damit, mich zu martern, und das Lächerlichste an dem Zustande meines Herzens war, daß ich mich unglücklich fühlte, das junge Weib nicht lassen zu können, an dem ich mit gutem Gewissen kein Unrecht finden konnte. Sie haßte mich weder, noch liebte sie mich; das war ganz einfach, doch da sie jung war und gern lachte, war ich ohne Absicht und Bosheit ihr schwarzes Schaf und das Ziel ihrer Neckereien, die meine sehr reizbare Eitelkeit in meinen Augen noch sehr übertrieb. Wie dem auch sei, ich wünschte lebhaft, sie zu strafen und zur Reue zu zwingen. Ich dachte an alle möglichen Mittel, um zu diesem Ziel zu gelangen. Ich wollte zuerst meinen ganzen Geist und meine Börse aufbieten, um ihr Liebe einzuflößen, und mich dann rächen, indem ich sie verachtete. Doch den Augenblick darauf fühlte ich, wie unausführbar der Plan war; denn vorausgesetzt, ich hätte den Weg zu ihrem Herzen finden können, war ich dann der Mann dazu, bei einer Frau wie sie meinen eigenen Erfolgen Widerstand zu leisten; dies durfte ich mir nicht einbilden. Aber ich war ein Schoßkind des Glückes, und plötzlich verwandelte der Zufall meine Lage.
Herr D. R. hatte mich mit Depeschen zum Befehlshaber der Galeassen, Herrn von Condulmer geschickt; ich mußte bis Mitternacht warten und fand Herrn D. R. schon zu Bett, als ich zurückkehrte. Am Morgen, sobald er aufgestanden war, begab ich mich zu ihm, um ihm von meiner Sendung zu berichten. Der Kammerdiener trat einen Augenblick nach mir ein, gab ihm ein Billett und sagte ihm, der Bote von Frau F. warte auf Antwort. Herr D. R. las das Billett, zerriß es und trat es in seiner Erregung mit den Füßen. Nachdem er einen Augenblick im Zimmer auf- und abgegangen war, schrieb er die Antwort und klingelte dem Boten, dem er es übergab. Dann las er mit scheinbar größter Ruhe zu Ende, was ihm der Admiral meldete, und befahl mir, einen Brief zu schreiben. Er las ihn, als der Kammerdiener sagte, Frau F. wünschte mich zu sprechen. Herr D. R. sagte mir, ich könnte zu ihr gehen, da er selbst mir nichts mehr aufzutragen hätte. Ich ging, doch ich war kaum zwanzig Schritte fort, da rief er mich zurück, um mir zu sagen, es wäre meine Pflicht, nichts zu wissen. Ich bat ihn, zu glauben, daß ich mich davon überzeugt hielte. Ich flog zu Frau F., sehr neugierig, zu erfahren, was sie von mir wünschen könnte. Sie ließ mich nicht warten, und ich war sehr überrascht, sie in ihrem Bett sitzend zu finden, das Gesicht lebhaft erregt und die Augen von den Tränen gerötet, die sie augenscheinlich vergossen hatte. Mein Herz schlug heftig, und doch sah ich keinen Grund dazu.
„Nehmen Sie einen Stuhl“, sagte sie zu mir, „denn ich habe mit Ihnen zu sprechen!“
„Gnädige Frau“, entgegnete ich, „ich halte mich dieser Gunst nicht für wert, da ich sie noch durch nichts verdient habe. Ich werde die Ehre haben, Sie stehend anzuhören.“
Sie erinnerte sich vielleicht, daß sie noch nie so höflich gegen mich gewesen war, und wagte nicht weiter in mich zu dringen.
„Mein Gatte“, sagte sie zu mir, nachdem sie sich besonnen hatte, „verlor gestern abend auf Ehrenwort zweihundert Zechinen an Ihrer Bank. Er glaubte, ich hätte dies Geld, das er mir übergeben hatte, und ich muß sie ihm folglich zurückerstatten, denn er muß sie heute zahlen. Unglücklicherweise aber verfugte ich über das Geld und bin nun in großer Verlegenheit. Ich denke, mein Herr, Sie könnten Maroli sagen, daß Sie die verlorene Summe von mir empfangen haben. Hier ist ein wertvoller Ring. Behalten sie ihn. Sie werden ihn mir am Neujahrstage wiedergeben; zu diesem Zeitpunkt werde ich Ihnen die zweihundert Dukaten zurückerstatten, für die ich Ihnen einen Wechsel gebe.“
„Den Wechsel nehme ich an, gnädige Frau, doch des Ringes will ich Sie nicht berauben. Außerdem muß ich Ihnen noch sagen, daß Herr F. diese Summe an die Bank bezahlen oder einen anderen an seiner Stelle dorthin schicken musß. In zehn Minuten werden Sie die Summe, deren Sie bedürfen, in Händen haben.“
Ich gehe, ohne ihre Antwort abzuwarten, und komme einen Augenblick danach mit zwei Rollen von je hundert Dukaten zurück; ich übergebe sie ihr, stecke ihren Wechsel ein und will gehen. Da richtete sie an mich die kostbaren Worte: „Ich glaube, mein Herr, hätte ich gewußt, daß Sie mir gegenüber so dienstwillig sein würden, so hätte ich nicht den Mut gehabt, mich zu entschließen, Sie um diese Gefälligkeit zu bitten.“
„Nun wohl, gnädige Frau, so glauben Sie in Zukunft, daß niemand Ihnen einen unbedeutenden Dienst abzuschlagen fähig wäre, sobald Sie ihn persönlich darum zu bitten die Güte haben würden.“
„Was Sie mir sagen, ist sehr schmeichelhaft, doch ich hoffe, nie wieder in die unangenehme Lage zu kommen, um das zu erproben.“
Ich ging, indem ich über die Feinheit dieser Antwort nachdachte. Sie hatte mir nicht gesagt, daß ich mich täuschte, wie ich erwartete; sie hätte sich dadurch bloßgestellt, denn sie wußte, daß ich bei Herrn D. R. war, als der Bote ihm ihr Billett übergeben hatte, und sie zweifelte nicht, daß ich erraten hatte, sie hätte eine Zurückweisung erfahren. Da sie mir davon nichts sagte, sah ich, daß sie viel auf ihren guten Ruf hielt; ich erbebte darüber vor Freude und fand sie anbetungswert. Ich sah klar, daß sie Herrn D. R. nicht lieben konnte und daß sie von ihm nicht geliebt wurde, und diese Entdeckung war Balsam für mein Herz. Von diesem Augenblick an fühlte ich mich auch für sie entflammt und erkannte die Möglichkeit, sie fur meine Liebe empfänglich zu machen.
Sobald ich zu Hause war, trug ich zuerst Sorge dafür, mit Tinte alle Worte ihres Wechsels, mit Ausnahme ihres Namens, auszustreichen. Dann steckte ich ihn in ein Kuvert und übergab dies einem Notar, indem ich auf dem Empfangsschein, den ich mir darüber geben ließ, bestätigen ließ, daß das versiegelte Billett nur Frau F. selbst übergeben werden sollte, sobald sie es verlangen würde.
Am selben Abend kam Herr F. an meine Bank, bezahlte mich, spielte mit barem Geld und gewann einige fünfzig Dukaten. Auffallend war mir bei diesem Erlebnis, daß Herr D. R. sich wie vordem freundlich gegen Frau F. zeigte und daß auch sie ihr Benehmen gegen ihn nicht änderte. Er fragte mich nicht einmal, was sie von mir gewollt hätte, als sie mich zu sich holen ließ. Doch wenn auch die Dame ihren Ton gegen meinen Vorgesetzten nicht änderte, wurde sie mir gegenüber doch ganz anders, denn sie saß mir nicht mehr bei Tische gegenüber, ohne häufig an mich das Wort zu richten; und das versetzte mich oft in die Notwendigkeit oder gab mir wenigstens die Gelegenheit, mich geltend zu machen, indem ich pikante Geschichten vortrug oder Äußerungen tat, in denen ich Kenntnisse auf scherzhafte Art zu zeigen verstand. Ich besaß damals das große Talent, Gelächter hervorzurufen und dabei selbst ernst zu bleiben. Dies hatte ich von Herrn Malipiero, meinem ersten Lehrer in der Lebenskunst, gelernt.
„Will man jemanden zum Weinen bringen“, hatte mir der weltgewandte Mann gesagt, „so muß man selber weinen; will man aber lachen machen, dann muß man ernsthaft bleiben.“
Bei allem, was ich tat oder sagte, wenn Frau F. zugegen war verfolgte ich nur den einzigen Zweck, ihr zu gefallen; ich sah sie aber nie ohne Grund an und vermied es, ihr die Gewißheit zu geben, daß ich diese Absicht hegte. Ich wollte sie dahin bringen, neugierig zu werden, zu zweifeln, selbst mein Geheimnis zu erraten, ohne daß sie sich aber dessen rühmen konnte. Ich fühlte das Bedürfnis, sachte vorzugehen. In Erwartung von etwas Besserem sah ich mit Vergnügen, daß mein Geld, dieser magische Talisman, und meine gute Aufführung mir eine Beachtung gewannen, die ich weder von meinem Rang noch von meinem Alter, noch von irgendeinem Talente erhoffen konnte, das dem von mir erwählten Stande entsprochen hätte.
Gegen Mitte November bekam mein Soldat eine Brustkrankheit, ich teilte es dem Kapitän der Kompagnie mit, der ihn ins Spital bringen ließ. Am vierten Tage sagte der Kapitän mir, er würde sich nicht erholen, und man hätte ihm die letzte Ölung gegeben; und gegen Abend, als ich bei ihm war, meldete der Priester, der ihm beigestanden hatte, er wäre tot, und übergab ihm ein kleines Paket, das der Verstorbene ihm anvertraut hatte, um es erst nach seinem Tode dem Kapitän auszuhändigen. Das Paket enthielt ein kupfernes Petschaft mit einem Wappen und Herzogsmantel, ein Taufzeugnis und ein Blatt Papier mit französischer Schrift. Kapitän Camporeggio, der nur Italienisch verstand, bat mich die Schrift zu lesen, und ich las folgendes:
„Mein Wille ist, daß dies Papier, das ich mit eigener Hand geschrieben und unterzeichnet habe, meinem Kapitän erst übergeben werden soll, wenn ich nicht mehr bin. Vor dieser Zeit darf mein Beichtvater keinen Gehrauch davon machen; denn ich vertraue ihm dasselbe nur unter dem Beichtsiegel an. Ich bitte meinen Kapitän, mich in einem Gewölbe beerdigen zu lassen, aus dem mein Leichnam gehoben werden kann, wenn mein Vater, der Herzog, es verlangen sollte. Ich bitte auch, dem französischen Gesandten in Venedig mein Geburtszeugnis zu schicken, das Siegel mit dem Wappen meiner Familie und ein beglaubigtes Zeugnis meines Todes, damit alles meinem Vater, dem Herzog, gesandt wird, weil mein Erstgeburtsrecht auf meinen prinzlichen Bruder übergehen muß. Zur Beglaubigung dessen habe ich hier meine Unterschrift beigefügt: François VI. Charles Philippe Louis Foucaud, Prince de la Rochefoucauld.“
Das in Saint-Sulpice ausgestellte Taufzeugnis trug denselben Namen, und der des Herzogs, seines Vaters, war Franz der Fünfte. Der Name seiner Mutter war Gabriele du Plessis.
Als ich dieses sonderbare Schriftstück gelesen hatte, konnte ich mich eines lauten Gelächters nicht enthalten. Da aber mein einfältiger Kapitän meine Heiterkeit unpassend fand und sich beeilte, dem Generalprovveditore Bericht zu erstatten, ging ich ins Kaffeehaus, überzeugt, daß Seine Exzellenz sich über ihn lustig machen und daß ganz Korfu über dies Possenspiel lachen würde.
Ich hatte in Rom beim Kardinal Acquaviva den Abbé de Liancourt kennengelernt, den Urenkel Charles des Fünften, dessen Schwester, Gabrielle du Plessis, die Gemahlin François des Sechsten gewesen war; doch das datierte aus dem Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Ich hatte in dem Sekretariat des Kardinals ein Aktenstück abgeschrieben, dessen der Abbé von Liancourt bedurfte, um am Madrider Hof anerkannt zu werden, und das mehrere Umstände enthielt, die sich aus das Haus du Plessis bezogen. Ich fand auch insofern den sonderbaren Betrug la Valeurs lächerlich und einfältig, da er erst nach seinem Tode bekannt werden und ihm keinen Vorteil bringen konnte.
Eine halbe Stunde später, als ich eben ein Spiel Karten anspackte, trat Adjutant Sanzogno ein und erzählte mit dem ernstesten Gesicht die wichtige Neuigkeit. Er kam vom Generalat, wo Kapitän Camporeggio ganz atemlos angekommen war, um Seiner Erzellenz das Siegel und die Papiere des Toten zu übergeben. Seine Erzellenz hatte sogleich befohlen, den Prinzen in einem Gewölbe beizusetzen und ihm alle seinem Range zukommenden Ehren zu erweisen. Wieder eine halbe Stunde später kam der Adjutant des Generalprovveditore, Herr Minotto, und sagte mir, daß Seine Erzellenz mich rufen ließen. Beim Ende der Tailie übergab ich die Karten dem Major Maroli und begab mich nach dem Generalat. Ich fand Seine Exzellenz mit den vornehmsten Damen und drei oder vier Admiralen sowie Frau F. und Herrn D. R. bei Tisch. „Nun“, sagte der alte General, „Ihr Diener war also ein Prinz?“
„Gnädiger Herr, ich hätte es nie geahnt; selbst jetzt, wo er tot ist, glaube ich es noch nicht.“
„Wie? Er ist tot, und er war doch nicht verrück. Sie haben sein Wappen und seinen Taufschein gesehen, sowie die Schrift von seiner Hand. Wenn man im Sterben liegt, hat man keine Lust mehr, Possen zu treiben.“
„Wenn Eure Erzellenz das alles für wahr halten, ist es meine Pflicht, zu schweigen.“
„Es kann nur wahr sein, und Ihr Zweifel setzt mich in Erstaunen.“
„Er rührt daher, gnädiger Herr, daß ich über die Familie de la Rochesfoucauld sowie über die der du Plessis unterrichtet bin. Überdies habe ich diesen Menschen zu gut gekannt. Er war nicht verrückt, aber ein toller Possenreißer. Ich habe ihn nie schreiben sehen, und zwanzigmal hat er mir erklärt, er hätte es nicht gelernt.“
„Seine Schrift beweist das Gegenteil. Sein Wappen hat den Herzogsmantel. Aber Sie wissen vielleicht nicht, daß Herr von la Rochefoucauld Herzog und Pair von Frankreich ist?“
„Ich bitte um Verzeihung, gnädiger Herr, ich weiß das alles und sogar noch mehr, denn ich weiß, daß Francois der Sechste ein Fräulein von Vivonne zur Gattin hatte.“
„Sie wissen nichts.“
Durch diesen ebenso einfältigen wie unartigen Ausspruch fühlte ich mich zum Schweigen verurteilt; mit Vergnügen sah ich alle anwesenden Herren über die mir widerfahrene vermeintliche Demütigung erfreut.
Ein Offizier sagte, der Verstorbene wäre schön gewesen, hätte ein edles Aussehen gehabt, viel Geist, und hätte sich so zurückhaltend gezeigt, daß niemand hätte ahnen können, wer er war. Eine Dame erklärte, sie würde ihn, hätte sie ihn gekannt, entlarvt haben. Ein anderer Speichellecker, eine gemeine Gattung, die bei den Großen so gewöhnlich ist, sagte, er wäre stets heiter, liebenswürdig, gefällig, durchaus nicht stolz gegen seine Kameraden gewesen und hätte wie ein Engel gesungen. „Er war fünfundzwanzig Jahre alt“, sagte Frau Sagredo, indem sie mich fest ansah, „und wenn er wirklich diese Eigenschaften besessen hat, müssen Sie sie bemerkt haben!“
„Ich kann Ihnen den Menschen nur so schildern, wie ich ihn gesehen habe. Stets lustig, häufig bis zur Tollheit, denn er schoß bewunderungswürdig Purzelbaum, er sang lustige Lieder und brachte eine Menge Geschichten und Geschichtchen von Zauberei, Wundern und Gespenstern vor, tausend wundersame Erzählungen, die den gesunden Verstand verletzten und vor allem dadurch das Gelächter seiner Zuhörer wachriefen. Seine Fehler bestanden darin, daß er ein Trunkenbold, ein schmutziger, ausschweifender und händelsüchtiger Mensch und ein kleiner Betrüger war. Ich litt ihn trotzdem um mich, weil er mir das Haar nach meinem Geschmack machte und mir durch sein Geschwätz Gelegenheit bot, mich in der Umgangssprache zu üben, die man nicht in den Büchern findet. Er sagte mir stets, er sei Pikarde, der Sohn eines Bauern und Deserteur. Ebenso sagte er mir, er könne nicht schreiben, und es ist unmöglich, daß er mich täuschte.“
Als ich eben diese Worte gesprochen hatte, trat Camporeggio hastig ein und meldete, la Valeur atme noch. Der General richtete einen bedeutungsvollen Blick auf mich und sagte, er wäre entzückt, daß er sich erholen könnte.
„Ich auch, gnädiger Herr; doch der Beichtiger wird ihn gewiß diese Nacht sterben lassen.“
„Weshalb sollte er das wohl tun?“
„Um der Galeere zu entgehen, zu der Eure Exzellenz ihn verurteilen würden, weil er das Beichtgeheimnis verletzte.“
Ein lautes Gelächter brach los; der alte Tropf von General aber runzelte die Stirn. Bald darauf trennte sich die Versammlung. Frau F., der ich zu ihrem Wagen vorausgegangen war, während Herr D. R. ihr den Arm bot, forderte mich auf, mit ihr einzusteigen, unter dem Vorwande, daß es regnete. Zum erstenmal erwies sie mir eine so ausgezeichnete Ehre. „Ich denke ebenso wie Sie“, sagte sie mir, „aber Sie haben dem General außerordentlich mißfallen.“
„Das tut mir leid, gnädige Frau, aber dies Unglück war nicht zu vermeiden, denn ich könnte nicht falsch sein.“
„Sie hätten ihm“, sagte Herr D. R. zu mir, „den beißenden Scherz mit dem Beichtvater, der den angeblichen Prinzen sterben lassen wird, wohl ersparen können.“
„Das ist aber wahr; doch ich dachte, er würde lachen, wie ich Eure Exzellenz und die gnädige Frau darüber lachen sah. Man liebt in der Unterhaltung den Geist, der zum Lachen reizt.“
„Aber der Geist, der nicht lacht, liebt ihn nicht.“
„Ich wette hundert Zechinen, daß der Narr gesund wird und, da er den General für sich hat, sich seines Betrugs freuen wird. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie man ihn als Prinzen behandelt und wie er Frau Sagredo den Hof machen wird.“
Bei dieser Bemerkung brach Frau F., die Frau Sagredo nicht liebte, in lautes Gelächter aus, und während wir aus dem Wagen stiegen, lud mich Herr D. R. ein, mit ihnen hinaufzukommen. Er war gewohnt, wenn er mit ihr beim General aß, noch eine halbe Stunde mit ihr unter vier Augen zu bleiben, denn ihr Gatte erschien nie. Zum erstenmal ließ das schöne Paar einen dritten zu. Ich war von dieser Auszeichnung entzückt, und legte ihr den größten Wert bei. Die Genugtuung, die ich empfand, die ich aber zu verbergen wußte, konnte mich nicht hindern, heiter zu sein und allen Äußerungen, die die Dame und der Herr zur Sprache brachten, eine komische Färbung zu geben. Unser angenehmes Trio währte vier Stunden, und wir kehrten erst um zwei Uhr morgens in unseren Palazzo zurück. In dieser Nacht erst machten Frau F. und Herr D. R. meine Bekanntschaft. Frau F. sagte zu dem Herrn, sie hätte noch nie so viel gelacht, noch geglaubt, daß so einfache Äußerungen eine solche Heiterkeit hervorrufen könnten. Ich aber entdeckte an ihr so viel Geist und Munterkeit, daß ich vollends in sie verliebt wurde und mich mit der Überzeugung schlafen legte, daß es mir künftighin unmöglich sein würde, gegen sie den Gleichgültigen zu spielen.
Bei meinem Erwachen am nächsten Tage sagte der neue Soldat, der mich bediente, es stünde um la Valeur besser, und der Arzt hätte erklärt, er wäre außer Gefahr. Man sprach davon bei Tisch, ich sagte aber darüber kein Wort. Am zweiten Tage gab der General Befehl, ihn in ein anständiges Zimmer zu bringen; man gab ihm einen Lakai und gute Kleider; und da der allzu einfältige Generalprovveditore ihm einen Besuch gemacht hatte, hielten alle Admirale es für ihre Pflicht, das gleiche zu tun. Die Neugier mischte sich auch hinein, und es herrschte eine wahre Wut, den neuen Prinzen zu sehen. Herr D. R. folgte dem Strome und, nachdem Frau Sagredo den Anfang gemacht hatte, wollten alle Damen ihn sehen außer Frau F., die mir lachend sagte, sie würde nur dann gehen, wenn ich die Gefälligkeit hätte, sie vorzustellen. Ich bat sie, mich davon entbinden zu wollen. Man gab dem Kerl den Titel Durchlaucht, und der sonderbare Herzog nannte Frau Sagredo seine Prinzessin. Herr D. R. wollte mich überreden, ebenfalls dorthin zu gehen, ich erklärte ihm, ich hätte zu viel gefagt, um die niedrige Gesinnung oder den Mut zu haben, mir zu widersprechen. Der ganze Betrug wäre schnell entdeckt worden, wenn jemand einen königlichen Almanach gehabt hätte, worin die Genealogie aller fürstlichen Familien steht; doch zufällig hatte niemand einen, und der französische Konsul, ein großer Einfaltspinsel, wie man deren viele findet, wußte nicht Bescheid. Der Narr begann acht Tage nach seiner Metamorphose ausgehen. Er aß zu Mittag und Abend an der Tafel des Generals und wohnte alle Abende der Gesellschaft bei, wo er regelmäßig infolge seiner Unmäßigkeit einschlief. Trotzdem hielt man ihn immer noch für einen Prinzen, und zwar aus zwei Gründen: erstens, weil er ohne die mindeste Furcht die Nachrichten aus Venedig erwartete, wohin der Generalprovveditore sogleich nach dem Ereignis geschrieben hatte; zweitens, weil er vom Bischof die Bestrafung des Priesters forderte, der sein Geheimnis verraten hatte, indem er das Beichtsiegel verletzte. Der arme Priester war schon gefangen gesetzt und der General hatte nicht die Kraft, ihn zu verteidigen. Alle Admirale hatten den neuen Herzog zum Mittagessen eingeladen, Herr D. R. aber wagte nicht, sich auch dazu zu entschließen, weil Frau F. ihm deutlich gesagt hatte, sie würde an diesem Tage zu Haus essen. Ich meinerseits hatte ihm in aller Ehrfurcht erklärt, an dem Tage, an dem er ihn einlüde, würde ich mir die Freiheit nehmen, anderswo zu speisen. Eines Tages begegnete ich ihm, als ich aus der alten, an die Esplanade grenzenden Festung trat. Er blieb vor mir stehen und machte mir Vorwürfe, daß ich ihn nicht besucht hätte. Ich lachte und riet ihm, sich aus dem Staube zu machen, ehe die Nachrichten einträfen, die die Wahrheit bekanntmachten, wonach der General gezwungen sein würde, ihm übel mitzuspielen. Ich bot ihm meine Hilfe an, indem ich den Kapitän eines neapolitanischen Schiffes, das unter Segel gehen wollte, bestimmen würde, ihn an Bord zu nehmen und zu verbergen; doch statt mein Anerbieten anzunehmen, das ihn hätte mit Freude erfüllen sollen, sagte mir der Unglückliche die größten Schmähungen.
Der verrückte Mensch machte Frau Sagrebo den Hof, und diese behandelte ihn sehr gut, weil sie stolz darauf war, daß ein französischer Prinz sie allen anderen Damen vorzog.
Eines Tages, als die Dame in großer Gesellschaft bei Herrn D. R. speiste, fragte sie mich, warum ich dem Herrn Herzog geraten hätte, die Flucht zu ergreifen. „Ich habe das von ihm selbst erfahren“, setzte sie hinzu, „und er wundert sich über Ihre Hartnäckigkeit, ihn für einen Betrüger zu halten.“
„Ich gab ihm diesen guten Rat, gnädige Frau, weil ich ein gutes Herz und ein sicheres Urteil habe.“
„Wir sind also alle, selbst der General nicht ausgenommen, Dummköpfe?“
„Diese Folgerung, gnädige Frau, wäre nicht richtig. Eine Meinung, die der eines andern entgegensteht, macht den, der sie hat, noch nicht zu einem Dummkopf; denn es ist möglich, daß ich in zehn Tagen mich von meinem Irrtum überzeuge; doch würde ich mich deshalb nicht für einfältiger halten, als ein anderer ist. Eine Dame von Ihrem Geist kann übrigens wohl bemerkt haben, ob dieser Mensch ein Prinz oder ein Bauer ist; Sie werden ihn nach seinem Benehmen beurteilen und nach der Erziehung, die er erhalten hat. Tanzt er z. B. gut, gnädige Frau?“
„Er kann keinen Schritt machen, doch er lacht darüber; er sagt, er hätte es nicht lernen wollen.“
„Ist er artig bei Tisch?“
„Er hat keine Manieren. Er duldet nicht, daß man seinen Teller wechselt, er fährt mit seinem eigenen Löffel in die Schüssel. Er vermag nicht ein Aufstoßen zu unterdrücken; er gähnt, und wenn er sich bei Tisch langweilt, steht er auf. Offenbar ist er sehr schlecht erzogen!“
„Und trotzdem zweifellos sehr liebenswürdig. Ist er reinlich?“
„Nein, seine Wäsche ist noch nicht gut imstande.“
„Man sagt, er sei nüchtern.“
„Sie scherzen. Zweimal täglich steht er betrunken vom Tisch auf, aber er ist zu beklagen, denn er kann keinen Wein trinken, ohne daß er ihm in den Kopf steigt, er flucht wie ein Husar, und wir lachen darüber, aber er fühlt sich nie durch etwas beleidigt.“
„Hat er Geist?“
„Ein wunderbares Gedächtnis, denn er erzählt uns täglich neue Geschichten.“
„Spricht er von seiner Familie?“
„Viel von seiner Mutter, die er zärtlich liebt. Sie ist eine du Plessis.“
„Wenn sie noch lebt, muß sie ungefähr hundertundfünfzig Jahr alt sein!“
„Welcher Unsinn.“
„Ja gnädige Frau, denn sie wurde zur Zeit der Maria von Medici vermählt.“
„Sein Taufzeugnis nennt sie aber doch; und sein Siegel…“
„Kennt er sein Wappen?“
„Zweifeln Sie daran?“
„Sehr stark; ich glaube vielmehr, er hat keine Ahnung davon.“
Man steht vom Tisch auf, und der Prinz wird gemeldet. Er tritt ein, und Frau Sagredo sagt ihm sogleich: „Mein Prinz, Herr Casa- nova hier sagt, Sie kennen Ihr Wappen nicht.“ Bei diesen Worten tritt er hohnlächelnd auf mich zu, nennt mich einen Feigling und gibt mir eine Ohrfeige, die mich betäubt. Ich gehe langsam zur Tür, nehme meinen Hut und Stock und steige die Treppe hinab, während Herr D. R. laut ruft, man solle den Narren aus dem Fenster werfen.
Ich verlasse den Palast und stelle mich an die Esplanade, um ihn zu erwarten. Sobald ich ihn sehe, gehe ich auf ihn zu und gebe ihm so heftige Schläge, daß ich ihn mit einem einzigen hätte töten können. Er wich zurück und geriet zwischen zwei Mauern, wo ihm nichts anderes übrigblieb, als seinen Degen zu ziehen, wenn er nicht erschlagen werden wollte. Der Feigling dachte aber nicht daran, und ich ließ ihn auf dem Boden ausgestreckt und in seinem Blute schwimmend. Die Menge der Zuschauer bildete eine Gasse, und ich schritt durch sie hindurch nach dem Kaffeehause, wo ich ein Glas Limonade ohne Zucker trank, um den bitteren Speichel zu vertreiben, mit dem der Zorn meinen Mund gefüllt hatte. Im Augenblick sah ich mich von allen jungen Offizieren der Garnison umgeben, die im Chorus zu mir sagten, ich hätte ihn ganz totschlagen sollen. Sie langweilten mich zuletzt; denn wenn ich ihn nicht getötet hatte, war es nicht meine Schuld, und ich hätte es gewiß nicht unterlassen, hätte er seinen Degen gezogen.
Ich war ungefähr eine halbe Stunde im Kaffeehause, als der Adjutant des Generals kam und mir sagte, Seine Exzellenz befehle mir, mich an Bord der Bastarde in Arrest zu begeben. So nennt man eine große Galeere; der Arrest besteht darin, daß man gleich einem Sträfling eine Kette an den Füßen trägt. Die Strafe war zu stark und ich hatte keine Lust, mich ihr zu unterwerfen. „Es ist gut, Herr Adjutant, ich habe gehört.“ Er ging, und einen Augenblick nach ihm entfernte auch ich mich. Als ich aber am Ende der Straße war, schritt ich statt der Esplanade dem Meere zu. Ich gehe am Ufer eine Viertelstunde lang dahin, finde ein leeres Boot mit zwei Rudern, springe hinein, mache es los und rudere auf einen großen Caych zu, der mit sechs andern gegen den Wind kämpfte. Sobald ich ihn erreicht hatte, bat ich den Karabuschiri, mit dem Winde zu segeln und mich an Bord einer großen Fischerbarke zu bringen die in einiger Entfernung zu sehen war und auf den Felsen von Vido zusteuerte. Ich lasse meinen Kahn treiben, bezahle den Caych reichlich und steige in die große Barke; nachdem ich mit dem Patron den Preis abgemacht habe, spannt er drei Segel auf. Nach zwei Stunden sagte er, wir wären noch fünfzehn Meilen von Korfu entfernt. Der Wind legte sich jetzt, und ich ließ ihn gegen die Strömung steuern; gegen Mitternacht aber sagten mir die Seeleute, sie könnten obne Wind nicht fischen und könnten vor Ermüdung nicht weiter. Sie fordern mich auf, bis zum Tage zu schlagen; ich weigerte mich dessen und ließ mich gegen ein kleines Entgelt ans Land setzen, ohne zu fragen, wo wir waren, um in ihnen keinen Verdacht zu erwecken.
Es genügte mir zu wissen, daß ich zwanzig Meilen von Korfu entfernt war und mich an einem Ort befand, wo mich niemand vermuten konnte. Der Mond leuchtete hell, und ich sah eine Kirche, die an ein Haus stieß, eine lange Baracke, die ein Dach hatte und an beiden Seiten offen war, eine kleine Ebene von etwa hundert Stritt Breite, dahinter Berge und nichts weiter. Ich legte mich in der Baracke auf das Stroh, das ich dort fand, und schlief da trotz der Kälte ziemlich gut bis zum Tagesanbruch; es war der erste Dezember, und trotz dem milden Klima war ich beim Erwachen vor Kälte erstarrt, da ich keinen Mantel hatte und nur meine leichte Uniform trug.
Ich höre die Glocken läuten und gehe nach der Kirche. Der Pope mit langem Barte, durch mein Erscheinen überrascht, fragt mich aus griechisch, ob ich Romeo, Grieche, wäre; ich antwortete ihm, ich sei Fragico, Italiener. Er wendet mir den Rücken, geht in sein Haus und schließt sich ein, ohne mich anhören zu wollen.
Ich kehrte nach dem Meer zurück und sah ein Boot von einer Tartane abstoßen, die hundert Schritt von der Insel vor Anker lag. Es kam mit vier Ruderern, um die in ihm befindlichen Personen ans Land zu setzen. Ich ging heran und sah einen Griechen von anständigem Äußeren, eine Frau und einen Knaben von zehn oder zwölf Jahren. Ich redete den Griechen an, indem ich ihn fragte, ob er eine gute Reise gehabt hätte und woher er käme. Er entgegnete mir italienisch, er käme mit seiner Frau und seinem Sohn aus Kephalonien und reiste nach Venedig, vorher jedoch wollte er die Messe bei Unserer Lieben Frau zu Kasopo hören, um zu erfahren, ob sein Schwiegervater noch lebte und ob er ihm die Mitgift seiner Frau auszahlen würde.
„Wie wollen Sie das erfahren?“
„Ich werde es von dem Popen Deldimopulo hören, der mir getreulich das Orakel der heiligen Jungfrau mitteilen wird.“
Ich senke den Kopf und folge ihm in die Kirche. Er spricht mit dem Popen oder Papa und gibt ihm Geld. Der Papa sagt die Messe; er tritt in das Sancta sanctorum, verläßt es eine Viertelstunde später, besteigt den Altar und wendet sich zu uns. Nachdem er sich einen Augenblick gesammelt und seinen langen Bart gestrichen hatte, verkündete er in zehn oder zwölf Worten sein Orakel. Der Grieche aus Kephalonien, der sicher kein Odysseus war, schien sehr zufrieden zu sein, gab dem Betrüger nochmals Geld und verließ ihn. Ich folgte ihm und während des Wegs fragte ich ihn, ob er mit dem Orakel zufrieden wäre.
„O sehr zufrieden. Ich weiß, daß mein Schwiegervater lebt und mir die Mitgift auszahlen wird, wenn ich ihm mein Kind lassen will. Ich weiß, das ist seine Leidenschaft, und ich werde es ihm lassen.“
„Kennt dieser Pope Sie?“
„Er weiß meinen Namen nicht.“
„Haben Sie schöne Waren an Bord?“
„Ziemlich viel. Frühstücken Sie mit mir, und Sie sollen alles sehen.“
„Gern!“
Entzückt, erfahren zu haben, daß es noch Orakel gäbe, und überzeugt, daß es dergleichen immer geben wird, solange sich einfältige Menschen und betrügerische Priester finden, folgte ich diesem guten Mann, der mir an Bord ein sehr gutes Frühstück vorsetzte. Seine Waren bestanden aus Baumwolle, Leinwand, Korinthen, Öl und vortrefflichen Weinen. Er hatte auch Strümpfe, Mützen von Baumwolle, orientalische Überwürfe, Regenschirme und Schiffszwieback, den ich sehr liebte; denn ich hatte damals dreißig Zähne, und schwerlich konnte man schönere als sie sehen. Leider sind mir jetzt nur noch zwei von ihnen geblieben, die andern achtundzwanzig haben sich mit andern ebenso kostbaren Werkzeugen empfohlen; doch: dum vita superest bene est–solange das Leben mir bleibt, ist noch alles gut. Ich kaufte von allem, nur von der Baumwolle nicht, mt der ich nichts anzufangen gewußt hätte, und bezahlte ihm, ohne zu handeln, die fünfunddreißig oder vierzig Zechinen, die er mir abforderte; darauf schenkte er mir sechs Büchsen prächtigen Kaviars.
Da er mich den Wein von Xante, den er Generoydes nannte, hatte rühmen hören, sagte er mir, wenn ich ihn nach Venedig begleiten wollte, würde er mir täglich eine Flasche von ihm geben, selbst während der Quarantäne. Stets ein wenig abergläubisch, war ich auf dem Punkt, aus dem albernsten aller Gründe anzunehmen, nämlich aus dem, daß dieser sonderbare Entschluß durchaus nicht vorüberlegt gewesen wäre, und daß mich möglicherweise mein Schicksal geführt hätte. So war ich damals, und unglücklicherweise bin ich heute anders. Man sagt, das komme daher, daß das Alter den Menschen verständig macht; doch ich bin noch nicht so weit gekommen, um die Wirkung einer abscheulichen Ursache zu preisen.
In dem Augenblick, da ich ihn beim Worte nehmen wollte, bot er mir ein schönes Gewehr für zehn Zechinen an und sagte, in Korfu würde mir jedermann zwölf dafür geben. Das Wort Korfu warf alle meine Gedanken über den Haufen. Ich glaubte, meinen Schutzgeist zu hören, der mich aufforderte, dorthin zurückzukehren. Ich kaufte das Gewehr für den von ihm genannten Preis, und der brave Kephalonier gab mir in Anbetracht meiner Treuherzigkeit noch eine schöne türkische Jagdtasche, wohl mit Pulver und Blei versehen, in den Kauf. Bewaffnet mit meinem Gewehr, in einen guten Überrock gehüllt, alle meine Einkäufe in einem großen Sack mit mir tragend, nahm ich Abschied von dem rechtschaffenen Griechen und ließ mich an der Küste landen, entschlossen, bei dem Schelm von Popen gutwillig oder mit Gewalt ein Quartier zu finden. Die Erregung, in die mich der gute Wein des Griechen versetzt hatte, sollte ihre Frucht tragen. Ich hatte in meinen Taschen vier- oder fünfhundert Kupfermünzen, die mir sehr schwer vorkamen; doch ich hatte sie nur gehen lassen müssen, da ich voraussah, daß ich auf dieser kleinen Insel ihrer bedürfen würde.
Nachdem ich meinen Sack in die Baracke gelegt hatte, ging ich mit dem Gewehr über die Schulter nach dem Hause des Popen; die Kirche war geschlossen.
Ich muß hier meinen Lesern eine Vorstellung von dem geben, was ich in jenem Augenblick war. Ich war in einem Zustand ruhiger Verzweiflung. Drei- oder vierhundert Zechinen, die ich bei mir trug, konnten mir nicht den Gedanken abwehren, daß ich mich durchaus nicht in Sicherheit befände, daß ich hier nicht lange bleiben könnte, daß man mich hier bald entdecken und dann mich wegen meiner Widerspenstigkeit gegen den höchsten Vorgesetzten schlecht behandeln würde. Ich sah mich in die Unmöglichkeit versetzt, einen Entschluß zu fassen, und das genügt, um jede Lage abscheulich zu machen. Es ging nicht an, daß ich freiwillig nach Korfu zurückkehrte; meine Flucht wäre dann eine unüberlegte gewesen und man hätte mich wie einen Narren behandelt; denn meine Rückkehr wäre ein Zeichen von Leichtfertigkeit oder Feigheit gewesen, indes hatte ich nicht den Mut, ganz zu desertieren. Der Hauptgrund dieser moralischen Ohnmacht waren weder tausend Zechinen, die ich bei dem Kassierer hatte, noch meine reiche Ausstattung, noch die Furcht, anderwärts keinen Lebensunterhalt zu finden, es war vielmehr der Gedanke, eine Frau zu verlassen, die ich anbetete und der ich noch nicht einmal die Hand geküßt hatte. In dieser Lage durfte ich mich nur dem Lauf der Ereignisse überlassen, wie sie auch sein mochten, und für den Augenblick war das Wesentliche, Wohnung und Nahrung zu finden.
Ich klopfe an die Tür des Priesters. Er erscheint am Fenster und schließt es wieder, ohne mich anhören zu wollen. Ich klopfe aufs neue, schimpfe, fluche, doch alles umsonst. Wütend ziele ich auf einen armen Hammel, der mit mehreren anderen zwanzig Schritt von mir weidete, und strecke ihn nieder. Der Hirte schreit laut, der Pope springt ans Fenster, schreit „Diebe“ und läßt die Sturmglocke läuten. Ich sehe drei Glocken in Bewegung, erwarte das Hinzuströmen einer Menge. Was wird geschehen? Ich weiß es nicht; doch auf jeden Fall lade ich mein Gewehr wieder und warte.
Kaum waren acht oder zehn Minuten verflossen, als ich von dem Berge eine Menge Bauern, mit Gewehren, Mistgabeln, großen Stöcken bewaffnet, herabkommen sah. Ich zog mich in die Baracke zurück, ohne die geringste Furcht zu empfinden; denn es schien mir nicht natürlich, daß diese Leute, wenn sie mich allein fänden, mich ermorden würden, ohne mich anzuhören.
Die ersten zehn oder zwölf kommen mit angeschlagenen Gewehren näher. Ich halte sie auf, indem ich ihnen meine Kupfermünzen zuwerfe, die sie erstaunt aufzulesen sich beeilen, dasselbe tue ich, sobald andere kommen, bis ich keine Münzen mehr habe und niemanden mehr kommen sehe. Die Tölpel sahen sich wie versteinert an, wußten nicht, was sie von einem jungen Menschen von anständigem Äußern und friedlichem Wesen denken sollten, der ihnen so freigebig sein Geld hinwarf. Sprechen konnte ich mit ihnen erst, als das betäubende Geräusch der Glocken verstummte. Ich setzte mich ruhig auf meinen Sack und hielt mich still; sobald ich sprechen konnte, tat ich es; doch der Pope, sein Küster und der Schäfer unterbrachen mich sofort, zumal da ich Italienisch sprach. Alle drei sprachen zugleich und suchten den Pöbel gegen mich aufzuhetzen.
Einer von den Leuten, in vorgerücktem Alter und von verständigem Ausdruck, nähert sich mir und fragt mich auf italienisch, warum ich den Hammel getötet hätte.
„Um ihn zu essen, nachdem ich ihn bezahlt habe.“
„Aber Seine Heiligkeit kann dafür eine Zechine verlangen.“
Der Pope nimmt die Zechine, geht davon, und die ganze Geschichte ist zu Ende. Der Bauer sagte mir, er hätte in dem Kriege von 1716 gedient und die Verteidigung von Korfu mitgemacht. Ich wünschte ihm dazu Glück und bat ihn, für mich eine Wohnung und einen Diener ausfindig zu machen, der das Essen bereiten könnte. Er erklärte mir, ich könnte ein ganzes Haus bekommen, er selbst würde mir die Küche gut besorgen, doch ich müßte auf den Berg steigen. „Gern!“ Nun ruft er zwei stämmige Burschen, ladet dem einen meinen Sack auf, dem andern meinen Hammel, und wir machen uns auf den Weg. Während des Marsches frug ich ihn: „Guter Mann, ich wünschte wohl in meinem Dienst vierundzwanzig tüchtige Burschen zu haben, die sich der militärischen Disziplin unterwürfen. Ich gebe jedem täglich zwanzig Gazetten und Euch, als meinem Leutnant, vierzig.“
„Ich will Ihnen“, antwortete mir mein Mann, „schon heute eine militärische Wache bilden, mit der Sie zufrieden sein sollen.“ Wir kommen zu einem sehr bequemen Hause, in dem ich im Erdgeschoß drei Zimmer und einen Stall hatte, den ich sogleich in eine Wachtstube umwandelte. Mein Leutnant ließ mich hier, um alles herbeizuschaffen, was ich nötig hatte, und unter anderem auch eine Näherin, um mir Hemden zu machen. Im Laufe des Tages erhielt ich Bett, Möbel, Küchengerät, ein gutes Mittagessen, vierundzwanzig wohlbewaffnete Burschen, eine bejahrte Näherin und einige junge Lehrmädchen, um mir Hemden zu machen. Nach dem Abendessen befand ich mich in der besten Laune von der Welt, umgeben von einigen dreißig Personen, die mich wie ihren Herrscher behandelten, ohne begreifen zu können, was ich auf ihrer kleinen Insel wollte. Das einzig Unangenehme für mich war, daß die jungen Mädchen nicht Italienisch sprachen; und ich verstand zu wenig Griechisch, um mich ihnen verständlich machen zu können. Am nächsten Morgen ließ mein Leutnant die Wache ablösen, und ich konnte mich nicht eines lauten Gelächters enthalten. Meine Truppe war wie eine Herde Hammel; lauter schöne Menschen, wohlgewachsen und kräftig; doch ohne Uniform und Disziplin ist die schönste Truppe nur ein schlechter Haufen. Indes lernten sie das Gewehr präsentieren und den Befehlen ihres Offiziers gehorchen. Ich ließ drei Schildwachen aufstellen, eine in der Wachtstube, die zweite an meiner Tür und die dritte an einem Ort, von wo man die Küste übersehen konnte. Diese letztere sollte uns benachrichtigen, wenn sie eine bewaffnete Barke landen sähe. Während der zwei oder drei ersten Tage betrachtete ich das alles wie ein Spiel; aber ich überlegte, daß es möglich sein könnte, Gewalt mit Gewalt zurückweisen zu müssen, und ich dachte daran, mir den Treueid leisten zu lassen; ich tat es indessen nicht, obgleich mein Leutnant versicherte, es hinge nur von mir ab. Meine Freigebigkeit hatte mir die Liebe aller Inselbewohner gewonnen. Meine Köchin, die mir Näherinnen für meine Hemden besorgt hatte, hoffte zwar, ich würde mich in eine von ihnen verlieben, aber nicht in alle. Doch mein Eifer überstieg ihre Hoffnungen, und die hübschen Mädchen kamen an die Reihe. Alle waren auch mit mir zufrieden, und meine Köchin ward für ihre guten Dienste belohnt. Ich führte ein köstliches Leben, denn mein Tisch war mit saftigen Speisen, mit dem prächtigsten Hammelfleisch und so schönen Schnepfen bestellt, wie ich ähnliche nur noch in Petersburg gefunden habe. Ich trank nur Scopolo und die besten Muskatweine des Archipels. Mein Leutnant war mein einziger Tischgenosse. Ich ging nie ohne ihn und zwei Leute meiner Leibwache spazieren, um mich gegen einige junge Leute verteidigen zu können, die wütend auf mich waren, da sie sich einbildeten, meine Näherinnen, ihre Geliebten, hätten sie meinetwegen verlassen. Auf meinen Spaziergängen dachte ich manchmal daran, daß ich ohne Gold unglücklich gewesen wäre und daß ich diesem Metall meinen gegenwärtigen, genußvollen Zustand verdankte; aber ich dachte auch, daß ich höchst wahrscheinlich Korfu nicht verlassen hätte, wenn meine Börse nicht so gut gespickt gewesen wäre.
Seit acht oder zehn Tagen spielte ich den Zaunkönig, als ich gegen zehn Uhr abends das: Wer da? der ausgestellten Schildwache hörte. Mein Leutnant ging hinaus und kehrte mit der Meldung zurück, ein anständiger Mensch, der Italienisch spräche, wünschte mich in einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen. Ich ließ ihn eintreten, und in Gegenwart meines Leutnants sagte er zu mir auf italienisch:
„Übermorgen am Sonntag wird der Pope Deldimopulo gegen Sie die Cataramonachia schleudern. Wenn Sie ihn nicht daran hindern, führt ein schleichendes Fieber Sie in sechs Wochen in die andere Welt.“
„Ich habe von diesem Trank niemals sprechen hören.“
„Es ist auch kein Trank, fondern ein Fluch, der mit dem heiligen Sakrament in der Hand ausgesprochen wird und diese Macht besitzt.“
„Welchen Grund kann der Priester haben, mich zu ermorden?“
„Sie stören den Frieden und die Ordnung seines Kirchspiels. Sie haben sich mehrerer junger Mädchen bemächtigt, die nun ihre alten Liebhaber nicht mehr heiraten wollen.“
Nachdem ich ihm einen Trunk hatte reichen lassen, dankte ich ihm und wünschte ihm eine gute Nacht. Seine Nachricht erschien mir wichtig; denn wenn ich auch die Cataramonachia nicht fürchtete, an die ich nicht im mindesten glaubte, so konnte ich doch die viel wirksameren Gifte fürchten. Nachdem ich eine sehr ruhige Nacht verbracht hatte, stand ich mit Tagesanbruch auf; ohne meinem Leutnant ein Wort zu sagen, ging ich aus und allein zur Kirche, wo ich den Priester fand, den ich mit der größten Entschlossenheit sagte: „Bei dem ersten Fieberanfall, den ich spüre, schieße ich Ihnen eine Kugel durch das Hirn; richten Sie sich danach! Schleudern Sie gegen mich einen Fluch, der mich in einem Tage tötet, oder machen Sie Ihr Testament. Leben Sie wohl!“
Nach dieser Warnung kehrte ich in meinen Palast zurück. Am Montag ganz früh bemerkte mich der Pope. Ich hatte etwas Kopfschmerz. Er erkundigte sich nach meiner Gesundheit, und als ich ihm sagte, daß mein Kopf schwer wäre, zwang er mich zum Lachen durch die Angst, mit der er mir die Versicherung gab, das könnte nur die Wirkung der schweren Luft der Insel Karsopo sein.
Drei Tage nach diesem Besuch ließ der vorgeschobene Posten den Alarmruf ertönen. Mein Leutnant geht hinaus und kommt wenige Augenblicke später mit der Meldung zurück, eine bewaffnete Schaluppe habe einen Offizier gelandet. Ich gehe hinaus und lasse meine Truppen unter Gewehr treten, dann schreite ich weiter vor und erblicke einen Offizier, der, von einem Führer begleitet, auf meine Wohnung zukommt. Der Offizier war allein, ich hatte nichts zu fürchten. Ich kehre in mein Zimmer zurück und befehle meinem Leutnant, ihn mit allen Kriegsehren zu empfangen und einzuführen. Ich schnalle meinen Degen um und erwarte ihn stehend.
Ich sehe denselben Adjutanten Minotto eintreten, der mir den Befehl überbracht hatte, mich in Arrest zu begeben.
„Sie sind allein“, sagte ich ihm, „und Sie kommen als Freund. Umarmen wir uns!“
„Ich muß wohl als Freund kommen, denn als Feind hätte ich nicht die nötige Macht. Doch was ich hier sehe, erscheint mir wie ein Traum.“
„Setzen Sie sich, und essen wir miteinander. Sie werden eine gute Mahlzeit finden.“
„Gern, und dann wollen wir zusammen aufbrechen!“
„Sie werden ganz allein gehen, wenn Sie wollen; denn ich gehe von hier nur mit der Gewißheit, nicht nur nicht in Arrest zu kommen, sondern auch Genugtuung an dem Narren zu erhalten, den der General auf die Galeeren schicken muß.“
„Seien Sie vernünftig und kommen Sie gutwillig mit mir. Ich habe Befehl, Sie mit Gewalt mitzuführen. Da ich aber dazu nicht in der Lage bin, werde ich meinen Rapport abstatten, und man wird Sie auf eine Weise holen lassen, daß Sie sich ergeben müssen.“
„Nimmermehr. Man wird mich nur tot bekommen.“
„Sie sind also verrückt geworden; denn Sie haben unrecht. Sie waren ungehorsam gegen den Ihnen von mir überbrachten Befehl, sich auf die Bastarde zu begeben. Darin besteht Ihr Unrecht. Denn sonst hätten Sie tausendmal recht, selbst nach Ansicht des Generals.“
„Ich hätte mich also in Arrest begeben sollen?“
„Gewiß, denn die Subordination ist in unserem Stande unerläßlich.“
„Wären Sie an meiner Stelle in Arrest gegangen?“
„Ich will und kann Ihnen nicht sagen, was ich getan hätte. Ich weiß nur, daß ich strafbar gewesen wäre, wenn ich nicht gehorcht hätte.“
„Aber wenn ich mich jetzt ergäbe, so würde man mich als einen Strafbaren viel härter behandeln, als man getan hätte, wenn ich dem ungerechten Befehl folgte.“
„Das glaube ich nicht. Kommen Sie, und Sie werden alles erfahren.“
„Ohne mein Schicksal zu kennen? Erwarten Sie das nicht. Essen wir! Da ich so strafbar bin, daß man Gewalt anwendet, ergebe ich mich nur der Gewalt. Ich werde dadurch nicht strafbarer werden, wenn auch Blut dabei vergossen wird.“
„Sie sind im Irrtum! Sie würden dadurch strafbarer. Doch zu Tisch! Nach einer guten Mahlzeit urteilen wir vielleicht verständiger.“
Gegen Ende der Mahlzeit hörten wir Lärm, und mein Leutnant trat ein, um mir zu melden, daß Haufen von Bauern sich in der Nähe meines Hauses sammelten, um mich zu verteidigen, weil sich auf der Insel ein Gerücht verbreitet hätte, die bewaffnete Feluke wäre gekommen, um mich zu entführen und nach Korfu zu bringen. Ich befahl ihm, die guten Leute aufzuklären und sie heimzuschicken, nachdem er ihnen ein Faß Wein gegeben hatte.
Die Bauern gingen beruhigt von dannen, doch schossen sie zum Zeichen der Ergebenheit ihre Gewehre in die Luft ab. „Das alles sieht ganz hübsch aus“, sagte zu mir der Adjutant, „doch es wird furchtbar werden, wenn Sie mich allein gehen lassen; denn meine Pflicht fordert, daß ich meinen Bericht sehr genau abfasse.“
„Ich will ihnen folgen, wenn Sie mir Ihr Ehrenwort geben, mich in Freiheit ans Land zu setzen, wenn wir in Korfu ankommen.“
„Ich habe Befehl, Sie Herrn Foscari auf der Bastarde zu über- geben.“
„Nun, diesen Befehl werden Sie nicht vollziehen.“
„Wenn der General Sie nicht fügsam findet, verlangt es seine Ehre, Sie zu zwingen, und er wird die Mittel dazu finden. Doch sagen Sie mir, bitte, was würden Sie tun, wenn der General sich entschlösse, Sie hier zu lassen? Doch das wird nicht geschehen, denn nach meinem Bericht wird man sich entschließen, die Sache ohne Blutvergießen zu beendigen.“
„Ohne Blutbad wird die Sache schwerlich abgehen; denn mit fünfhundert Bauern hier fürchte ich dreitausend Mann nicht.“
„Man wird nur einen brauchen, denn man wird Sie als Rebellenführer behandeln. Alle diese Ihnen ergebenen Menschen können Sie nicht gegen den einen schützen, der Sie niederschießt, um einige Goldstücke zu gewinnen. Ich will Ihnen noch mehr sagen, unter all den Griechen, von denen Sie umgeben sind, gibt es nicht einen, der nicht für zwanzig Zechinen bereit wäre, Sie zu ermorden. Glauben Sie mir, kommen Sie mit mir! Kommen Sie, um in Korfu eine Art Triumph zu genießen. Man wird Ihnen dort Beifall zollen und Ihre Person feiern. Sie werden selbst die Torheit erzählen, die Sie begingen; man wird darüber lachen und zur selben Zeit bewundern, daß Sie der Vernunft Gehör gaben, sobald ich sie Ihnen begreiflich machte. Alle Welt achtet Sie und, Herr D. R. hält große Stücke auf Sie. Er lobt besonders den Mut, den Sie zeigten, indem Sie aus Achtung vor seinem Hause nicht dem Unverschämten Ihren Degen durch den Leib stießen. Der General selbst muß Sie achten, denn er muß sich Ihrer Worte erinnern.“
„Was ist denn aus dem Unglücklichen geworden?“
„Vor vier Tagen ist die Fregatte des Majors Sardina mit Depeschen eingelaufen, in denen der General ohne Zweifel die nötigen fand, denn er ließ den falschen Herzog verschwinden. Niemand weiß, wo er ist, und niemand wagt es, in seinem Hause von ihm zu sprechen, denn seine Dummheit war zu groß.“
„Hat man ihn nach meinen Stockschlägen noch in den Gesellschaften empfangen?“
„Pfui! Erinnern Sie sich nicht, daß er einen Degen hatte? Mehr war nicht nötig, um zu veranlassen, daß niemand ihn weiter sehen wollte. Sein Vorderarm war gebrochen und die Kinnlade zerschmettert. Trotzdem, ohne Rücksicht auf seinen kläglichen Zustand, hat ihn Seine Exzellenz acht Tage später verwinden lassen. Das einzige, worüber sich ganz Korfu wundert, ist Ihr Entkommen. Man hat drei Tage lang geglaubt, Herr D. R. hielte Sie bei sich verborgen, und man verurteilte ihn offen; aber er erklärte laut an der Tafel des Generals, daß er nicht im mindesten wüßte, wo Sie wären. Seine Exzellenz selbst war sehr unruhig über Ihr Entkommen, und erst gestern erfuhr man, was aus Ihnen geworden ist, durch einen Brief des hiesigen Popen an den Protopopen Bulgari, in dem er sich beklage, daß ein italienischer Offizier seit acht Tagen dieser Insel sich bemächtigt hätte und hier Gewalttaten verübte. Er klagt Sie an, alle Mädchen zu verführen und ihn bedroht zu haben, ihn niederzuschießen, wenn er Ihnen die Cataramonachia gäbe. Dieser in der Versammlung vorgelesene Brief hat den Generai sehr ergötzt, aber dennoch erteilte er mir den Befehl, Sie mit zwölf Grenadieren zu holen.“
„Frau Sagredo trägt an dem allen die Schuld.“
„Das ist wahr; aber die Sache tut ihr ungeheuer leid. Sie würden gut tun, ihr morgen mit mir einen Besuch zu machen.“
„Morgen? Sie sind also überzeugt, daß ich nicht in Arrest gebracht werde!“
„Ja, denn ich weiß, daß Seine Exzellenz ein Ehrenmann ist.“
„Ich auch. Machen wir also Schluß! Nach Mitternacht wollen wir zusammen aufbrechen.“
„Warum nicht sofort?“
„Weil ich mich nicht der Gefahr aussetzen will, die Nacht auf der Bastarde zu verbringen. Ich will in Korfu am hellen Tag ankommen, und das wird Ihren Triumph noch glänzender machen.“
„Aber was wollen wir während der acht Stunden hier tun.“
„Wir unterhalten uns mit Nymphen einer Art, wie man sie in Korfu nicht findet, und essen dann ein gutes Abendbrot.“
Ich befahl meinem Leutnant, den Soldaten der Feluke Essen bringen zu lassen und uns ein prächtiges Abendbrot zu bereiten, ohne etwas dabei zu sparen, indem ich ihm sagte, ich würde um Mitternacht wegfahren. Dann schenkte ich ihm alle meine Vorräte und ließ alles verladen, was ich mitnehmen wollte. Meine Janitscharen, denen ich eine Wochenlöhnung schenkte, brachten mich bewaffnet bis zur Feluke, worüber mein Kamerad die ganze Nacht lachte. Wir kamen in Korfu um acht Uhr morgens an der Bastarde selbst an, wo er mich ablieferte, nachdem er mir versichert hatte, daß er sofort mein ganzes Gepäck Herrn D.R. schicken und dem General seinen Bericht abstatten würde. Der Kommandant der Galeere, Herr Foscari, empfing mich sehr schlecht. Hätte er nur ein wenig Seelenadel besessen, so hätte er sich nicht so beeilt, mir die Kette anlegen zu lassen. Er hätte es um eine einzige Viertelstunde verschieben können, indem er mit mir sprach, und ich wäre dieser Demütigung entgangen. Er schickte mich ohne ein Wort zu sagen an den Ort, wo der Profos mich niedersetzen und den Fuß vorstrecken ließ, um mir die Kette anzulegen, die in diesem Lande niemand entehrt, leider nicht einmal die Galeerensträflinge, die man besser behandelt als die Soldaten. Ich hatte die Kette am rechten Fuß, und man schnallte den Schuh des linken Fußes auf, um diesen schönen Zierart zu vollenden, als der Adjutant seiner Exzellenz meinem Kerkermeister befahl, mir meinen Degen zurückzugeben und mich in Freiheit zu setzen. Ich wollte dem edlen Gouverneur meine Huldigung darbringen, doch er schämte sich zweifelsohne ein wenig, und der Adjutant sagte mir, Seine Exzellenz entbände mich davon. Ich verbeugte mich vor dem General, ohne ein einziges Wort zu srechen. Er aber sagte mir in ernstem Ton, ich sollte in Zukunft Verständiger sein und lernen, daß die erste Pflicht eines Soldaten Gehorsam, besonders aber Verschwiegenheit und Bescheidenheit wäre. Ich begriff vollständig die Bedeutung dieser beiden Worte und richtete mich danach.
Mein Erscheinen bei Herrn D.R. rief auf allen Gesichtern Freude hervor. Solche schönen Augenblicke sind mir stets so teuer gewesen, daß sie mich die peinlichen Augenblicke vergeben und mich die Veranlassung glücklich schätzen ließen. Es ist unmöglich, ein Vergnügen wahrhaft zu genießen, wenn ihm nicht irgendein peinliches vorausging, und die Gewinne sind nur im Verhältnis zu den Entbehrungen groß, denen man ausgesetzt war. Herr D. R. war so erfreut, mich zu sehen, daß er mir entgegeneilte und mich zärtlich umarmte. Dann zog er einen schönen Ring vom Finger, schenkte ihn mir und sagte, ich hätte sehr wohl daran getan, alle Welt und ihn besonders über den Ort meiner Zuflucht in Unkenntnis zu lassen. „Sie können sich nicht vorstellen“, setzte er edel und frei hinzu, „wie Frau F. sich für Sie interessiert. Sie werden ihr ein großes Vergnügen machen, wenn Sie sogleich zu ihr gehen!“
Welche Freude, diesen Rat von ihm selbst zu empfangen! Doch das Wort „sogleich“ war mir peinlich. Denn da ich die Nacht in der Feluke verbracht hatte, fürchtete ich, die Unordnung meiner Toilette könnte mir in ihren Augen schaden. Ich konnte indes weder ablehnen noch ihm den Grund davon sagen, ich dachte deshalb, mir bei ihr selbst ein Verdienst daraus zu machen. Ich kam an; es war noch nicht Tag bei meiner Göttin, doch ihre Kammerfrau ließ mich eintreten und versicherte mir, ihre Herrin würde gewiß bald klingeln und dann böse sein, mich nicht gesehen zu haben. Während einer halben Stunde, die ich mit der jungen Person, einer reizenden Schwätzerin, zubrachte, erfuhr ich eine Menge Dinge, die mir außerordentliches Vergnügen machten, besonders eine Menge Äußerungen über meine Flucht, und ich zog daraus den Schluß, daß mein Benehmen in dieser ganzen Sache die allgemeine Billigung erhalten hätte. Sobald die gnädige Frau ihre Kammerfrau gesehen hatte, ließ sie mich rufen. Die Vorhänge wurden zurückgezogen, und ich glaubte Aurora, umgeben von den Rosen und Perlen des Morgens, zu sehen. Ich sagte ihr, ohne den Befehl, den Herr D. R. mir gegeben, hätte ich niemals gewagt, in dem Zustande, in dem ich mich befände, mich vor ihr zu zeigen; und im freundlichsten Tone antwortete sie mir, Herr D. R. wüßte, wieviel Teilnahme sie für mich hegte, und hätte deshalb sehr gut getan, mich zu ihr zu schicken; zugleich versicherte sie mir, Herr D. R. schätze mich ebenso wie sie.
„Ich weiß nicht, gnädige Frau, wie ich ein so großes Glück verdienen kann, während ich nur nach Nachsicht strebte.“
„Wir haben alle die Kraft bewundert, die Sie bewiesen, als Sie Narren nicht Ihren Degen durch den Leib bohrten; man hätte zum Fenster hinausgeworfen, wenn er nicht schnell entwischt wäre.“
„Ich hätte ihn, zweifeln Sie daran nicht, getötet, gnädige Frau, wenn Sie nicht zugegen gewesen wären.“
„Das Kompliment ist sehr galant, aber es ist nicht glaublich, daß Sie in jenem Augenblick an mich gedacht haben.“
Bei diesen Worten seufzte ich, schlug die Augen nieder und wendete den Kopf ab. Sie sah meinen Ring; um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, lobte sie Herrn D. R., sobald sie erfahren hatte, wie er mir das Geschenk gemacht hatte. Sie wünschte, daß ich ihr mein Leben auf der Insel erzählen sollte, und ich tat es auch, doch sagte ich wohlweislich von meinen hübschen Näherinnen nichts, denn ich wußte schon damals, daß man im Wandel des Lebens eine große Menge Wahrheiten offiziell vergessen muß.
Sie lachte herzlich über alles, was ich ihr erzählte, und mein Benehmen schien ihr bewundernswert. „Würden Sie wohl“, fragte sie mich, „den Mut haben, dies alles mit denselben Ausdrücken dem Generalprovveditore zu erzählen?“
„Zweifeln Sie nicht daran, gnädige Frau, vorausgesetzt, daß er mich um diese Erzählung bittet.“
„Nun wohl, so halten Sie sich bereit, mir Ihr Wort zu halten. Ich will“, setzte sie hinzu, „daß dieser brave Herr Sie lieben und Ihr vornehmster Beschützer werden soll, um Sie gegen Unrecht zu bewahren. Lassen Sie mich machen!“
Als ich sie verließ, das Herz von ihrem Empfang entzückt, ging ich zu Major Maroli, um mich nach dem Zustand meiner Kasse zu erkundigen, und vernahm mit Vergnügen, daß er mich seit meinem Verschwinden nicht mehr als seinen Teilhaber betrachtet hatte. Er entnahm vierhundert Zechinen der Kasse und behielt mir vor, wieder Teilhaber zu werden, wenn die Umstände mir geeignet erscheinen würden.
Abends machte ich sorgfältig Toilette und suchte den Adjutanten Minotto auf, um mit ihm der Frau Sagredo, der Favoritin des Generals, eine Visite abzustatten. Sie war die hübscheste von den venezianischen Damen auf Korfu, abgesehen von Frau F. Mein Besuch überraschte sie; denn da sie die Ursache alles Vorgefallenen war, erwartete sie ihn keineswegs, glaubte vielmehr, daß ich ihr zürnte. Ich enttäuschte sie, indem ich offen zu ihr sprach; und sie sagte mir die schmeichelhaftesten Dinge und bat mich, manchmal den Abend bei ihr zu verbringen. Auf diese sehr liebenswürdige Einladung antwortete ich mit einer Neigung des Kopfes, ohne zuzusagen oder abzuschlagen. Ich wußte, Frau F. konnte sie nicht leiden; wie hätte ich da ihre Gesellschaften besuchen können. Außerdem liebte die Dame das Spiel, und um ihr zu gefallen, mußte man entweder verlieren oder sie gewinnen lassen. Um sich nun zu einem von beiden zu entschließen, muß man den Gegenstand lieben und Absichten der Eroberung haben. Ich war nicht in dieser Lage. Der Adjutant Minotto spielte nicht, aber er hatte ihre Gunst dadurch erworben, daß er den galanten Merkur bei ihr machte.
Bei meiner Rückkehr ins Hotel fand ich Frau F. ganz allein, Herr D. R. war mit Schreiben beschäftigt. Als ich bei ihr saß, forderte sie mich auf, ihr alles zu erzählen, was mir in Konstantinopel begegnet wäre; ich fand keine Ursache es zu bereuen. Meine Zusammenkunft mit Jussuffs Frau gefiel ihr sehr; aber das nächtliche Bad der drei Nymphen Ismails setzte sie ganz in Flammen. Ich verschleierte die Sache nach Kräften, doch wenn sie mich dunkel fand, mußte ich mich genauer ausdrücken, und wenn ich dann mein Bestes tat und meinen Gemälden einen wollüstigen Reiz zu geben suchte, den ich mehr aus ihren Blicken als aus meiner Erinnerung schöpfte, verfehlte sie nicht, mich zu tadeln, und erklärte, ich hätte weniger deutlich sein können. Ich fühlte, daß die Bahn, auf die sie mich gebracht hatte, sie zu meinen Gunsten stimmen mußte, und ich war überzeugt, daß jemand, der Begierden zu erwecken weiß, leicht dazu verurteilt werden kann, sie zu stillen; das war der Lohn, nach dem ich strebte; ich wagte auf ihn zu hoffen, obgleich ich ihn nur erst in der Ferne sah.
Zufällig hatte Herr D. R. an diesem Tag zum Abendessen große Gesellschaft eingeladen. Ich mußte natürlich die Kosten der Unterhaltung tragen und erzählte mit allen Umständen und den geringsten Einzelheiten alles, was ich getan hatte und was mir begegnet war von dem Augenblick, wo ich den Befehl erhielt, mich in Arrest zu begeben, bis zu meiner Freilassung. Herr Foscari, der Gouverneur der Bastarde, saß an meiner Seite, und der Schluß meiner Erzählung war ihm zweifelsohne nicht sehr angenehm.
Meine Geschichte gefiel übrigens der ganzen Gesellschaft, und es wurde entschieden, der Herr Generalprovveditore müßte das Vergnügen haben, sie aus meinem eigenen Munde zu hören. Da ich gesagt hatte, in Kasopo gäbe es viel Heu, ein Artikel, an dem es in Korfu völlig mangelte, riet mir Herr D. R. diese Gelegenheit zu ergreifen, um mir beim General ein Verdienst zu erwerben, indem ich ihn sofort benachrichtigte. Ich folgte dem Rat schon am nächsten Morgen und ward sehr freundlich angehört; Seine Exzellenz befahl einen Tag, um das Heu zu holen und nach Korfu zu bringen.
Zwei oder drei Tage später saß ich eines Abends im Kaffeehause, als der Adjutant Minotto kam und mir sagte, der General wünsche mich zu sprechen. Man kann sich denken, daß ich diesmal seinem Befehl pünktlich nachkam.