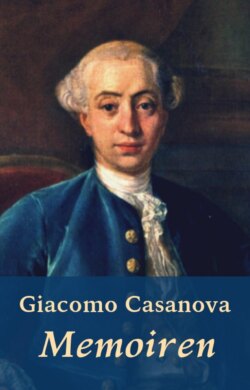Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 19
Vierzehntes Kapitel
ОглавлениеFortsetzung meiner Liebesgeschichte – Fahrt nach Otranto – Ich trete in den Dienst der Frau F. – Glückliche Beinverletzung.
Die Gesellschaft war sehr zahlreich. Ich trete ganz sachte ein, Seine Erzellenz sieht mich; sein Gesicht heitert sich auf, und alle Blicke der ganzen Gesellschaft wenden sich mir zu, als er mit lauter Stimme sagt: „Da haben Sie einen jungen Mann, der sich auf Prinzen versteht.“
„Gnädiger Herr“, sage ich sofort, „ich bin auf diesem Gebiet Kenner geworden, da ich viel mit Ihresgleichen verkehrt habe.“
„Die Damen sind neugierig und möchten alles erfahren, was Sie von Ihrem Verschwinden bis zu Ihrer Rückkehr gemacht haben.“
„Sie verurteilen mich also, gnädiger Herr, zu einer öffentlichen Beichte?“
„Meinetwegen; aber wenn Sie es so auffassen, so hüten Sie sich, auch den geringsten Umstand auszulassen, und tun Sie, als wäre ich nicht anwesend.“
„Im Gegenteil; denn nur von Eurer Erzellenz will ich meine Absolution erwarten. Aber die Geschichte wird lang sein.“
„Jn diesem Falle erlaubt der Beichtvater Ihnen, sich zu setzen.“
Ich erzählte meine Geschichte mit der größten Ausführlichkeit; nur verschwieg ich meine häufigen Zusammenkünfte mit den Nymphen der Inseln.
„Die ganze Geschichte“, sagte der alte Herr zu mir, „ist lehrreich.“
„Ja, gnädiger Herr, denn sie zeigt, daß ein junger Mensch niemals in solcher Gefahr ist, zugrunde zu gehen, als wenn er von einer großen Leidenschaft bewegt wird und die Mittel hat, seinem eigenen Willen zu folgen, weil er eine Börse voll Gold in der Tasche trägt.“
Ich wollte gehen; doch kam der Haushofmeister zu mir und sagte mir, Seine Exzellenz lade mich ein, zum Abendessen zu bleiben. Ich hatte also die Ehre an seinem Tische zu sitzen, nicht aber die, auch zu essen; denn da ich auf tausend Fragen antworten mußte, die man von allen Seiten an mich richtete, so war es mir unmöglich, auch nur einen einzigen Bissen in den Mund zu bekommen. Ich saß neben dem Protopapa Bulgari, und ich bat ihn um Verzeihung, daß ich mich über das Orakel des Papa Deldimopulo ein bißchen lustig gemacht hätte. „Es ist eine Betrügerei“, antwortete er mir; „aber es ist um so schwerer, etwas gegen sie zu machen, da sie den Stempel hohen Alters trägt.“
Beim Nachtisch flüsterte Frau F. dem General etwas ins Ohr, worauf dieser das Wort an mich richtete und mir sagte, er würde gern hören, was mir während meines Aufenthalts in Konstantinopel mit der Frau des Türken Jussuff passiert wäre sowie bei einem anderen Türken, bei dem ich Augenzeuge eines Mondscheinbades gewesen wäre. Sehr überrascht über diese Art von Einladung sagte ich ihm, das seien Possen gewesen, die zu erzählen es sich nicht lohnte; hiermit kam ich durch, denn Seine Exzellenz bestand nicht weiter auf ihrem Wunsch. Auffallend war mir vor allen Dingen die Indiskretion der Frau F., die doch nicht ganz Korfu darin einweihen durfte, was für Geschichten ich ihr unter vier Augen erzählte. Ich bedauerte, daß sie nicht eifersüchtiger auf ihren guten Ruf war, der mir noch mehr am Herzen lag, als ihre Person.
Als ich zwei oder drei Tage später einmal mit ihr allein war, sagte sie mir:
„Warum wollten Sie dem General nicht Ihre Abenteuer von Konstantinopel erzählen?“
„Weil ich nicht alle Welt wissen lassen will, daß Sie mir gestatten, Sie von derartigen Dingen zu unterhalten. Was ich, gnädige Frau, Ihnen unter vier Augen zu erzählen wage, würde ich Ihnen sicherlich nicht in öffentlicher Gesellschaft erzählen.“
„Und warum nicht? Mir scheint im Gegenteil: wenn Sie aus einem Gefühl der Achtung in Gesellschaft schweigen, so müssen Sie es um so mehr tun, wenn ich allein bin.“
„Da ich den Wunsch hatte, Sie zu erheitern, so habe ich mich der Gefahr ausgesetzt, Ihr Mißfallen zu erregen; aber, gnädige Frau, es wird nicht wieder vorkommen.“
„Ich will nicht versuchen, Ihre Absichten zu durchdringen; aber mir scheint, wenn Sie den Wunsch hatten, mir zu gefallen, so durften Sie sich nicht wissentlich der Möglichkeit aussetzen, gerade das Gegengesetzte herbeizuführen. Wir werden beim General zu Abend speisen; denn Herr D. R. ist von diesem beauftragt, Sie mitzubringen; ich bin überzeugt, er wird Ihnen den Wunsch wiederholen, den er Ihnen das letztemal aussprach; und Sie werden nicht umhin können, diesen Wunsch zu erfüllen.“
Bald darauf kam Herr D.R., und wir gingen zusammen zum General. Unterwegs überlegte ich mir, daß ich die letzte Wendung als einen Glücksfall ansehen mußte, obwohl Frau F. allem Anschein nach mich hatte demütigen wollen; denn indem sie mich nötigte, mich zu rechtfertigen, hatte sie mich gewissermaßen zu einer Erklärung gezwungen, die ihr nicht gleichgültig sein konnte.
Der Generalprovveditore nahm mich sehr gut auf und erwies mir die Gnade, mir eigenhändig einen Brief zu überreichen, der in einem Paket, das er am selben Tage aus Konstantinopel erhalten hatte, für mich eingetroffen war. Nachdem ich mit einer tiefen Verbeugung gedankt hatte, steckte ich natürlich den Brief in die Tasche; aber er hielt mich zurück, indem er mir sagte, er sei Liebhaber von Neuigkeiten, und ich könne den Brief lesen. Ich öffnete ihn also; es war ein Brief von Jussuff, der mir den Tod des Grafen Bonneval mitteilte. Als er den Namen des guten Jussuff hörte, bat mich der General, ihm die Geschichte von meiner Unterhaltung mit dessen Frau zu erzählen. Da ich der Einladung nicht ausweichen konnte, so begann ich eine Geschichte, die eine volle Stunde dauerte, Seine Exzellenz sehr amüsierte und die ganze Gesellschaft unterhielt; an dieser Geschichte war aber weiter nichts echt als der Ernst, womit ich sie vortrug; denn sie war von A bis Z von mir erfunden. Auf diese Weise gelang es mir, zu vermeiden, dass ich meinem Freund Jussuff unrecht tat, Frau F. bloßstellte und so mich selber in einem wenig vorteilhaften Lichte zeigte. In Hinsicht des Gefühls machte die von mir erfundene Geschichte mir die größte Ehre, und ich empfand eine wahre Freude, als ich einen Blick auf Frau F. warf, und auf ihren Zügen las, daß sie zufrieden war; immerhin war sie doch ein bißchen verlegen.
Als wir wieder in ihrem Hause waren, sagte sie mir in Gegenwart des Herrn D. R., die von mir erzählte Geschichte sei sehr hübsch, wenn auch nur ein Märchen; sie sei mir darum nicht böse, weil ich sie gut unterhalten hätte; sie könne aber doch nicht umhin, die Hartnäckigkeit zu bemerken, womit ich ihr die von ihr gewünschte Gefälligkeit verweigerte. Hierauf wandte sie sich zu Herrn D. R. und fuhr fort: „Er behauptet, wenn er die Geschichte seiner Unterhaltung mit Jussuffs Frau wahrheitsgetreu erzählt hätte, würde er in der Gesellschaft den Glauben erweckt haben, er unterhalte mich mit unanständigen Geschichten. Ich wünsche, daß Sie darüber Ihr Urteil abgeben. – Wollen Sie, Herr Casanova, die Güte haben, sofort diese Zusammenkunft in denselben Ausdrücken zu schildern, die Sie bei der ersten Erzählung anwandten?“
„Ja, Signora, ich kann es, wenn ich will.“
Ärgerlich über eine Indiskretion, die mir, der ich damals noch kein Kenner des Frauenherzens war, beispiellos zu sein schien, und ohne die geringste Furcht des Mißlingens, stellte ich das Abenteuer als begeisterter Maler dar, das Bild mit allen Farben der Leidenschaft belebend und ohne ein einziges der Gefühle zu verschleiern, die der Anblick der Schönheiten der Griechin in mir erweckt hatte.
„Und Sie finden“, sagte Herr D. R. zu der Dame, „er hätte dies Erlebnis vor der ganzen Gesellschaft so erzählen sollen, wie er’s uns jetzt hier erzählt hat?“
„Wenn er unrecht getan hätte, es öffentlich zu erzählen, so hat er doch auch unrecht getan, es mir unter vier Augen zu erzählen!“
„Das können nur Sie allein wissen! Ja – wenn es Ihnen mißfallen hat. Nein – wenn er Sie amüsiert hat. Mich selber, das will ich offen sagen, hat es sehr amüsiert, aber ich würde mich über ihn geärgert haben, wenn er es in einer zahlreichen Gesellschaft ebenso erzählt hätte, wie hier.“
„Nun, so bitte ich Sie“, sagte Frau F. zu mir, „in Zukunft mir unter uns nur zu erzählen, was Sie in der Öffentlichkeit wiederholen können.“
„Gnädige Frau, ich verspreche Ihnen, mich nach Ihrer Vorschrift zu richten.“
„Wohlverstanden“, rief Herr D. R., „daß die gnädige Frau sich im vollen Umfange das Recht vorbehält, diesen Befehl zu widerrufen, so oft und wann es ihr gut scheint.“
Ich war verletzt, doch wußte ich meinen Verdruß zu verbergen. Einen Augenblick später gingen wir.
Ich begann die reizende Frau gründlich kennenzulernen; aber je tiefer ich in das Geheimnis ihres Charakters eindrang, desto deutlicher sah ich alle Prüfungen voraus, denen sie mich unterwerfen würde. Aber einerlei, meine Liebe trug den Sieg davon; und da mir Hoffnung winkte, so hatte ich den Mut, den Dornen zu trotzen, um die Rose pflücken zu können. Vor allem machte es mir großes Vergnügen, zu sehen, daß Herr D. R. durchaus nicht eifersüchtig auf mich war, obgleich sie selber ihn dazu anzureizen schien. Dies war sehr wichtig.
Als ich einige Tage später sie von diesem und jenem unterhielt, kam das Gespräch auch darauf, daß ich das Pech gehabt hätte, ohne einen Heller Geld das Lazarett von Ancona beziehen zu müssen.
„Trotzdem“, erzählte ich ihr, „verliebte ich mich da in eine junge und schöne griechische Sklavin, um derentwillen ich beinahe die Sanitätsvorschriften verletzt hätte.“
„Wie kam das?“
„Gnädige Frau, Sie sind allein, und ich habe Ihre Befehle nicht vergessen.“
„Es ist also recht unanständig?“
„Nein, aber ich möchte es Ihnen nicht in Gesellschaft erzählen.“
„Nun gut denn!“ rief sie lachend; „ich widerrufe den Befehl, wie Herr D. R. es voraussagte. Sprechen Sie!“
Ich erzählte ihr nun mit allen Einzelheiten und ganz wahrheitsgetreu das ganze Abenteuer; und da ich sah, daß sie nachdenklich wurde, übertrieb ich mein Unglück.
„Was nennen Sie Ihr Unglück? Ich finde die arme Griechin viel beklagenswerter als Sie. Sie haben sie nicht wiedergesehen?“
„O doch, gnädige Frau, aber ich wage nicht es Ihnen zu sagen.“
„Erzählen Sie jetzt zu Ende! Es ist eine Dummheit. Sagen Sie mir alles. Ich bin darauf gefaßt, irgendeinen bösen Streich von Ihnen zu vernehmen.“
„Weit entfernt, gnädige Frau! Es war ein sehr süßer, obgleich unvollständiger Genuß.“
„Erzählen Sie! Aber nennen Sie nicht die Dinge bei ihrem richtigen Namen; das ist das Wesentliche.“
Infolge dieses neuen Befehls erzählte ich ihr, ohne ihr ins Gesicht zu sehen, mein Zusammentreffen mit der Griechin in Gegenwart Bellinos und den unvollendeten Liebesakt, den wir auf eine höhere Eingebung vollzogen bis zum Augenblick, wo die reizende Sklavin bei der Rückkehr ihres Herrn sich meinen Armen entriß. Frau F. sagte nichts, und ich brachte daher die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand; denn wenn ich mich auch ausgezeichnet mit ihr stand, so fühlte ich doch, daß ich Schritt für Schritt vorgehen mußte; so jung sie auch war, so konnte ich doch sicher sein, daß sie niemals eine unwürdige Verbindung eingegangen sein würde, und das Verhältnis, das ich plante, mußte ihr als eine Verbindung unwürdigster Art erscheinen.
Das Glück, das mich in den verzweifeltsten Lagen stets begünstigt hatte, wollte mich auch dieses Mal nicht als böse Stiefmutter behandeln und verschaffte mir an demselben Tage eine Gunst ganz besonderer Art. Meine Schöne brachte sich einen tiefen Schnitt am Finger bei, stieß einen lauten Schrei aus, hielt mir ihre schöne Hand hin und bat mich, ihr das Blut auszusagen. Wie man sich denken kann, ergriff ich schnell eine so schöne Hand; und wenn mein Leser verliebt ist oder es jemals war, so wird er erraten, wie ich mich meiner angenehmen Aufgabe entledigte. Was ist ein Kuß? Ist er nicht der glühende Wunsch, einen Teil des geliebten Wesens in sich einzusaugen? Und das Blut, das ich aus dieser reizenden Wunde sog, was war es anders, als ein Teil des von mir vergötterten Wesens? Als ich fertig war, dankte sie mir zärtlich und sagte mir, ich möchte das ausgesogene Blut ausspucken.
„Es ist hier!“ sagte ich, indem ich die Hand auf mein Herz legte, „und Gott weiß, welchen Genuß es mir bereitet hat.“
„Sie haben mein Blut mit Genuß verschluckt? Sind Sie denn Menschenfresser?“
„Das glaube ich nicht, gnädige Frau, aber ich hätte befürchtet, Sie zu entweihen, wenn ich einen einzigen Tropfen hätte verlorengehen lassen.“
Eines Abends war große Gesellschaft; die Rede kam auf die Freuden des bevorstehenden Karnevals, und man klagte bitter, daß man kein Theater haben würde. Augenblicklich erbot ich mich, auf meine Kosten eine Schauspielertruppe zu besorgen, wenn man sofort alle Logen mieten und mir das ausschließliche Recht die Pharaobank zu halten bewilligen wollte. Es war keine Zeit zu verlieren, denn der Karneval stand vor der Tür, und ich mußte mich nach Otranto begeben. Mein Vorschlag wurde mit Freudenjubel aufgenommen, und der General stellte mir eine Feluke zur Verfügung. In drei Tagen waren alle Logen abonniert, und ein Jude nahm das ganze Parterre, ausgenommen an zwei Tagen der Woche, die ich mir vorbehielt. Der Karneval war in jenem Jahr sehr lang; ich hatte daher gute Aussichten auf Glück. Man behauptet, Theaterunternehmer sein sei ein schwerer Beruf; wenn dies der Fall ist, so habe ich jedenfalls nicht die Erfahrung gemacht und kann für meine Person das Gegenteil behaupten.
Ich fuhr von Korfu mit Einbruch der Nacht ab, und da ein frischer Wind wehte, kam ich in Otranto bei Tagesanbruch an, ohne daß meine Ruderer ihre Ruder eingetaucht hätten. Von Korfu nach Otranto sind nur vierzehn oder fünfzehn Meilen.
Ich konnte nicht daran denken, an Land zu gehen, da in ganz Italien alles, was aus dem Morgenlande kommt, der Quarantäne unterworfen ist; ich ging daher ins Sprechzimmer, wo man hinter einer Schranke mit den Personen sprechen kann, die sich gegenüber hinter einer anderen zwei Klafter entfernten Schranke aufstellen.
Sobald ich bekanntgegeben hatte, daß ich gekommen wäre, um eine Schauspielertruppe für Korfu zu besorgen, erschienen die Direktoren der beiden Truppen, die damals sich in Otranto befanden. Ich sagte ihnen zunächst, ich wollte zuerst alle ihre Mitglieder in voller Bequemlichkeit mir ansehen, und zwar erst die der einen, dann die der anderen Gesellschaft.
Nun gewährten mir die beiden Konkurrenten das Schauspiel eines höchst komischen Auftrittes, indem jeder von ihnen verlangte, daß der andere seine Truppe zuerst zeige. Der Hafenkapitän sagte mir endlich, es stände bei mir, ihrem Streit ein Ende zu machen, indem ich ihnen sagte, welche ich zuerst sehen wollte; die eine war eine neapolitanische, die andere eine sizilianische Truppe. Da ich keine von beiden kannte, so nannte ich die neapolitanische zuerst. Ihr Direktor, Don Fastidio, war ganz traurig darüber, während Battipaglia vor Freude strahlte, indem er hoffte, daß ich nach der Vergleichung seiner Truppe den Vorzug geben würde.
Eine Stunde später sah ich Fastidio mit seiner Truppe ankommen; man denke sich meine Überraschung, als ich Petronio und seine Schwester Marina erkannte. Sobald diese mich bemerkte, stieß sie einen Freudenschrei aus, sprang über die Schranke und stürzte sich in meine Arme. Nun begann ein furchtbarer Spektakel zwischen Don Fastidio und dem Hafenmeister. Da Marina in Fastidios Lohn stand, zwang der Hafenmeister ihn, sie ins Lazarett bringen zu lassen, wo sie auf seine Kosten Quarantäne halten sollte. Die arme Kleine weinte, aber ich konnte ihre Unvorsichtigkeit nicht wieder gutmachen. Schließlich machte ich dem Wortwechsel ein Ende, indem ich Don Fastidio sagte, er möchte mir alle seine Mitglieder eins nach dem anderen vorführen. Zu ihnen gehörte auch Petronio, der die Liebhaberrollen spielte. Er sagte mir, er habe für mich einen Brief von Teresa. Ich sah mit Vergnügen einen Venezianer, den ich kannte und der den Pantalone spielte, drei Schauspielerinnen, die gefallen konnten, einen Pulcinello, einen Scaramuccio; die ganze Truppe schien mir recht leidlich zu sein.
Ich sagte Fastidio, er möchte mir ganz genau sagen, was er für den Tag verlangte; wenn sein Konkurrent mir einen billigeren Preis stellen würde, so würde ich diesem den Apfel reichen. „Herr Offizier“, sagte er, „Sie werden für zwanzig Personen sechs Zimmer mit zehn Betten bereitstellen, dazu einen gemeinsamen Saal, bezahlen alle Reisekosten und täglich dreißig neapolitanische Dukaten. Hier haben Sie mein Repertoire; Sie können jedes beliebige Stück spielen lassen, das Sie bestimmen.“
Ich dachte an die arme Marina, die die ganze Leidenszeit im Lazarett hätte durchmachen müssen, ehe sie wieder auftreten konnte, und sagte zu Fastidio, er möchte den Vertrag bereitmachen, ich wollte sofort abreisen.
Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, so brach zwischen dem vorgezogenen und dem abgewiesenen Direktor offener Krieg aus. Dieser schimpfte im wütenden Ton Marina eine H… und behauptete, sie hätte absichtlich im Einverständnis mit Fastidio die Sanitätsvorschrift verletzt, um mich zu nötigen, ihre Truppe zu nehmen. Petronio ergriff die Partei seiner Schwester und kam Fastidio zu Hilfe; der unglückselige Battipaglia wurde hinausgeworfen und bekam eine Tracht Prügel, die jedenfalls kein besonderer Trost für das entgangene Geschäft war. Eine Viertelstunde später brachte Petronio mir Teresas Brief; sie wurde reich, indem sie den Herzog ruinierte. Sie bewahrte mir immer noch die Treue und erwartete mich in Neapel. Gegen Abend war alles fertig; ich verließ Otranto mit zwanzig Komödianten und sechs großen Kisten, worin die ganze erforderliche Bühnenausrüstung sich befand. Ein leichter Südwind, der bei unserer Abfahrt wehte, hätte mich in zehn Stunden nach Korfu bringen können; aber, nachdem wir eine Stunde gesegelt waren, sagte mir mein Karabuschiri, er sehe im Mondschein ein Schiff kommen, das uns kapern könnte, wenn es ein Seeräuber wäre. Ich wollte nichts wagen, ließ daher umlegen und kehrte nach Otranto zurück. Mit Tagesanbruch gingen wir wieder unter Segel mit einem guten Westwind, der uns ebenfalls nach Korfu gebracht haben würde; aber nachdem wir zwei Stunden lang gefahren waren, sagte mir der Kapitän, er sehe eine Brigantine, die er für einen Korsaren halte, denn sie manöveriere so, als ob sie uns unter den Wind bringen wollte. Ich sagte ihm, er möchte die Richtung ändern und Steuerbord halten, um zu sehen, ob sie uns folgte; sofort machte die Brigantine das gleiche Manöver. Da ich nicht mehr nach Otranto zurück konnte und durchaus keine Lust hatte, nach Afrika zu gehen, sagte ich dem Kapitän, er solle rudern lassen und auf den nächsten Ort der kalabrischen Küste zuhalten. Die Matrosen schlotterten vor Angst an allen Gliedern und teilten ihre Furcht auch meiner komischen Truppe mit; bald herrschte auf dem ganzen Schiff nur Jammer und Wehklagen; jeder empfahl sich irgendeinem Heiligen, aber keinen einzigen von dem Gesindel hörte ich sich Gott empfehlen. Die Grimassen Scaramuccios und das düstere, trostlose Gesicht Fastidios bildeten ein Gemälde, worüber ich herzlich gelacht haben würde, wenn nicht die tatsächlich dringende Gefahr mich daran verhindert hätte. Nur Marina, die von der Größe der Gefahr keine Ahnung hatte, war fröhlich und machte sich über die allgemeine Angst lustig.
Als gegen Abend ein starker Wind sich erhob, befahl ich alle Segel zu setzen und immer geradeaus zu fahren, selbst wenn der Wind noch stärker werden sollte. Ich hatte mich entschlossen, den Golf zu durchqueren, um mich vor den Angriffen des Korsaren in Sicherheit zu bringen. Nachdem ich so die ganze Nacht gesegelt war, beschloß ich, bis Korfu zu rudern; wir waren achtzig Seemeilen entfernt. Das Schiff befand sich mitten im Golf, und am Ende des Tages waren die Matrosen völlig erschöpft; aber ich befürchtete nichts mehr. Plötzlich begann ein Nordwind zu blasen; dieser wurde in weniger als einer Stunde so stark, daß wir mit erschrecklicher Schnelligkeit dahingetrieben wurden. Die Feluke schien jeden Augenblick kentern zu wollen. Entsetzen malte sich auf allen Gesichtern, aber es herrschte tiefes Schweigen, denn dieses hatte ich bei Todesstrafe anbefohlen. Trotz unserer peinlichen Lage mußte ich über die Schluchzer des feigen Scaramuccio lachen. Der Steuermann war ein tüchtiger Matrose, und da der Wind stetig blieb, so fühlte ich, daß wir ohne Unfall ans Ziel kommen würden. In der Morgendämmerung kam denn auch wirklich Korfu in Sicht, und um neun Uhr landeten wir. Man war allgemein erstaunt, uns von dieser Seite her ankommen zu sehen. Sobald meine Truppe ausgeschifft war, kamen natürlich die jungen Offiziere daher, um sich die Künstlerinnen anzusehen; das war in der Ordnung. Sie fanden sie jedoch wenig anmutend, mit Ausnahme Marinas, die, ohne sich zu beklagen, meine Mitteilung entgegennahm, daß ich mich nicht um sie bekümmern könnte. Ich war sicher, daß es ihr nicht an Anbetern fehlen würde. Meine Schauspielerinnen, die am Hafen häßlich ausgesehen hatten, fanden eine andere Beurteilung, als sie auf der Bühne erschienen, und vor allen gefiel die Frau des Pantalone. Als der Linienschiffs-Kapitän Duodo ihr einen Besuch machte und Herrn Pantalone ungefällig fand, gab er ihm einige Stockhiebe. Infolgedessen kam am nächsten Morgen Don Fastidio zu mir und sagte mir, der Schauspieler und seine Frau wollten nicht mehr spielen. Ich schuf Abhilfe, indem ich ihnen eine Vorstellung als besonderes Benefiz für sie bewilligte.
Pantalones Frau fand großen Beifall; sie fand sich aber beleidigt, weil das Parterre zum Zeichen des Beifalls Bravo duodo! rief, und kam, um sich zu beklagen, in die Loge des Generals, wo ich mich für gewöhnlich befand. Um sie zu trösten, versprach ihr der General in meinem Namen eine andere Benefizvorstellung zum Schluß des Karnevals, und wohl oder übel mußte ich mich mit diesem Versprechen einverstanden erklären. Tatsächlich überließ ich, um dies gefräßige Gezücht zufriedenzustellen, ihnen allmählich, eine nach der anderen, die siebzehn Vorstellungen, die ich mir vorbehalten hatte. Marina bewilligte ich eine auf Wunsch der Frau F., die sich für die Künstlerin interessierte, seitdem diese die Ehre gehabt hatte, mit Herrn D. R. unter vier Augen in einem Landhäuschen vor der Stadt zu frühstücken.
Diese Großmut kostete mir mehr als vierhundert Zechinen; aber die Bank brachte mir mehr als tausend ein, obgleich ich nie selber abzog, da die Theaterangelegenheiten mir keine Zeit dazu ließen. Viel Ehre machte es mir, daß ich, wie man klar und deutlich sah, keinerlei Liebesverhältnis mit den Schauspielerinnen unterhielt, was mir doch so leicht gewesen wäre. Frau F. machte mir ein Kompliment darüber, indem sie mir sagte, sie habe mich nicht für so vernünftig gehalten. Ich war während des ganzen Karnevals so beschäftigt, daß ich nicht an Liebe denken konnte, nicht einmal an die, die mir so sehr am Herzen lag. Erst nach Beginn der Fastenzeit und nach der Abreise der Schauspieler konnte ich mich meiner Leidenschaft ganz und gar hingeben.
Eines Morgens kam zu mir ein Bote von Frau F. und sagte mir, sie wünsche mich zu sprechen. Es war elf Uhr; ich begab mich unverzüglich zu ihr und fragte sie, worin ich ihr angenehm sein könnte.
„Ich habe Sie kommen lassen“, sagte sie mir, „um Ihnen die zweihundert Zechinen wiederzugeben, die Sie mir in so vornehmer Weise geliehen haben. Hier sind sie; wollen Sie mir, bitte, meinen Schuldschein wiedergeben.“
„Ihr Schein, gnädige Frau, ist nicht mehr in meinen Händen. Er ist unter wohlversiegeltem Umschlag bei Herrn Notar N. N. niedergelegt, der ihn laut dieser Quittung nur Ihnen selber ausliefern darf.“
„Warum haben Sie ihn nicht bei sich behalten?“
„Ich hatte Furcht, er könnte mir gestohlen werden oder sonstwie verlorengehen. Ich hätte sterben können, und ich wollte nicht, daß der Schein in andere Hände fiele, als in die Ihrigen.“
„Ihr Vorgehen ist sicherlich zartfühlend; aber mir scheint, Sie hätten sich das Recht vorbehalten müssen, selbst den Schein zurückziehen zu können.“
„Ich habe nicht die Möglichkeit vorausgesehen, ihn zurückzuziehen.“
„Diese Möglichkeit hätte jedoch leicht eintreten können. Ich kann also dem Notar sagen lassen, er möge mir den Umschlag schicken?“
„Ohne Zweifel, gnädige Frau; und Sie allein können es tun.“
Sie schickte zum Notar, und dieser überbrachte ihr den Brief.
Sie riß den Umschlag auf und fand nur ein geschwärztes, unleserliches Papier; nur ihren Namen hatte ich stehen lassen.
„Dies zeugt“, sagte sie mir, „für eine ebenso vornehme wie zartfühlende Handlungsweise. Aber gestehen Sie, ich kann nicht sicher sein, daß dieser Fetzen Papier wirklich mein Schein ist, obgleich ich meinen Namen darauf sehe.“
„Das ist wahr, gnädige Frau, und wenn Sie dessen nicht sicher sind, so habe ich sehr unrecht getan.“
„Ich bin dessen sicher, weil ich es sein muß; aber Sie werden mir zugeben, daß ich nicht darauf schwören könnte.“
„Ich gebe es zu.“
An den folgenden Tagen kam es nur vor, als habe sie ihr Benehmen gegen mich vollständig geändert. Sie empfing mich nicht mehr im Morgenkleide, und ich mußte mich langweilen und warten, bis ihre Zofe sie angekleidet hatte; erst dann wurde ich in ihr Zimmer eingelassen.
Wenn ich irgend etwas erzählte, tat sie, als verstände sie mich nicht oder als könnte sie den Witz eines Wortspieles oder einer Anekdote nicht entdecken; oft sogar sah sie mich nicht einmal an, und dann erzählte ich schlecht. Wenn Herr D.R. über etwas lachte, was ich erzählt hatte, so fragte sie ihn, warum er lache; und wenn er ihr meine Geschichte wiederholte, fand sie sie flach oder abgeschmackt. Wenn sich eines ihrer Armbänder abgelöst hatte, erbot ich mich natürlich, es wieder zu befestigen; aber dann hieß es entweder, sie wolle mir nicht die Mühe machen, oder ich kenne den Mechanismus der Feder nicht, und so mußte ihre Zofe es machen. Meine Verdrießlichkeit wurde allmählich sichtbar; aber sie tat, als merkte sie es nicht. Wenn Herr D. R. mich aufforderte, etwas Nettes zu sagen, und ich nicht sofort sprach, dann sagte sie, ich wäre wohl auf dem Grund meines Sackes angelangt und jetzt völlig ausgepumpt. Voll Verdruß gab ich dies zu, denn da ich nun einmal ihren Beifall nicht finden konnte, so schwieg ich lieber; aber meine Leidenschaft verzehrte mich; denn ich wußte nicht, welchem Umstand ich diese Veränderung, diesen Stimmungswechsel zuschreiben sollte, da mir schien, ich selber hätte nicht den geringsten Anlaß dazu gegeben. Ich wollte den Entschluß fassen, ihr offen meine Mißachtung kundzugeben; aber wenn die Gelegenheit dazu sich bot, hatte ich nicht den Mut.
Als eines Abends Herr D. R. mich fragte, ob ich oft verliebt gewesen sei, antwortete ich ihm: „Dreimal, gnädiger Herr.“
„Und immer glücklich, nicht wahr?“
„Immer unglücklich. Das erstemal vielleicht, weil ich als Abbate mich nicht zu entdecken wagte. Das zweitemal, weil ein furchtbares, unvorhergesehenes Ereignis mich zwang, in demselben Augenblick, wo meine Wünsche sich erfüllen sollten, mich von dem geliebten Wesen zu entfernen. Das drittemal, weil die Dame, für die ich entbrannt war, Mitleid mit mir fühlte und daher Lust bekam, mich von meiner Leidenschaft zu heilen, anstatt mich glücklich zu machen.“
„Und welches Heilmittel hat sie zu diesem Zweck benutzt?“
„Sie ist nicht mehr liebenswürdig gewesen.“
„Ich verstehe; sie hat Sie mißhandelt, und das nennen Sie Mitleid? Sie irren sich.“
„Sicherlich“, sagte die gnädige Frau, „hat man Mitleid mit einem, den man lieb hat, und man will ihn nicht heilen, indem man ihn unglücklich macht. Diese Frau hat Sie niemals geliebt.“
„Das will ich nicht glauben, gnädige Frau.“
„Aher sind Sie geheilt?“
„Vollkommen; denn wenn ich zufällig einmal an sie denke, finde ich mich kalt und gleichgültig; aber bis zur Genesung hat es lange gedauert.“
„Ich denke mir, es hat so lange gedauert, bis Sie in eine andere verliebt geworden sind?“
„In eine andere, gnädige Frau? Ich glaubte, Ihnen gesagt zu haben, daß meine dritte die letzte war.“
Einige Tage später sagte Herr D. R. zu mir, Frau F. sei unwohl; er könne ihr nicht Gesellschaft leisten, aber ich müsse hingehen; er sei überzeugt, es werde ihr viel Vergnügen machen. Ich gehorchte und wiederholte der Frau F., die auf ihrem Sofa lag, Wort für Wort das Kompliment des Herrn D. R.; sie antwortete mir, ohne mich anzusehen, sie glaubte, sie hätte Fieber und lüde mich darum nicht zum Bleiben ein; denn sie wäre überzeugt, daß ich mich weilen würde.
„In Ihrer Gegenwart, gnädige Frau, kann ich mich nicht weilen; übrigens kann ich nur gehen, wenn Sie mir den strengen Befehl geben, und in diesem Fall werde ich vier Stunden in Ihrem Vorzimmer verbringen, denn Herr D. R. hat mir gesagt, ich möchte ihn hier erwarten.“
„Dann setzen Sie sich also, wenn Sie wollen.“
Ein so schroffer Ausdruck empörte mich; aber ich liebte sie, und ich hatte sie niemals so schön gesehen, denn ihr Unwohlsein belebte ihre Gesichtsfarbe auf eine Art, daß sie wirklich blendend aussah. Ich blieb eine Viertelstunde lang stumm und unbeweglich wie ein Standbild; dann klingelte sie ihrer Kammerzofe und bat mich, sie einen Augenblick allein zu lassen. Wenige Minuten später ließ sie mich wieder eintreten und fragte mich: „Was ist denn aus Ihrer lustigen Laune geworden?“
„Wenn meine lustige Laune verschwunden ist, gnädige Frau, so kann dies nur auf Ihren Befehl geschehen sein. Rufen Sie sie zurück, und Sie werden sie in ihrer ganzen Stärke wieder vor Ihnen erscheinen sehen.“
„Was muß ich tun, um sie wieder zurückzurufen?“
„Seien Sie gegen mich so, wie Sie waren, als ich von Kasopo zurückkam. Seit vier Monaten mißfalle ich Ihnen; und da ich nicht wissen kann weshalb, so betrübt mich dieses tief.“
„Ich bin immer die gleiche. In welcher Hinsicht finden Sie mich denn verändert?“
„Gütiger Himmel! In allem, ausgenommen in Ihrer Persönlichkeit. Aber ich habe meinen Entschluß gefaßt.“
„Und wie lautet dieser?“
„Ich will schweigend bleiben. Niemals kann etwas die Gefühle vermindern, die Sie mir eingeflößt haben; stets wird mich der Wunsch erfüllen, Sie von einer vollkommenen Ergebenheit zu überzeugen; stets werde ich bemüht sein, Ihnen neue Beweise meines Eifers zu geben“
„Ich dake Ihnen; aher ich weiß nicht, was Sie meinetwegen schweigend zu leiden haben können. Ich habe Teilnahme für Sie und höre Ihre Abenteuer stets mit Vergnügen. So zum Beispiel bin ich sehr neugierig, Sie von Ihren drei Liebschaften erzählen zu hören.“
Ich erfand sofort drei Geschichtchen, worin viel von Gefühl und idealer Liebe die Rede war; doch streifte ich niemals sinnlichen Genuß, besonders wenn ich zu merken glaubte, daß sie etwas Derartiges erwartete. Ich sah leicht, daß ihre Phantasie weiter ging als meine Erzählung, und ich bemerkte auch, daß meine Zurückhaltung ihr gefiel. Ich glaubte sie gut genug zu kennen, um zu wissen, daß dies das beste Mittel wäre, sie zum erwünschten Ziel zu führen. Sie machte eine Bemerkung, die mich empfindlich traf; doch hütete ich mich, etwas davon merken zu lassen. Es handelte sich um diejenige von den dreien, die es aus Mitleid unternommen hatte, mich von meiner Liebe heilen zu wollen. „Wenn sie Sie wirklich liebte“, sagte sie, „so ist es wohl möglich, daß sie nicht Sie, sondern sich selber hat heilen wollen.“
Am Tage nach dieser Art von Aussöhnung bat ihr Gatte, Herr F., meinen General D. R., mich auf drei Tage nach Butintro auf eine Expedition gehen zu lassen, da sein Adjutant schwer erkrankt war.
Butintro liegt in einer Entfernung von sieben Seemeilen Korfu gegenüber. Es ist der nächstgelegene Ort des Festlandes, kein Fort, sondern ein gewöhnliches Dorf in Epirus, dem heutigen Albanien; es gehört den Venezianern.
In Befolgung des politischen Grundsatzes, daß vernachlässigtes Recht verlorenes Recht ist, schicken die Venezianer alljährlich vier Galeeren mit Sträflingen dorthin, um Holz zu fällen und auf die Schiffe zu verladen; sie sind begleitet von Truppen, um die Arbeiter zu überwachen, die ohne diese Vorsichtsmaßregel desertieren könnten, um Türken zu werden. Da die eine der vier Galeeren von Herrn F. bemannt wurde, brauchte er einen Adjutanten, und seine Wahl fiel auf mich.
Wir fuhren ab und brachten am vierten Tage einen großen Holzvorrat nach Korfu. Es war am Karfreitag. Ich ging in die Wohnung des Herrn D. R., den ich allein auf der Terrasse fand. Er war nachdenklich, und nach kurzem Schweigen hielt er an mich folgende Ansprache, die ich niemals vergessen werde:
„Herr F., dessen Adjutant gestern gestorben ist, hat mich soeben gebeten, Sie ihm abzutreten, bis er sich einen anderen habe verschaffen können. Ich habe ihm geantwortet, ich glaube nicht das Recht zu haben, über Sie verfügen zu können, und er müßte sich an Sie selber wenden; doch versichere ich Ihnen, wenn Sie mich um Erlaubnis bäten, so würde ich keine Schwierigkeiten machen, obwohl ich zwei Adjutanten brauche. Er hat Ihnen seit Ihrer Rückkehr nichts gesagt?“
„Nichts, gnädiger Herr; er hat mir gedankt, daß ich auf seiner Galeere nach Butintro gefahren bin – sonst nichts.“
„Ohne Zweifel wird er mit Ihnen darüber sprechen; was werden Sie ihm sagen?“
„Selbstverständlich werde ich ihm sagen, daß ich niemals Eure Exzellenz verlassen werde ohne Ihren ausdrücklichen Befehl.“
„Sicherlich werde ich Ihnen diesen Befehl niemals geben.“ In dem Augenblick, wo Herr D. R. diese Worte aussprach, traten Herr und Frau F. ein. Da ich wußte, wovon wahrscheinlich die Rede sein würde, ging ich schnell hinaus. Eine Viertelstunde darauf wurde ich hineingerufen, und Herr F. sagte mir in herzlichem Ton: „Nicht wahr, Herr Casanova, Sie würden gerne als Adjutant bei mir sein?“
„Seine Exzellenz gibt mir also meinen Abschied?“
„Durchaus nicht“, sagte Herr D. R., „aber ich lasse Ihnen freie Wahl.“
„Gnädiger Herr, es ist mir unmöglich, undankbar zu sein.“
Verwirrt, mit gesenkten Augen stand ich da; ich suchte nicht meine Betroffenheit zu verbergen, die nur eine Wirkung meiner Lage sein konnte. Ich fürchtete die Blicke der Frau F., denen ich um alles Gold der Welt nicht hätte begegnen mögen, umso mehr da ich wußte, daß sie alles erraten konnte, was in mir vorging. Einen Augenblick darauf machte ihr Mann in kaltem Tone die dumme Bemerkung, ich würde allerdings bei ihm einen viel anstrengenderen Dienst haben als bei Herrn D. R.; außerdem wäre es eine größere Ehre, dem Gouverneur der Galeeren zu dienen, als einem einfachen Sopracomito. Ich wollte antworten, da ergriff die gnädige Frau das Wort und sagte mit liebenswürdiger Stimme und mit ganz unbefangener Miene: „Herr Casanova hat recht.“ Hierauf wurde von anderen Dingen gesprochen, und ich ging hinaus, um über das Vorgefallene nachzudenken.
Schließlich gelangte ich zu dem Ergebnis, Herr F. könnte mich nur auf Antrieb seiner Frau von Herrn D. R. verlangt haben, oder mindestens mit ihrer Zustimmung. Dies schmeichelte zugleich meiner Liebe und meinem Selbstgefühl. Indessen war meine Ehre dabei im Spiel, diesen Stellenwechsel nicht anzunehmen, wenn ich nicht die bestimmte Gewißheit hätte, daß es meinem gegenwärtigen Chef angenehm sein würde. Ich werde annehmen, sagte ich bei mir selber, sobald Herr D. R. mir geradezu sagt, daß ich ihm mit der Annahme ein Vergnügen mache. Hierfür hat Herr F. zu sorgen.
Am selben Abend hatte ich die Ehre bei der Karfreitagsprozession, der der ganze Adel zu Fuß folgt, Frau F. den Arm zu reichen. Ich erwartete, sie würde mir ein Wort über die Angelegenheit sagen, aber sie blieb stumm. Meine Liebe war in Verzweiflung und ich verbrachte die ganze Nacht, ohne ein Auge schließen zu können. Ich fürchtete, meine Weigerung hätte sie beleidigt und dieser Gedanke schnitt mir ins Herz. Den ganzen nächsten Tag aß ich keinen Bissen, und am Abend in der Gesellschaft sagte ich kein Wort. Ich fühlte mich krank und legte mich zu Bett mit einem Fieber, das mich a… ersten Ostertag das Bett zu hüten zwang. Am andern Tage war ich noch sehr schwach und wollte in meinem Zimmer bleiben; doch kam ein Bote von Frau F. und sagte mir, sie wolle mich sprechen. Ich verbot dem Mann zu sagen, daß er mich im Bett gefunden, stand auf und begab mich zu ihr. Bleich, verstört betrat ich ihr Zimmer; trotzdem fragte sie mich nicht nach meiner Gesundheit. Sie schwieg einen Augenblick, wie wenn sie sich darauf besinnen müßte, warum sie mich hatte rufen lassen, und sagte dann: „Ach so – wie Sie wissen, ist unser Adjutant gestorben und wir müssen ihn ersetzen. Mein Mann, der Sie gern hat, ist überzeugt, Herr D. R. überlasse Ihnen freie Wahl, und hat sich in den Kopf gesetzt, Sie werden annehmen, wenn ich selber Sie bitte, uns dieses Vergnügen zu machen. Täuscht er sich? Wenn Sie kommen wollen, erhalten Sie dies Zimmer nebenan.“
Sie zeigte mir eine Stube unmittelbar neben ihrem Schlafzimmer und so gelegen, daß ich mich nicht einmal an das Fenster zu stellen brauchte, um sie in allen Winkeln sehen zu können. „Herr D.R.“, sagte sie, „wird Ihnen nicht weniger gewogen bleiben, und da jeden Tag bei mir sehen wird, so wird er Ihre Interessen nicht vergessen. Nun sagen Sie mir, wollen Sie kommen oder nicht?“
„Ich möchte es gern, gnädige Frau, aber ich kann nicht.“
„Sie können nicht? Das ist sonderbar. Setzen Sie sich und sagen Sie mir, was Sie verhindert, wenn Sie sicher sind mit der Annahme, sowohl Herrn D.R. wie uns einen Gefallen zu tun?“
„Wenn ich dessen sicher wäre, würde ich augenblicklich annehmen, ich habe aber aus seinem eigenen Munde nichts weiter gehört, als daß er mir freie Wahl läßt.“
„Sie fürchten also ihn zu betrüben, wenn Sie zu uns kommen?“
„Das könnte wohl sein, und um alles in der Welt möchte ich nicht…“
„Ich bin des Gegenteils gewiß.“
„Haben Sie die Güte zu bewirken, daß er es mir sagt.“
„Und alsdann werden Sie kommen?“
„O mein Gott! Augenblicklich!“
Bei diesem Ausruf, der vielleicht zu vielsagend war, wandte ich die Augen zur Seite, um sie nicht in Verlegenheit zu setzen. Unterdessen verlangte sie ihr Mäntelchen, um in die Messe zu gehen, und wir verließen das Haus. Als wir die Treppe hinuntergingen, stützte sie ihre bloße Hand auf die meinige. Es war das erstemal, daß ich diese Gunst erlangte; man kann sich denken, daß ich sie als ein gutes Vorzeichen ansah. Als sie meine Hand losließ, fragte sie mich, ob ich Fieber hätte, denn meine Hand wäre ganz glühend heiß.
Als wir die Kirche verließen, bot ich ihr meine Hand, um ihr behilflich zu sein, in den Wagen des Herrn D.R. zu steigen, dem wir zufällig begegneten. Sobald ich mich von ihr verabschiedet hatte, beeilte ich mich nach Hause zu gehen, um frei aufatmen zu können und mich der ganzen Freude meiner Seele hinzugeben; denn ich zweifelte nicht mehr daran, daß ich geliebt würde, und ich glaubte, Herr D.R. könnte unter den obwaltenden Umständen Frau F. die erbetene Gefälligkeit nicht abschlagen.
Was ist die Liebe! Ich habe viel antiken Wortschwall über diesen Gegenstand gelesen; ich habe auch das meiste von dem gelesen, was die Modernen darüber sagen; aber was man auch darüber gesagt haben mag, was ich selber darüber gesagt habe, als ich jung war, und jetzt, wo ich es nicht mehr bin: nichts wird mich zu dem Geständnis bringen, daß die Liebe eine Kleinigkeit oder ein eitles Ding sei. Sie ist eine Art Wahnsinn, ja – ein Wahnsinn, auf den die Philosophie gar keinen Einfluß hat; sie ist eine Krankheit, der der Mensch in jedem Lebensalter unterworfen ist, und die unheilbar ist, wenn sie ihn im Alter befällt. Liebe! Unerklärbares Wesen, unerklärbares Gefühl! Gott der Natur! Süße Bitternis! Grausame Bitternis! Liebe! Reizendes Ungeheuer, das man nicht beschreiben kann! Inmitten von tausend Leiden, die du über das Leben ausbreitest, säest du so viele Wonnen aus, daß ohne dich Sein und Nichtsein ein und dasselbe wären.
Zwei Tage darauf sagte mir Herr D.R., ich möchte, um die Befehle des Herrn F. entgegenzunehmen, mich auf dessen Galeere begeben, die in fünf oder sechs Tagen unter Segel gehen sollte. Schnell packte ich meine Sachen und ging zu meinem neuen Vorgesetzten, der mich sehr gut aufnahm; wir segelten ab, ohne die Signora zu sehen, da diese noch schlief. Fünf Tage darauf liefen wir wieder in den Hafen ein, und ich richtete mich sofort in meiner lieben neuen Behausung ein; denn in dem Augenblick, wo ich mich anschickte, mich zu Herrn D.R. zu begeben, um ihn nach seinen Befehlen zu befragen, erschien dieser selbst. Er fragte Herrn F., ob er mit mir zufrieden gewesen sei, und richtete dieselbe Frage an mich mit Bezug auf Herrn F. Dann sagte er zu mir: „Casanova, da Sie gegenseitig miteinander zufrieden sind, so können Sie überzeugt sein, daß Sie mir ein wirkliches Vergnügen bereiten, indem Sie bei Herrn F. im Dienst bleibend.“
Ich fügte mich ehrerbietig und war in einer Stunde in meinem neuen Wirkungskreise eingerichtet. Frau F. sagte mir, sie sei entzückt, daß diese große Angelegenheit endlich im Sinne ihrer Wünsche erledigt sei. Ich antwortete ihr durch eine tiefe Verbeugung. So war ich also endlich wie der Salamander im Feuer, in das ich mich selber hineingewünscht hatte. Ich war fast immer unter den Augen der gnädigen Frau, speiste oft allein mit ihr; begleitete sie oft allein beim Spaziergang; wenn Herr D.R. nicht bei uns zu Tisch war, saß sie in meinem Zimmer, selbst wenn ich schrieb, mich mit ihr in dem ihrigen; stets war ich dienstfertig und aufmerksam, ohne scheinbar jemals die geringsten Ansprüche zu erheben. So verbrachte ich die ersten vierzehn Tage, ohne daß diese Annäherung in unserem wechselseitigen Benehmen irgendeine Veränderung hervorgebracht hätte. Indessen hoffte ich. Und um meinen Mut zu beleben, redete ich mir ein, die Liebe sei noch nicht stark genug, um ihren Stolz zu besiegen. Ich erwartete alles vom Zufall, und ich war fest entschlossen, sobald ein günstiger sich darbiete, ihn zu benutzen, denn ich war überzeugt, daß ein Liebender verloren ist, wenn er nicht das Glück an der Stirnlocke zu packen weiß.
Unangenehm war mir, daß sie in der Öffentlichkeit sich befleißigte, mich mit Gunstbeweisen zu überhäufen, während sie unter vier Augen damit zu geizen schien. Vor der Welt sah es ganz so aus, als sei ich glücklich; mir aber wäre es lieber gewesen, etwas weniger glücklich zu scheinen und es etwas mehr zu sein. Meine Liebe zu ihr war rein; Eitelkeit mischte sich nicht hinein.
Als ich eines Tages mit ihr allein war, sagte sie mir. „Sie haben Feinde; aber gestern abend habe ich diese zum Schweigen gebracht.“
„Das sind Neider, gnädige Frau, denen ich Mitleid erregen würde, wenn sie das Geheimnis meines Herzens kennten, und von denen Sie mich leicht befreien könnten.“
„Bitte, inwiefern würden Sie ihr Mitleid erregen, und wie könnte ich Sie wohl von ihnen befreien?“
„Sie halten mich für glücklich, und ich schmachte; befreien würden Sie mich von ihnen, wenn Sie mich schlecht behandelten.“
„Sie wären also weniger empfindlich gegen meine schlechte Behandlung als gegen den Neid der Böswilligen?“
„Gewiß, gnädige Frau, vorausgesetzt, daß die öffentliche schlechte Behandlung durch Güte unter vier Augen ausgeglichen würde; denn in meinem Glück, Ihnen anzugehören, fühle ich mich durch kein Gefühl der Eitelkeit belebt. Möge man mich beklagen – ich werde glücklich sein, vorausgesetzt, daß man sich irrt.“
„Eine solche Rolle werde ich niemals zu spielen wissen.“
Ich beging oft die Indiskretion, mich hinter dem Fenstervorhang meines Zimmers zu verbergen, um sie in aller Muße zu betrachten, wenn sie sich sicher glauben mußte, von niemandem gesehen zu werden. Aber was ich auf diese Weise erhaschte, war recht unbedeutend. Entweder ahnte sie, daß ich sie sehe, oder es war ihre Gewohnheit alle ihre Bewegungen waren so gemessen, daß selbst, ich sie in ihrem Bett sah, mein Glück sich auf ihren reizenden Kopf beschränkte.
Als eines Tages ihre Zofe von ihren schönen langen Haaren die Spitzen abschnitt, machte ich mir den Spaß, alle diese hübschen kleinen Schnitzel aufzuheben; ich legte sie nach und nach sämtlich auf ihren Putztisch, mit Ausnahme eines Löckchens, das ich in die Tasche steckte, da ich glaubte, sie habe nicht darauf acht gegeben; kaum aber waren wir allein, so sagte sie mir freundlich, aber ein bißchen zu ernst, ich möchte die Haare herausgeben, die ich aufgehoben hätte. Dies fand ich zu stark; denn eine derartige Strenge schien mir ebenso grausam wie ungerecht und unangebracht zu sein. Ich gehorchte, aber ich warf die Haare mit der verächtlichsten Miene auf ihren Putztisch.
„Mein Herr, Sie vergessen sich!“
„O nein, gnädige Frau; Sie hätten sich ja stellen können, als hätten Sie diesen unschuldigen Raub nicht bemerkt.“
„..Solche Verstellung ist unbequem.“
„Welche schwarze Tat konnten Sie meiner Seele zutrauen wegen eines so kindischen Diebstahles?“
„Keine schwarze Tat, aber unerlaubte Gefühle, die Sie nicht gegen mich hegen dürfen.“
„Gefühle, die Sie vielleicht nicht erwidern, gnädige Frau, die mir aber nur von Haß oder Stolz verboten werden können. Wenn Sie ein Herz hätten, würden Sie solchen Gefühlen nicht zum Opfer fallen; aber Sie haben nur Geist, und es muß ein boshafter Geist sein, weil er sich so viele Mühe gibt, mich zu demütigen. Sie haben mir mein Geheimnis entlockt, gnädige Frau; machen Sie davon Beliebigen Gebrauch. Dafür aber habe ich Sie richtig kennengelernt. Diese Kenntnis wird mir nützlicher sein als Ihnen Ihre Entdeckung; denn ich werde vielleicht vernünftig werden.“
Nach diesem Gefühlsausbruch ging ich hinaus; und da ich mich nicht zurückrufen hörte, schloß ich mich in mein Zimmer ein. In der Hoffnung, mich durch Schlaf zu beruhigen, zog ich mich aus und legte mich zu Bett. In solchen Augenblicken findet ein Verliebter den geliebten Gegenstand abscheulich; seine in Zorn verwandelte Liebe erzeugt nur noch Haß und Verachtung. Es war mir unmöglich einzuschlafen, und als man mich zum Abendessen rufen wollte, ließ ich sagen, ich wäre krank. Die Nacht verging, ohne daß ich ein Auge schließen konnte; ich fühlte mich wie gerädert, aber ich wollte sehen, wie sich die Sache entwickeln würde, und weigerte mich zum Essen zu kommen, indem ich wiederum sagte, ich wäre krank. Am Abend fühlte ich mein Herz vor Freude höher schlagen, als ich meine schöne Dame in mein Zimmer eintreten hörte. Unruhe, Fasten und Schlaflosigkeit ließen mich wirklich krank aussehen, und dies freute mich. Ich entledigte mich bald ihres Besuches, indem ich ihr in gleich- gültigem Tone sagte, es wäre nur ein heftiges Kopfweh, woran ich öfters litte; Fasten und Ruhe würden mich bald wieder herstellen.
Gegen elf Uhr kam abermals Frau F., diesmal mit ihrem Freunde Herrn D. R. Sie trat an mein Bett heran und fragte zärtlich:
„Was haben Sie denn, mein armer Casanova?“
„Ein schweres Kopfweh, gnädige Frau, das morgen vorüber sein wird.“
„Warum wollen Sie bis morgen warten? Sie müssen sofort gesund werden. Ich habe für Sie eine Fleischbrühe und zwei frische Eier bestellt.“
„Nichts, gnädige Frau! Nur Hunger kann mich heilen.“
„Er hat recht“, sagte Herr D. R.; „ich kenne diese Krankheit.“
Ich schüttelte leise den Kopf.
Während Herr D. R. sich damit beschäftigte, einen Kupferstich zu betrachten, ergriff sie meine Hand und sagte mir, es würde sie außerordentlich freuen, wenn sie mich eine Tasse Brühe trinken sähe; als sie die Hand zurückzog, fühlte ich, wie sie ein Päckchen in der meinigen ließ; hierauf trat sie zu Herrn D. R. heran, um ebenfalls das Bild zu besehen.
Ich öffne das Päckchen, fühle Haare und beeile mich, sie unter der Decke zu verstecken; zugleich aber fühle ich auf eine Weise, die mich erschreckt, mir das Blut in den Kopf steigen. Ich verlange Wasser; sie kommt mit Herrn D. R. an mein Bett, und beide sind erschrocken, mich plötzlich ganz rot und erhitzt zu sehen, während ich eben noch blaß und teilnahmslos gewesen war. Sie gibt mir ein Glas Wasser mit Karmeliterwasser vermischt; dies ruft binnen einer Minute ein heftigs Erbrechen hervor. Einen Augenblick darauf fühle ich mich besser und verlange etwas zu essen. Sie lächelt. Ihre Kammerfrau kommt mit der Brühe und den Eiern, und während ich diese Stärkung zu rnir nehme, erzähle ich ihnen die Geschichte von Pandolfin. Herr D. R. glaubte ein Wunder zu sehen, und ich las auf den Zügen der anbetungswürdigen Frau Liebe, Mitleid und Reue. Wäre nicht Herr D. R. dabei gewesen, so würde jetzt die Stunde meines Glückes geschlagen haben; aber ich hatte die Gewißheit, daß sie nur hinausgeschoben war. Herr D. R. sagte zu Frau F., wenn er nicht mein Erbrechen gesehen hätte, würde er meine Krankheit für Verstellung gehalten haben; denn ein so rascher Übergang von Traurigkeit zur Fröhlichkeit wäre seiner Meinung nach nicht möglich.
„Das hat mein Wasser bewirkt“, sagte die Signora mit einem Blick auf mich; „ich werde Ihnen mein Fläschchen dalassen.“
„Nein, gnädige Frau, nehmen Sie es gütigst mit, denn ohne Ihre Gegenwart würde das Wasser wirkungslos sein.“
„Das glaube ich auch“, sagte der Herr; „darum lasse ich Sie hier bei dem Kranken.“
„Nein, nein! Wir müssen ihn schlafen lassen.“
Wirklich schlief ich die ganze Nacht; und ich schlief im Traum mit ihr; die Wirklichkeit hätte meine Genüsse nicht erhöhen können. Ich fand, daß ich große Fortschritte gemacht hätte; denn ein vierunddreißigstündiges Fasten gab mir das Recht, offen ihr von Liebe zu sprechen, und das Geschenk ihrer Haare war ein unverkennbares Liebesgeständnis.
Am nächsten Morgen sagte ich Herrn F. guten Tag und plauderte dann einen Augenblick mit ihrer Kammerzofe, während ich darauf wartete, daß es bei der gnädigen Frau Tag würde. Ich hatte das Vergnügen, sie lachen zu hören, als sie erfuhr, daß ich da wäre. Sie ließ mich eintreten. Ich hatte keine Zeit, auch nur ein einziges Wort zu sagen; denn sie rief mir sofort entgegen, sie sei ganz entzückt, mich wohlauf zu sehen, und ich müsse Herrn D. R. guten Morgen wünschen.
Nicht nur in den Augen eines Liebenden, sondern in den Augen jedes Mannes, der sie in diesem Zustande sieht, ist eine schöne Frau in dem Augenblick, wo sie sich den Armen des Schlummers entwindet, tausendmal entzückender als in jenem Augenblick, wo sie ihre Toilette beendet hat. Frau F. übergab mich in jenem Augenblick mit mehr Strahlen, als die Sonne verbreitet, wenn sie der Morgenröte sich zeigt. Trotzdem hält auch die schönste Frau ebensoviel auf ihre Toilette, wie eine, die derselben nicht eintraten könnte; denn je mehr man hat, desto mehr will man haben.
In dem Befehl, den Frau F. mir gab, sah ich einen neuen Anlaß für mich, nahen Glückes gewiß zu sein; denn indem sie mich fortschickt, sagte ich mir, hat sie sich gegen Ansprüche sichern wollen, die ich hätte erheben können und die sie hätte befriedigen müssen.
Im Besitze ihrer Haare fragte ich meine Liebe um Rat, was ich damit machen sollte; denn um den sentimentalen Geiz wieder gutzumachen, den sie an den Tag gelegt hatte, indem sie mich die kleinen Abschnitzel wieder herauszugeben nötigte, hatte sie mir diesmal eine ganze Locke gegeben, die groß genug war, eine Flechte daraus zu machen. Ihre Haare waren anderthalb Ellen lang. Nachdem ich meinen Entschluß gefaßt hatte, ging ich zu einem jüdischen Zuckerbäcker, dessen Tochter eine gute Stickerin war, und ließ in meiner Gegenwart auf ein Armband von grünem Atlas die vier Anfangsbuchstaben unserer Namen sticken; hierauf machte sie mir aus dem Rest eine sehr dünne Schnur. An dem einen Ende derselben ließ ich aus schwarzem Bande eine Schnur anbringen, mit der ich mich hätte erdrosseln können, wenn jemals die Liebe mich zur Verzweiflung gebracht hätte. Ich machte mir ein Halsband daraus. Da ich von einem so köstlichen Schatz nichts verlieren wollte, zerschnitt ich den ganzen Rest der Haare mit einer Schere, so daß ein ganz feines Pulver daraus wurde, und befahl dem Zuckerbäcker, dieses vor meinen Augen in einen Teig von Ambra, Zucker, Vanille, Engelwurz, Alkermes und Storar zu mischen; ich ging nicht eher, als bis die Plätzchen, die er aus dieser Mischung formte, fertig waren. Ich ließ mir ganz gleiche aus denselben Bestandteilen, mit Ausnahme der Haare, anfertigen, und tat die ersteren in eine schöne Bonbondose von Bergkristall, die anderen in eine Schildpattdose.
Seitdem sie mir durch das Geschenk ihrer Haare das Geheimnis ihres Herzens verraten hatte, verlor ich nicht mehr meine Zeit damit, ihr Geschichten zu erzählen; ich sprach zu ihr nur noch von meiner Leidenschaft und von meinem Wünschen: ich sagte ihr, sie müsse mich entweder aus ihrer Gegenwart verbannen oder mich glücklich machen; aber die Grausame wollte dies nicht zugeben. Sie antwortete mir wir könnten nur glücklich sein, indem wir uns jeder Pflichtverletzung enthielten. Wenn ich mich ihr zu Füßen warf, um im voraus Vergebung zu erhalten für die Gewalt, die ich ihr antun wollte, wehrte sie mich mit einer Kraft ab, die viel stärker war als die eines weiblichen Herkules; denn sie sagte mir mit einer Stimme voll von Liebe und Gefühl: „Mein Freund, ich bitte Sie nicht, meine Schwachheit zu achten, aber ach! schonen Sie doch meiner um der Liebe willen, die ich für Sie hege!“
„Wie? Sie lieben mich, und Sie wollen sich niemals entschließen, mich glücklich zu machen! Das ist unglaublich, das ist unnatürlich! Sie zwingen mich zu glauben, daß Sie mich nicht lieben. Lassen Sie mich einen Augenblick meine Lippen auf die Ihrigen pressen; mehr werde ich von Ihnen nicht verlangen.“
„Nein, mein Freund, nein! Dies wurde nur unsere Wünsche entflammen, meine Entschlüsse erschüttern, und wir würden noch unglücklicher sein.“
Auf solche Art brachte sie mich jeden Tag zur Verzweiflung, und dann beklagte sie sich hinterdrein, man vermisse an mir in Gesellschaft den Geist und Frohsinn, die ihr so sehr gefallen hätten, als ich von Konstantinopel zurückgekommen wäre. Und Herr D. R., der gerne seinen Scherz an mir ausließ, sagte mir, ich würde zusehends magerer. Eines Tages sagte Frau F. mir, dies wäre ihr unangenehm, denn boshafte Beobachter könnten daraus vielleicht den Schluß ziehen, daß sie mich schlecht behandelte. Wahrlich eine eigentümliche Denkweise, die gegen alle Natur zu sein scheint. Ich machte ein idyllisches Gedicht darüber, das ich noch heutigestags nicht lesen kann, ohne daß mir die Wimper feucht wird.
„Wie?“ rief ich, „Sie erkennen also an, daß Sie grausam gegen mich sind? Sie fürchten, die Welt könne Ihre Strenge erraten, und doch machen Sie sich den Spaß, bei solcher Strenge zu verharren! Sie lassen mich alle Qualen eines Tantalus erdulden! Sie wären entzückt mich lustig und freudestrahlend zu sehen, selbst wenn man daraus den Schluß zöge, ich sei es wegen der Huld, die Sie mir erwiesen, und dabei verweigern Sie mir die unbedeutendste Gunstbezeigung!“
„Möge man es glauben, wenn es nur nicht wahr ist.“
„Welcher Widerspruch! Wäre es möglich, daß ich Sie nicht liebte, daß Sie nichts für mich empfänden? Solche Widersprüche erscheinen mir widernatürlich. Aber auch Sie magern ab, und ich, ich sterbe. Unser Schicksal ist unwiderruflich besiegelt: binnen kurzem werden wir sterben, Sie an Auszehrung, ich an Erschöpfung; denn mit mir ist es so weit, daß ich Tag und Nacht, immer und überall Ihres Scheinbildes genieße, auch wenn ich in Ihrer Gegenwart bin.“
Als ich diese Erklärung in leidenschaftlichem Ton hervorgestoßen hatte, sah ich sie erstaunt und gerührt, und ich glaubte, der Augenblick des Glückes sei da. Ich umschlang sie mit meinen Armen und verschaffte mir schon die Vorläufer des Genusses- da klopfte die Schildwache zweimal. Grausame Störung! Ich springe auf, stelle mich vor sie hin und bringe mich in Ordnung… Herr D. R. erschien und fand mich diesmal bei so munterer Laune, daß er bis ein Uhr nachts bei uns blieb.
Meine Zuckerplätzchen begannen Aufsehen zu machen. Herr D. R., Frau F. und ich waren die einzigen, die sie stets in ihren Bonbonnieren führten.
Ich war geizig damit, und niemand wagte mich um welche zu bitten, da ich gesagt hatte, sie seien teuer, und auf Korfu gäbe es keinen Zuckerbäcker, der imstande sei sie nachzumachen, und keinen Chemiker, der ihre Zusammensetzung festzustellen vermöchte. Vor allen Dingen verschenkte ich niemals etwas von dem Inhalt meiner Kristalldose, und Frau F. hatte dies sehr wohl bemerkt. Ganz gewiß hielt ich meine Zuckererbsen nicht für einen Liebeszauber, und der Gedanke lag mir fern, daß sie durch die Haare köstlicher geworden sein könnten; aber aus einem verliebten Aberglauben legte ich Wert auf sie, und ein Genuß war mir der Gedanke, daß ich einige winzige Körperteilchen des angebeteten Wesens meinem eigenen Körper einverleibte.
Frau F. schwärmte für meine Zuckererbsen, ohne Zweifel infolge einer gewissen Sympathie. Sie behauptete überall, meine Plätzchen seien ein Universalheilmittel. Da sie sich unumschränkte Gebieterin des Erfinders wußte, so verlangte sie das Geheimnis der Zusammensetzung nicht zu erfahren. Da sie jedoch bemerkt hatte, daß ich anderen Leuten nur Zuckererbsen aus meiner Schildpattdose anbot und selber nur solche aus meiner Kristalldose aß, fragte sie mich eines Tages nach dem Grunde. Unbedachterweise antwortete ich ihr, in denen, die ich äße, sei etwas, das mich zwänge, sie zu lieben.
„Davon glaube ich kein Wort; aber sie sind also anders als die, die ich selber esse?“
„Sie sind ganz gleich; nur befindet sich ausschließlich in den meinigen der Bestandteil, der mich zwingt, Sie liebzuhaben.“
„Sagen Sie mir, was für ein Bestandteil das ist!“
„Das ist ein Geheimnis, das ich Ihnen nicht enthüllen kann.“
„Und ich werde nicht mehr Ihre Zuckererbsen essen.“
Mit diesen Worten stand sie auf, schüttete ihre Bonbondose aus und füllte sie mit Schokoladenplätzchen; von der Stunde an schmollte sie mir, auch noch die folgenden Tage, und vermied jede Gelegenheit, sich mit mir allein zu befinden. Dies machte mir Kummer; ich wurde traurig, aber ich konnte mich nicht entschließen, ihr zu sagen, daß ich ihre Haare äße.
Vier oder fünf Tage darauf fragte sie mich, warum ich so traurig sei.
„Weil Sie nicht mehr von meinen Zuckererbsen essen.“
„Es steht bei Ihnen, Ihr Geheimnis zu bewahren, und es steht bei mir, zu essen, was ich will.“
„Das habe ich nun davon, daß ich Ihnen ein Geständnis gemacht habe!“
Mit diesen Worten öffne ich meine Kristalldose und schütte ihren ganzen Inhalt in meinen Mund. „Noch zweimal“, rufe ich, „und ich werde an meiner Liebesraserei sterben. Dann haben Sie Ihre Rache für meine Zurückhaltung. Leben Sie wohl, gnädige Frau.“
Sie ruft mich zurück, bittet mich, neben ihr Platz zu nehmen, und sagt mir, ich solle keine Dummheiten machen, die ihr Kummer bereiten würden; denn sie wisse, daß sie mich liebe, und ich müsse auch wissen, daß sie nicht daran glaube, es geschähe kraft irgendeines Mittels. „Damit Sie Gewißheit haben, daß Sie solcher Mittel nicht bedürfen, um geliebt zu werden, so empfangen Sie hiermit ein Pfand meiner Zärtlichkeit!“
Sie bietet mir ihren schönen Mund, und ich presse meine Lippen darauf, bis ich endlich mich wieder losreißen muß, um Atem zu holen. Dann werfe ich mich ihr zu Füßen, die Augen feucht von Tränen der Zärtlichkeit und Dankbarkeit, und rufe, wenn sie mir verspreche, mir zu verzeihen, wolle ich ihr mein Verbrechen eingestehen.
„Ein Verbrechen! Sie erschrecken mich. Ich verzeihe Ihnen. Schnell, sagen Sie mir alles!“
„Alles! Meine Zuckererbsen enthalten Ihre zu Pulver zerriebenen Haare. Sehen Sie an meinem Arm dieses Armband, worauf mit Ihren Haaren die Anfangsbuchstaben unserer Namen gestickt sind; und sehen Sie hier an meinem Halse diese Haarschnur, mit der ich meinem Leben ein Ende machen will, wenn Sie mich nicht mehr lieben. Dies sind meine Verbrechen; aber ich hätte nicht ein einziges von ihnen begangen, wenn ich Sie nicht anbetete!“
Sie lachte, hob mich auf und sagte mir, ich sei in der Tat der allergrößte Verbrecher. Sie trocknete meine Tränen, indem sie mir die Versicherung gab, ich würde mich niemals erdrosseln.
Nachdem ich bei dieser Unterhaltung den Nektar des ersten Kusses von der Göttin gekostet hatte, besaß ich die Selbstbeherrschung, ihr gegenüber ein ganz anderes Verhalten zu beobachten. Sie sah, wie ich glühte, vielleicht glühte auch sie; und trotzdem besaß ich die Kraft, mich jedes Angriffes zu enthalten.
„Wie kommt es“, fragte sie mich eines Tages, „daß Sie die Kraft gefunden haben, sich zu beherrschen?“
„Nach dem zärtlichen Kuß, den Sie mir ganz aus freiem Willen gewährt haben, fühlte ich, daß ich nichts beanspruchen dürfte, was nicht Ihr Herz ebenso aus freien Stücken mir zu bewilligen Sie antriebe. Sie können sich nicht vorstellen, wie süß mir dieser Kuß gewesen ist!“
„Wie könnte dies mir unbekannt sein, Sie Undankbarer! Wer von uns beiden hat diese Süße hervorgerufen?“
„Nicht Sie, nicht ich, angebetetes Weib! Die Liebe hat ihn gezeugt, diesen so zärtlichen, so süßen Kuß“
„Ja, mein Freund, die Liebe, deren Schätze unerschöpflich sind!“
Sie hatte kaum ausgesprochen, da hatten sich schon unsere Lippen gefunden. Sie hielt mich so fest gegen ihren Busen gepreßt, daß es mir nicht möglich war, mit meinen Händen mir noch andere Genüsse zu verschaffen; aber ich fühlte mich glücklich. Am Ende dieses entzückenden Kampfes fragte ich sie, ob sie glaubte, daß wir immer dabei stehenbleiben würden.
„Immer, mein Freund! Niemals wollen wir weiter gehen. Die Liebe ist ein Kind, das man mit Tändeleien hochwichtigen muß; eine zu kräftige Nahrung muß ihr den Tod bringen.“
„Ich kenne die Liebe besser als Sie. Sie verlangt eine gehaltvolle Nahrung, und wenn diese hartnäckig ihr verweigert wird, verdorrt sie. Versagen Sie mir nicht den süßen Trost der Hoffnung!“
„Hoffen Sie, wenn Sie dabei Ihre Rechnung finden!“
„Was sollte ich sonst anfangen? Ich hoffe, denn ich weiß, Sie haben ein Herz.“
„Hören Sie–erinnern Sie sich, wie Sie nur eines Tages im Zorn sagten, ich hätte nur Verstand? Sie glaubten mir damit eine starke Beleidigung zu sagen.“
„O gewiß!“
„Wie herzlich lachte ich hierüber bei näherem Nachdenken! Ja, lieber Freund, ich habe ein Herz, und hätte ich es nicht, so würde ich jetzt nicht glücklich sein. Bewahren wir uns also unser gegenwärtiges Glück, und seien wir zufrieden, ohne mehr zu wünschen!“
Ich unterwarf mich ihren Gesetzen, aber meine Verliebtheit wuchs von Tag zu Tage, und ich hoffte, daß auf die Länge der Zeit die Natur, die stets stärker ist als alle Vorurteile, eine glückliche Wendung herbeiführen würde. Aber mir half, um zu diesem Ziel zu gelangen, nicht nur die Natur, sondern auch das Glück. Ich verdankte dies einem Unglück.
Als sie eines Tages am Arme des Herrn D. R. in einem Garten spazierte, blieb sie an einem wilden Rosenstrauch hängen und zog sich einen tiefen Riß über dem Knöchel zu. Herr D. R. verband ihr sofort die Wunde mit seinem Taschentuch, um das reichlich strömende Blut zu stillen, und man mußte sie in einer Sänfte nach Hause tragen lassen. Auf Korfu sind Beinwunden gefährlich, wenn sie nicht gut gepflegt werden; oft muß man die Insel verlassen, um die Wunden zum Vernarben zu bringen.
Da sie im Bett bleiben mußte, so war es mein glückliches Amt, mich stets zu ihren Befehlen zu halten. Ich sah sie jeden Augenblick; aber an den ersten drei Tagen folgte ohne Unterbrechung ein Besuch dem anderen, und ich war niemals allein mit ihr. Am Abend, wenn alle Besucher fort waren und ihr Mann sich zurückgezogen hatte, blieb Herr D. R. noch eine Stunde, und wenn auch dieser sie verließ, erforderte der Anstand, daß ich ging. Vor dem Unfall hatte ich viel ungezwungener mit ihr verkehrt, und ich sagte ihr dies in halb lustigem, halb traurigem Ton. Am nächsten Morgen verschaffte sie mir zur Entschädigung einen glücklichen Augenblick.
Ein alter Äskulap kam jeden Morgen bei Tagesanbruch, um sie zu verbinden, und dabei war nur ihre Kammerzofe anwesend; ich ging stets im Schlafrock zu der Mädchenkammer, um als erster zu erfahren, wie meine Gottheit sich befände.
An jenem Morgen kam die Zofe zu mir, als gerade der Wundarzt Frau F. verband, und sagte mir, ich möchte eintreten.
„Sehen Sie doch, bitte, mal nach, ob mein Bein nicht mehr so rot ist.“
„Um dies sagen zu können, gnädige Frau, müßte ich es gestern gesehen halben.“
„Da haben Sie recht. Ich habe Schmerzen und fürchte, die Rose wird dazutreten.“
„Seien Sie unbesorgt, Signora“, sagte der Doktor, „bleiben Sie im Bett, und ich bin sicher, Sie gesund zu machen.“
Der Wundarzt war am Fenster beschäftigt, einen Umschlag zurechtzumachen, und da die Zofe hinausgegangen war, fragte ich, ob sie eine Härte in der Wade verspürte und ob vielleicht die Rötung streifenweise höherstiege; es war natürlich, daß ich diese Frage mit einer Untersuchung durch Hände und Augen begleitete. Ich sah keine Rötung und fühlte keine Härte, aber… und die zärtliche Kranke beeilte sich lachend, den Vorhang fallen zu lassen, indem sie mir gestattete, mir einen zärtlichen Kuß zu nehmen, dessen Süßigkeit ich seit vier Tagen nicht mehr genossen hatte. Liebeswahnsinn, zaubervolle Raserei! Von ihren Lippen wandte sich mein Mund zu ihrer Wunde; ich war in diesem Augenblick überzeugt, meine Küsse müßten das beste Heilmittel sein, und ich hätte nicht früher abgelassen, wenn mich nicht ein Geräusch, das die Zofe beim Eintreten machte, zum Aufhören gezwungen hätte.
Als ich mit ihr allein war, beschwor ich sie, vor Begierde glühend, sie möchte doch wenigstens meine Augen glücklich machen.
„Ich fühle mich erniedrigt, wenn ich denke, daß das Glück, dessen ich soeben genoß, nur ein Diebstahl ist!“
„Aber wie du dich täuschest!“
Am nächsten Moren war ich wieder beim Verbinden zugegen: Sobald der Arzt fort war, bat sie mich, ihr die Kissen zurechtzulegen. Ich tat es augenblicklich. Wie wenn sie nur diese angenehme Arbeit hätte erleichtern wollen, schlug sie die Decke zurück und stützte sich auf ihre Hände auf. Hierdurch erleichterte sie mir den Anblick einer Menge von Schönheiten, an denen meine Augen sich berauschten. Ich verlängerte meine Arbeit, und sie fand nicht, daß ich zu wäre.
Als ich fertig war, konnte ich nicht mehr; ich warf mich ihr gegenüber in einen Lehnstuhl und versank in eine Art Andacht. Ich betrachtete dies entzückende Wesen, das anscheinend ganz ungekünstelt mir stets eine Wonne nur verschaffte, um mir eine noch größere zu gewähren, und dabei doch niemals ans Ziel kam.
„Woran denken Sie?“ fragte sie.
„An das hohe Glück, mit dem Sie mich beseligt haben.“
„Sie sind ein grausamer Mann.“
„Nein, ich bin nicht grausam; denn da Sie mich lieben, so bauchen Sie nicht darüber zu erröten, daß Sie barmherzig gewesen sind. Bedenken Sie: ich liebe Sie leidenschaftlich, und ich darf nicht glauben, daß mir nur durch Überraschung dieser entzückende Anblick zuteil geworden ist. Denn wenn ich ihn nur dem Zufall verdankte, so müßte ich vor mir selber eingestehen, daß jeder andere an meiner Stelle dasselbe Glück hätte haben können, und dieser Gedanke wäre Todesqual für mich. Lassen Sie mich Ihnen die wonnige Dankbarkeit schuldig sein, daß Sie mich heute morgen gelehrt haben, wie glücklich schon ein einziger meiner Sinne mich machen kann. Können Sie meinen Augen zürnen?“
„Ja“
„Sie gehören Ihnen, reißen Sie sie mir aus!“
Am nächsten Tage schickte sie, sobald der Doktor fortgegangen war, ihr Mädchen aus, um Einkäufe zu besorgen. Nach Augenblicken sagte sie zu mir: „Ach! sie hat vergessen, mir mein Hemd anzuziehen.“
„O, gestatten Sie, daß ich sie ersetze.“
„Ja. Aber vergiß nicht, daß ich nur deinen Augen erlaube, am Feste teilzunehmen.“
„Damit bin ich einverstanden.“
Sie schnürte ihr Mieder auf und zog dieses sowie ihr Hemd aus; dann sagte sie mir, ich möchte ihr schnell das reine Hemd reichen; da ich aber mit allem, was ich sah, zu sehr beschäftigt war und mich nicht sonderlich beeilte, rief sie: „Gib mir doch mein Hemd her! Es liegt auf dem Tischchen.“
„Wo?“
„Dort unten, am Fußende des Bettes. Ich werde es mir selber nehmen.“
Sie beugte sich zu dem Tischchen hinüber und entblößte dabei fast alles, was ich begehrte. Langsam sich wieder aufrichtend, reichte sie mir das Hemd; aber ich konnte es nicht halten, so sehr zitterte ich vor Glück. Sie hat Mitleid mit mir, meine Hände teilen das Glück meiner Augen; ich sinke in ihre Arme, unsere Lippen verschmelzen sich miteinander, und in einer wollüstigen Umschlingung haben wir beide gleichzeitig einen Liebeserguß, der zwar unzulänglich für unsere Begierden, aber doch süß genug ist, um sie einen Augenblick zu täuschen.
Mit größerer Selbstbeherrschung als ein Weib sie sonst unter derartigen Umständen zu haben pflegt, paßte sie auf, daß ich nur bis zum Vorhof des Tempels gelangte. Der Eintritt in das Heiligtum wurde mir noch nicht bewilligt.