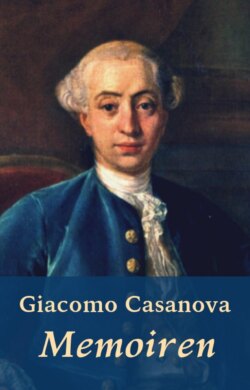Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 13
Achtes Kapitel
ОглавлениеKurzer, aber glücklicher Aufenthalt in Neapel. – Don Antonio Casanova. – Don Lelio Caraffa. – Ich fahre in reizender Gesellschaft nach Rom und trete dort in den Dienst des Kardinals Acquavina ein. – Barbaruccia. – Lestaccio. – Frascati
Auf die verschiedenen Fragen, die Doktor Gennaro an mich richtete, konnte ich ohne alle Verlegenheit antworten; aber sehr sonderbar, ja unangebracht fand ich die fortwährenden Ausbrüche von Gelächter, die bei jeder meiner Antworten aus seiner Brust hervorkamen. Meine mitleidsvolle Beschreibung des traurigen Calabriens und meine Schilderung der elenden Lage des Bischofs von Martorano mußten nach meiner Meinung eher zu Tränen rühren als Heiterkeit erwecken. Ich glaubte daher, er wolle mich zum besten halten und war schon nahe daran, mich zu ärgern, als er wieder ruhiger wurde und mir in herzlichem Tone sagte, ich müsse ihn entschuldigen; sein Lachen sei eine Krankheit, die anscheinend in seiner Familie heimisch sei, denn ein Oheim von ihm sei daran gestorben.
„An Lachen gestorben?“ rief ich.
„Ja. Diese Krankheit, die Hippokrates nicht gekannt hat, nennt man die flati (Blähungen, Vapeurs).“
„Wie? Dies hypochondrische Leiden, das sonst alle davon Befallenen traurig stimmt, es macht Sie heiter?“
„Ja. Ohne Zweifel kommt dies daher, daß meine flati statt auf die Rippenweiche bei mir auf die Milz wirken, die nach meinem Arzt das Organ des Lachens ist. Er hat da eine Entdeckung gemacht.“
„Keineswegs. Diese Ansicht ist schon sehr alt; es ist sogar die einzige Funktion, die wir der Milz in unserm animalischen Organismus anweisen können.“
„Nun darüber wollen wir uns bei Tische unterhalten, denn ich hoffe doch, Sie bleiben etliche Wochen hier.“
„Unmöglich. Spätestens übermorgen reise ich ab.“
„Sie haben also Geld?“
„Ich rechne auf die sechzig Dukaten, die Sie mir auszahlen sollen.“
Bei diesen Worten geht wieder das Lachen los. Da ich sichtlich in Verlegenheit gerate, sagt er: „Ich finde den Gedanken scherzhaft, daß ich Sie hier zurückhalten kann, solange ich Lust habe. Aber, Herr Abbate, haben Sie doch die Güte, meinen Sohn aufzusuchen, er macht recht hübsche Verse.“
Der vierzehnjährige Jüngling war wirklich schon ein großer Dichter. Ein Mädchen führte mich zu ihm, und ich fand in ihm einen Jüngling mit sehr angenehmen Gesichtszügen und außerordentlich liebenswürdigen Manieren. Er empfing mich sehr höflich und entschuldigte sich dann in anmutiger Weise, daß er sich für den Augenblick mir nicht ganz und gar widmen könne; er habe ein Gedicht fertig zu machen, da eine Verwandte der Herzogin von Bovino in Santa Chiara den Schleier nehmen solle; die Druckerei warte auf das Manuskript. Ich fand seine Entschuldigung sehr berechtigt und erbot mich, ihm zu helfen. Er las mir sein Gedicht vor; es war voll Begeisterung in Versen nach Art des Guidi geschrieben; ich riet ihm daher, es Ode zu nennen. Nachdem ich voll Überzeugung die wirklich schönen Stellen hervorgehoben hatte, glaubte ich ihn auch auf einige Schwächen und Mängel aufmerksam machen zu dürfen, indem ich ihm dafür andere Verse zu setzen vorschlug, die ich selber machte. Er war entzückt über meine Bemerkungen, dankte mir herzlich und fragte mich, ob ich Apollo sei. Während er die Ode abschrieb, machte ich ein Sonett auf denselben Gegenstand. Sehr erfreut darüber, ersuchte er mich, das Sonett mit meinem Namen zu unterzeichnen, und bat mich, es zusammen mit seiner Ode in die Druckerei schicken zu dürfen.
Während ich mein Gedicht verbesserte und ins reine schrieb, ging er zu seinem Vater und fragte ihn, wer ich sei. Hierüber lachte dieser, bis wir uns zu Tische setzten. Am Abend wurde für mich ein Bett im Zimmer des jungen Dichters aufgeschlagen, worüber ich wirklich erfreut war.
Die Familie des Doktors Gennaro bestand nur aus diesem Sohn, einer nicht eben hübschen Tochter, seiner Frau und zwei sehr frommen alten Schwestern. Beim Abendessen hatten wir mehrere Literaten zu Tisch, unter anderen auch den Marchese Galiani, der damals an einem Kommentar zum Vitruv arbeitete. Seinen Bruder, den Abbé Galiani, lernte ich zwanzig Jahre später in Paris als Gesandtschaftssekretär beim Grafen Cantillana kennen.
Am nächsten Tage machte ich die Bekanntschaft des berühmten Genovesi, der bereits den Brief des Erzbischofs von Cosenza erhalten hatte. Er sprach mit mir viel über Apostolo Zeno und den Abbate Conti. Beim Essen sagte er, die geringste Sünde, die ein Priester begehen könne, sei die, an einem Tage zwei Messen zu lesen, um zwei Carlinen mehr zu verdienen; ein Weltgeistlicher dagegen, der dieselbe Sünde beginge, verdiene den Feuertod.
Am Tage darauf nahm die Nonne den Schleier und unter den zu diesem Anlaß veröffentlichten Gedichten fanden die Ode des jungen Gennaro und mein Sonett am meisten Beifall. Ein Neapolitaner, der denselben Namen trug wie ich, bekam Lust, mich kennenzulernen, und da er erfuhr, daß ich beim Doktor wohne, stattete er diesem zu seinem Namensfeste gleich am nächsten Tage nach der Feier in Santa Chiara einen Glückwunschbesuch ab.
Don Antonio Casanova nannte mir seinen Namen und fragte mich, ob meine Familie venetianischen Ursprungs sei.
„Ich bin, mein Herr“, antwortete ich ihm mit bescheidener Miene, „ein Urenkel vom Enkel des unglücklichen Marcantonio Casanova; er war Sekretär des Kardinals Pompeo Colonna und starb unter Papst Clemens dem Siebenten im Jahre 1528 zu Rom an der Pest.“
Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, so fiel Don Antonio mir um den Hals und nannte mich seinen Vetter. Im selben Augenblick bekam die ganze Gesellschaft Angst, daß Don Gennaro vor Lachen sterben würde; denn es schien nicht möglich, daß ein Mensch ohne Lehensgefahr so furchtbar lachen könnte. Frau Gennaro machte ein sehr ärgerliches Gesicht und sagte zu meinem neuen Vetter, er hätte wohl ihrem Manne diesen Auftritt ersparen können, da ihm ja doch seine Krankheit bekannt wäre. Don Antonio ließ sich aber nicht aus der Fassung bringen und antwortete ihr, er habe nicht ahnen können, daß die Sache lächerlich sei. Ich sagte kein Wort; denn im Grunde fand ich diese Verwandtschaftserkennung sehr lächerlich. Als unser armer Lachkranker sich wieder beruhigt hatte, lud Casanova, ohne seine ernste Miene zu verändern, mich und den jungen Paolo, der mein unzertrennlicher Freund geworden war, für den nächsten Tag zum Essen ein. Sobald wir zu ihm kamen, beeilte sich mein würdiger Vetter, mir seinen Stammbaum zu zeigen, der mit einem Bruder Don Juans, Don Francisco, begann. In dem meinigen, den ich auswendig wußte, war Don Juan, von dem ich in grader Linie abstammte, als nachgeborener Sohn bezeichnet. Es war wohl möglich, daß er von Marcantonio einen Bruder gehabt hatte. Als aber Don Antonio erfuhr, daß meine Genealogie mit dem Aragonier Don Francisco begann, der zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts lebte, daß folglich der ganze Stammbaum des erlauchten Hauses der Casanova von Saragossa auch der seinige war, da war er vor Freude außer sich: er wußte nicht, was er alles anstellen sollte, um mich zu überzeugen, daß in unseren Adern dasselbe Blut rolle.
Er schien gerne wissen zu wollen, welcher glückliche Zufall mich nach Neapel geführt habe; ich sagte ihm, ich hätte mich dem geistlichen Stande zugewandt und wollte nach Rom gehen, um dort womöglich mein Glück zu machen. Er stellte mich nun seiner Familie vor, und es schien, als bemerkte ich in den Gesichtszügen seiner Eheliebsten, meiner Base, kein sehr großes Entzücken über den neuen Verwandten. Aber seine sehr hübsche Tochter und seine noch hübschere Nichte hätten mich leicht zum Glauben an die Macht des Blutes bekehren können, so fabelhaft diese auch sein mag.
Nach dem Essen sagte Don Antonio zu mir, die Herzogin von Bovino habe den Wunsch geäußert, zu erfahren, wer der Abbate Casanova sei, der das Sonett auf ihre Verwandten gemacht habe; er werde es sich zur Ehre anrechnen, mich ihr als seinen Verwandten vorzustellen. Da wir unter vier Augen waren, so bat ich ihn, mir diesen Besuch zu erlassen, da ich nur für die Reise ausgerüstet sei und meine Börse schonen müsse, um nicht in Rom ohne Geld anzukommen. Meine Offenherzigkeit freute ihn, und meine Gründe leuchteten ihm ein, aber er sagte: „Ich bin reich, und Sie dürfen keine Bedenken haben, sondern müssen mir erlauben, Sie zu einem Schneider zu führen.“ Er versicherte mir noch, kein Mensch werde jemals etwas von seinem Anerbieten erfahren, dagegen werde es ihn kränken, wenn ich ihm nicht dies Vergnügen machen wolle, das er von mir erwarte. Ich schüttelte ihm die Hand und sagte, ich wolle alles tun, was er wünsche. Wir gingen zu einem Schneider, der mir zu allen von Don Antonio bestellten Kleidern Maß nahm, und am nächsten Tage hatte ich alles, was der vornehmste Abbate für seine Toilette nötig haben kann. Don Antonio machte mir einen Besuch, blieb bei Don Gennaro zum Essen und führte hierauf mich und den jungen Paolo zur Herzogin. Die Dame behandelte mich auf neapolitanische Art und duzte mich sofort. Bei sich hatte sie ihre sehr hübsche zehn- oder zwölfjährige Tochter, die einige Jahre später Herzogin von Maddalone wurde. Die Herzogin schenkte mir eine Tabaksdose aus hellem Schildpatt mit eingelegten Goldarabesken; hierauf lud sie uns für den nächsten Tag zum Essen ein, indem sie uns sagte, daß wir nachher ins Kloster Santa Chiara gehen würden, die neue Nonne zu besuchen.
Ich trennte mich von meinem Vetter und jungen Freund und ging allein nach Panagiottis Lagerhaus, um das Faß Muskateller in Empfang zu nehmen. Der Lagerverwalter war so freundlich, es in zwei Fäßchen von gleicher Größe umfüllen zu lassen. Von diesen sandte ich eins an Don Antonio, das andere an Don Gennaro. Beim Fortgehen begegnete ich dem ehrlichen Griechen, der mich mit Vergnügen wiedersah. Mußte ich erröten, diesen braven Mann wiederzusehen, den ich getäuscht hatte? Nein; denn er fand, ich hätte mich gegen ihn sehr anständig benommen.
Als ich nach Hause kam, dankte Don Gennaro mir, ohne zu lachen, für mein kostbares Geschenk, und am nächsten Tage schenkte Don Antonio mir zum Ausgleich für den ausgezeichneten Muskateller, den ich ihm geschickt hatte, einen Stock mit goldenem Knopf, der wenigstens zwanzig Unzen wert war, und sein Schneider brachte mir einen Reiseanzug und einen blauen Überrock mit goldgestickten Knopflöchern, alles vom feinsten Tuch, so daß ich jetzt wirklich prachtvoll ausgerüstet war.
Bei der Herzogin von Bovino machte ich die Bekanntschaft des weisesten aller Neapolitaner, des erlauchten Don Lelio Caraffa, von der herzoglichen Familie Maddalone, den der König Don Carlos mit dem Namen Freund beehrte.
Im Sprechzimmer von Santa Chiara verbrachte ich zwei köstliche Stunden in belebter Unterhaltung und hielt der Neugier aller Nonnen stand, die an den Sprechgittern waren. Hätte mein Schicksal mich in Neapel festgehalten, so würde ich dort mein Glück gemacht haben. Aher obwohl ich keinen bestimmten Plan hatte, so schien es mir doch, als rufe das Geschick mich nach Rom; ich widerstand daher den dringenden Bitten meines Vetters Don Antonio, der mir in mehreren der ersten Häuser eine ehrenvolle Stellung als Erzieher des Stammhalters verschaffen wollte.
Das Diner, das Don Antonio gab, war prachtvoll, aber er war dabei nachdenklich und übelgelaunt, denn er sah wohl, daß seine Frau den neuen Vetter mit scheelen Blicken ansah. Mehr als einmal glaubte ich zu bemerken, daß sie meinen neuen Anzug musterte und hierauf ihrem Tischnachbarn etwas ins Ohr sagte. Ohne Zweifel wußte sie alles. Es gibt im Leben gewisse Lagen, mit denen ich mich niemals habe abfinden können. Wenn in der glänzendsten Gesellschaft eine einzige Person ist, die mich auffällig mustert, so verliere ich die Selbstbeherrschung. Ich werde verdrießlich, weiß nicht mehr, was ich sagen soll, und stehe wie ein Einfaltspinsel da. Dies ist ein Fehler, aber ich kann nichts dafür.
Don Lelio Caraffa ließ mir ein hohes Gehalt anbieten, wenn ich den Studiengang seines Neffen, des damals zehnjährigen Herzogs von Maddalone leiten wollte. Ich ging zu ihm, um mich zu bedanken, und bat ihn, er möchte auf andere Art mein wahrer Wohltäter werden, indem er mir einige gute Empfehlungsbriefe für Rom mitgäbe. Diese Gunst gewährte der hohe Herr mir ohne Zögern, indem er mir schon am anderen Tage zwei Briefe sandte, einen für den Kardinal Acquaviva, den anderen für den Pater Georgi.
Da ich sah, daß meine Freunde in ihrer Teilnahme für mich mir die Ehre verschaffen wollten, Ihrer Majestät der Königin die Hand zu küssen, so beeilte ich mich mit meinen Vorbereitungen zur Abreise. Denn natürlich hätte die Königin mich ausgefragt und ich hätte ihr dann sagen müssen, daß ich Martorano und den von ihr auf den dortigen Bischofssitz beförderten armen Bischof verlassen hatte. Außerdem kannte die Fürstin meine Mutter; nichts hätte sie verhindern können zu erzählen, was diese in Dresden war; dies würde Don Antonio gekränkt haben, und mein Stammbaum wäre lächerlich gewesen. Ich kannte die Macht der Vorurteile: ich wäre unrettbar blamiert gewesen. Ich glaubte daher gut zu tun, wenn ich den günstigen Augenblick benutzte und abreiste. Beim Abschied schenkte Don Antonio mir eine goldene Uhr und übergab mir einen Brief für Don Gasparo Vivaldi, der sein bester Freund sei, wie er sagte. Don Gennaro zählte mir meine sechzig Dukaten auf, und sein Sohn bat mich, ihm zu schreiben, und schwor mir ewige Freundschaft. Alle begleiteten mich bis zu meinem Wagen; ihre Tränen mischten sich mit den meinigen, und sie überhäuften mich mit Glück- und Segenswünschen.
Von meiner Landung in Chiozza bis zu meiner Ankunft in Neapel hatte das Glück es sich zur Aufgabe gemacht, mich zu verfolgen; seit meiner Ankunft in Neapel nahm es eine weniger saure Miene an, und nach meiner Rückkehr dorthin zeigte es mir nur noch ein gönnerhaft-freundliches Lächeln. Neapel ist mir immer günstig gewesen, wie der Leser noch sehen wird. Er hat gewiß noch nicht vergessen, daß ich in Portici auf dem gefährlichen Punkt war, wo mein Geist der Gemeinheit hätte anheimfallen können, und gegen Erniedrigung des Geistes gibt es keine Hilfe, denn nichts kann ihn wieder hochbringen. Wer dieser Entmutigung verfällt, ist unrettbar verloren.
Ich war nicht undankbar gegen den guten Bischof von Martorano; denn wenn er mir auch, ohne es zu wollen, Böses zugefügt hatte, so gestand ich mir doch gerne selber ein, daß sein Brief an Don Gennaro die Quelle alles Guten war, das mir seitdem widerfahren war. Ich schrieb ihm von Rom aus.
Die ganze schöne Toledostraße entlang war ich damit beschäftigt, meine Tränen zu trocknen, und erst als wir die Stadt verließen, konnte ich mich mit dem Aussehen meiner Reisegefährten beschäftigen. An meiner Seite sah ich einen Mann von vierzig bis fünfzig Jahren, von angenehmem Äußeren und munterer Miene; mir gegenüber aber fesselten zwei reizende Gesichter meine Blicke. Es waren zwei junge, hübsche Damen in sehr sauberen Kleidern und von freiem und zugleich züchtigem Anstand. Diese Entdeckung war mir sehr angenehm, aber mir war das Herz schwer und Schweigen für mich eine Notwendigkeit. Wir kamen in Aversa an, ohne ein Wort gesprochen zu haben; und da der Vetturino uns sagte, er würde hier nur so lange anhalten, um seine Maultiere zu tränken, so stiegen wir nicht aus. Von Aversa bis Capua plauderten meine Reisegenossen fast ununterbrochen; ich aber – es ist unglaublich! – tat nicht ein einziges Mal den Mund auf. Es machte mir Spaß, die neapolitanische Mundart des Herrn und die hübsche römische Aussprache der beiden Damen zu hören. Es war wirklich eine Kraftleistung von mir, fünf Stunden lang zwei reizenden Frauen gegenüberzusitzen, ohne ein einziges Wort, ein einziges Kompliment an sie zu richten.
In Capua, wo wir die Nacht zubringen sollten, stiegen wir in einem Gasthof ab. Man gab uns ein Zimmer mit zwei Betten für uns alle – in Italien etwas durchaus nicht Ungewöhnliches. Der Neapolitaner sagte zu mir: „So werde also ich die Ehre haben, mit dem Herrn Abbate in einem Bett zu schlafen.“ Ich antwortete ihm, ohne eine Miene zu verziehen: es stehe bei ihm, die Wahl zu treffen und sogar es anders anzuordnen. Über diese Antwort lächelte die eine der beiden Damen, und zwar grade die, die mir am besten gefiel; ich erblickte darin ein gutes Vorzeichen.
Beim Abendessen waren wir zu fünf, denn es ist üblich, daß der Vetturino seine Fahrgäste verköstigt, falls nicht besondere Abmachungen getroffen worden sind, und dann ißt er mit ihnen zusammen. Bei unseren gleichgültigen Tischgesprächen fand ich in den Bemerkungen meiner Reisegefährten Anstand, Geist und Weltgewandtheit. Das machte mich neugierig. Ich ging nach dem Essen hinaus und fragte den Fuhrmann, wer meine Reisegefährten seien. „Der Herr“, sagte er mir, „ist Advokat, und eine von den beiden Damen ist seine Frau; ich weiß aber nicht welche.“
Bald darauf kam ich wieder ins Zimmer und ging aus Höflichkeit zuerst zu Bett, um den Damen zu ermöglichen, sich nach ihrer Bequemlichkeit zu entkleiden. Am Morgen stand ich ebenfalls zuerst auf, ging aus und kam erst wieder herein, als man mich zum Frühstück rief. Wir hatten ausgezeichneten Kaffee, den ich sehr lobte, und die Liebenswürdigste versprach mir für die ganze Dauer der Reise ebensolchen. Nach dem Frühstück kam ein Barbier; der Advokat ließ sich rasieren, und hierauf bot der Bursche auch mir seine Dienste an. Ich sagte ihm, ich brauchte ihn nicht, und er ging hinaus, indem er sagte, der Bart sei eine Unsauberkeit.
Als wir im Wagen saßen, bemerkte der Advokat, fast alle Barbiere seien unverschämt.
„Man müßte aber doch erst wissen“, sagte die Schöne, „ob der Bart eine Unsauberkeit ist oder nicht.“
„Das ist er“, antwortete der Advokat, „denn er ist ein Exkrement.“
„Das kann wohl sein“, sagte ich, „aber man sieht ihn nicht dafür an. Nennt man denn die Haare ein Exkrement? Man pflegt sie sehr sorgfältig, und doch sind sie von derselben Art wie der Bart. Man bewundert ja im Gegenteil ihre Schönheit und Länge.“
„Folglich“, bemerkte die Fragestellerin, „ist der Barbier ein Dummkopf.“
„Ja, aber noch eins!“ fragte ich; „habe ich denn einen Bart?“
„Ich glaubte es“, antwortete sie.
„In diesem Fall werde ich in Rom beginnen, mich rasieren zu lassen; denn es ist das erstemal, daß ich mir diesen Vorwurf machen höre.“
„Meine liebe Frau“, sagte der Advokat, „du hättest den Mund halten müssen, denn möglicherweise geht der Herr Abbate nach Rom, um dort Kapuziner zu werden.“
Über diesen Witz mußte ich lachen; da ich ihm aber nicht das letzte Wort lassen wollte, sagte ich, er habe richtig geraten, aber die Lust sei mir vergangen, als ich die gnädige Frau gesehen habe.
„O, da tun Sie aber unrecht“, versetzte der lustige Neapolitaner; „denn meine Frau hat die Kapuziner sehr gern, und ihr zuliebe müssen Sie bei Ihrem Beruf bleiben.“
Diese scherzhaften Bemerkungen führten zu mehreren anderen; in angenehmer Weise verging uns der Tag, und am Abend entschädigte eine geistvolle Unterhaltung über alles mögliche uns für das schlechte Essen, das uns in Garigliano vorgesetzt wurde. Meine erwachende Neigung wurde immer stärker durch das liebenswürdige Benehmen der Frau, der sie galt.
Am anderen Morgen fragte mich die liebenswürdige Dame, sobald wir wieder im Wagen saßen, ob ich vor meiner Rückkehr nach Venedig einige Zeit in Rom zu verweilen gedächte. Ich antwortete ihr: „Da ich doch niemanden kenne, so fürchte ich mich zu langweilen.“
„Man hat dort die Fremden sehr gern, und ich bin überzeugt, daß es Ihnen gefallen wird.“
„Ich könnte also hoffen, daß Sie, Signora, mir erlauben würden, Ihnen den Hof zu machen?“
„Sie würden uns damit eine Ehre erweisen“, sagte der Advokat.
Ich hielt meine Blicke fest auf seine reizende Frau geheftet und sah sie erröten, tat aber so, als bemerkte ich es nicht. Wir plauderten weiter, und der Tag verstrich ebenso angenehm, wie der vorhergehende. In Terracina, wo wir haltmachten, gab man uns ein Zimmer mit drei Betten: zwei schmalen und einem breiteten in der Mitte. Natürlich schliefen die beiden Schwestern zusammen und nahmen das große Bett. Sie legten sich hinein, während der Advokat und ich, ihnen den Rücken zukehrend, noch bei Tische saßen und plauderten. Sobald die Damen zu Bett waren, legte auch der Advokat sich nieder; er wählte das Bett, worauf seine Nachtmütze lag; ich hatte das andere, das vom großen Bett nur einen Fuß weit entfernt war. Ich sah, daß die Schöne, die bereits mein Herz gefangengenommen hatte, an der mir zugewandten Seite lag, und ich glaubte ohne Eitelkeit mir vorstellen zu können, daß nicht der Zufall allein dies so gefügt hätte.
Ich löschte das Licht und ging zu Bett; im Kopfe wälzte ich einen Plan, den ich weder auszuführen noch zu verwerfen wagte. Vergebens rief ich dem Schlaf. Ein ganz schwacher Lichtschein erlaubte mir das Bett zu sehen, worin die reizende Frau lag. Davor konnte ich kein Auge schließen. Wer weiß, wozu ich mich endlich noch entschlossen hätte – denn ich kämpfte seit einer Stunde – als ich sie plötzlich sich aufrichten und leise ihr Bett verlassen sah. Sie ging um das Bett herum und legte sich in das ihres Mannes, der ohne Zweifel friedlich weiterschlief, denn ich hörte kein Geräusch mehr. Verdrießlich, angeekelt, versuchte ich mit aller Gewalt einzuschlafen, und ich wachte erst mit dem Morgenrot auf. Ich sah die schöne Nachtschwärmerin in ihrem Bett, stand auf, zog mich schnell an und ging hinaus. Alle lagen noch in tiefem Schlaf. Erst im Augenblick der Abfahrt kehrte ich nach dem Gasthof zurück, vor dem der Advokat und die beiden Damen mich bereits im Wagen sitzend erwarteten.
Meine Schöne beklagte sich sanft und liebenswürdig darüber, daß ich ihren Kaffee nicht hätte haben wollen. Ich entschuldigte mich damit, daß ich das Bedürfnis gehabt hätte, spazierenzugehen, und vermied es sorgfältig, sie nur mit einem einzigen Blick zu beehren. Ich tat, als hätte ich Zahnweh, und war verdrießlich und schweigsam. In Piperno benutzte sie eine günstige Gelegenheit, um mir unbemerkt zu sagen, meine Zahnschmerzen seien nur Verstellung. Über diesen Vorwurf freute ich mich, denn ich sah voraus, daß es zu einer Erklärung kommen würde, die trotz meinem Verdruß mir nicht unerwünscht war.
Den Nachmittag über war ich wie am Morgen düster und einsilbig, bis wir in Sermonetta ankamen, wo wir über Nacht bleiben sollten. Wir trafen schon zeitig ein und da das Wetter schön war, so sagte die Signora, sie würde gern einen kleinen Spaziergang machen, und fragte mich höflich, ob ich ihr meinen Arm geben wolle. Ich erklärte mich bereit; ohnehin hätte ja die Höflichkeit mir nicht erlaubt, ihr diesen Wunsch abzuschlagen. Ich fühlte mich unbehaglich; mein Schmollen war mir selber unbequem, obgleich ich mir nicht klar darüber war. Nur eine Aussprache konnte alles wieder in Ordnung bringen; aber ich wußte nicht, wie ich eine solche herbeiführen sollte. Ihr Mann folgte uns mit der Schwägerin, aber in ziemlich großer Entfernung. Sobald ich sah, daß wir weit genug von ihnen ab waren, erkühnte ich mich, sie zu fragen, wie sie auf den Gedanken gekommen sei, daß ich mein Zahnweh nur vorgeschützt habe.
„Ich bin offen zu Ihnen“, sagte sie; „ich merkte es an der auffälligen Veränderung Ihres Benehmens und daran, daß Sie den ganzen Tag über sorgfältig vermieden, mich ein einziges Mal anzusehen. Da das Zahnweh Sie doch nicht hindern könnte, höflich zu sein, so mußte ich es für erheuchelt halten. Übrigens weiß ich bestimmt, daß niemand von uns Ihnen hat Anlaß geben können, so plötzlich in eine andere Stimmung zu geraten.“
„Es muß aber doch ein Anlaß dagewesen sein. Gnädige Frau, Sie sind nur zur Hälfte aufrichtig.“
„Sie irren sich, Herr Abbate; ich bin es ganz. Wenn ich Ihnen einen Anlaß gegeben habe, so kenne ich ihn nicht oder darf ihn nicht kennen. Haben Sie die Güte mir zu sagen, womit ich es gegen Sie versehen habe.“
„Mit nichts. Denn ich habe nicht das Recht, irgendwelche Ansprüche zu erheben.“
„Doch! Sie haben Anrechte. Dieselben wie ich. Nämlich die Anrechte, die die gute Gesellschaft allen ihren Mitgliedern gewährleistet. Sprechen Sie und seien Sie ebenso offenherzig wie ich!“
„Den Anlaß dürfen Sie nicht kennen; oder vielmehr, Sie müssen tun, als ob Sie ihn nicht kennen. Da haben Sie recht. Aber geben Sie auch zu, daß meine Pflicht mir verbietet, Ihnen diesen Anlaß zu nennen.“
„Das läßt sich hören. Jetzt ist alles gesagt. Aber wenn Ihre Pflicht Sie nötigt, mir den Grund Ihres Stimmungsumschlages zu verschweigen, so erfordert diese Pflicht ebenso gebieterisch, daß Sie sich nichts merken lassen. Das Zartgefühl schreibt zuweilen einem höflichen Menschen vor, gewisse Gefühle zu verbergen, wodurch er oder sonst jemand bloßgestellt werden könnte. Dadurch wird dem Geist ein Zwang auferlegt; aber das ist gut, wenn infolgedessen derjenige, der sich den Zwang auferlegt, liebenswürdiger wird.“
Diese außerordentlich logische Auseinandersetzung machte mich vor Scham erröten. Ich preßte meine Lippen auf diese schöne Hand und gab mein Unrecht zu.
„Ich würde“, rief ich aus, „Ihnen zu Füßen fallen, Sie um Verzeihung zu bitten, wenn ich dies tun könnte, ohne Sie bloßzustellen.“
„Also sprechen wir nicht mehr davon!“ sagte sie. Gerührt von meiner schnellen Bekehrung, warf sie mir einen Blick zu, in welchem so volle Verzeihung lag, daß ich mein Vergehen nicht schlimmer zu machen glaubte, wenn meine Lippen ihre Hand verließen, um den schönen lachenden Mund heimzusuchen.
Ich war trunken vor Glück. Aus meiner Traurigkeit wurde Fröhlichkeit und zwar so plötzlich, daß beim Abendessen der Advokat hundert Scherze über mein Zahnweh machte und über den Spaziergang, der mich geheilt hätte.
Am nächsten Tage aßen wir in Velletci zu Mittag; von dort fuhren wir bis nach Marino, unserm Nachtquartier. Obgleich viele Truppen dort lagen, erhielten wir doch zwei Zimmerchen und ein sehr gutes Nachtessen.
Mit meiner reizenden Römerin stand ich mich aufs beste; ich hatte zwar nur ein flüchtiges Pfand von ihr erhalten, aber es war so aufrichtig, so zärtlich gewesen. Unsere Augen sagten sich während der Wagenfahrt nur wenig, aber da ich ihr gegenübersaß, so war die Sprache unserer Füße um so beredter.
Der Advokat hatte mir erzählt, er gehe wegen einer kirchlichen Angelegenheit nach Rom und werde dort bei seiner Schwiegermutter wohnen, die seine Frau gerne wiedersehen wolle, da sie in den zwei Jahren seit ihrer Verheiratung nicht zusammengewesen seien. Seine Schwester gedenke in Rom zu bleiben, da sie einen Angestellten von der Bank zum Heiligen Geist heiraten werde. Ich erhielt ihre Adresse und eine Einladung, sie zu besuchen, und ich versprach, ihnen jeden Augenblick zu widmen, den meine Geschäfte mir übriglassen würden.
Wir waren beim Nachtisch. Da sagte meine Schöne, nachdem sie meine Tabaksdose bewundert hatte, zu ihrem Mann, sie habe große Lust, eine ebensolche Dose zu besitzen.
„Ich werde dir eine kaufen, meine Liebe.“
„Kaufen Sie doch diese!“ sagte ich ihm; „ich gebe sie Ihnen für zwanzig Unzen gegen eine Anweisung auf Sicht, die Sie mir ausstellen werden. Ich schulde diese Summe einem Engländer, und es wäre mir sehr angenehm, auf diese Weise meiner Verpflichtung gegen ihn nachkommen zu können.“
„Ihre Dose, Herr Abbate, ist die zwanzig Unzen wert; aber ich will sie Ihnen nur unter der Bedingung abkaufen, daß ich sofort bar bezahle. Wenn Ihnen dies recht ist, so wäre es mir äußerst lieb, die Dose im Besitz meiner Frau zu sehen, für die sie zugleich ein Erinnerungszeichen von Ihnen sein würde.“
Als seine Frau sah, daß ich auf diesen Vorschlag nicht eingehen wollte, sagte sie, ihr würde es ganz und gar nicht darauf ankommen, mir die gewünschte Anweisung auszustellen.
„Ei, siehst du denn nicht“, versetzte der Advokat, „daß dieser Engländer nur in der Einbildung des Herrn Ahbate vorhanden ist? Er würde niemals erscheinen, und wir würden die Dose für umsonst behalten. Hüte dich, meine Liebe, vor diesem Abbate! Er ist ein großer Schelm.“
„Ich glaubte nicht“, erwiderte seine Frau, indem sie mich dabei ansah, „daß es Schelme solcher Art auf der Welt gäbe!“
Ich machte ein trauriges Gesicht und sagte, ich möchte gerne so reich sein, um recht oft solche Schelmenstreiche machen zu können.
Wenn ein Mensch verliebt ist, genügt ein Nichts, um ihn in Verzweiflung zu stürzen oder auf den Gipfel der Freude zu erheben. In dem Zimmer, worin wir aßen, stand nur ein Bett, und ein zweites in einer anstoßenden Kammer ohne Tür. Die Damen wählten natürlich die Kammer, und der Advokat legte sich zuerst in das Bett, das wir miteinander teilen sollten. Sobald die Damen zu Bett waren, wünschte ich ihnen gute Nacht, warf meinem Abgott noch einen Blick zu und legte mich ebenfalls nieder. Ich hatte die Absicht, die ganze Nacht schlaflos zu verbringen. Aber man denke sich meinen Ärger, als ich beim Hinlegen ein Krachen des Bettgestells hörte, wovon ein Toter hätte aufwachen können. Ich warte indessen unbeweglich, bis mein Kamerad tief eingeschlafen ist, und als ein gewisses Geräusch mir verkündet, daß er gänzlich unter Morpheus’ Bann sich befindet, versuche ich aus dem Bett zu Schlüpfen. Aber der Spektakel, den die kleinste Bewegung hervorruft, weckt den Advokaten auf; er fährt empor und streckt seine Hand nach mir aus. Als er fühlt, daß ich noch da bin, schläft er wieder ein. Eine halbe Stunde darauf mache ich den gleichen Versuch noch einmal; ich stoße auf dieselben Hindernisse und gebe nun alle Absichten auf.
Amor ist der größte Spitzbube unter den Göttern; der Widerspruch scheint sein Element zu sein. Aber da seine Leistung davon abhängt, daß die Wesen, die ihm glühende Verehrung zollen, befriedigt werden, so läßt grade in dem Augenblick, wo jede Hoffnung erloschen zu sein scheint, der hellsichtige kleine Blinde alles gelingen.
Am Erfolg verzweifelnd begann ich eben einzuschlafen, da erscholl plötzlich ein furchtbarer Lärm. Gewehrfeuer und gellendes Geschrei auf der Straße; Menschen stürmen treppauf, treppab; heftig wird an unsere Tür geklopft. Der Advokat fragt mich ganz ängstlich, was wohl los sein möchte. Ich spiele den Gleichgültigen, sage, ich wisse von nichts, und bitte ihn, mich schlafen zu lassen. Aber die erschreckten Damen baten uns, ihnen Licht zu verschaffen. Ich beeilte mich nicht darum; so stand der Advokat auf und lief hinaus, um Licht zu besorgen. Ich stand nach ihm auf, um die Tür zuzumachen; dabei stieß ich etwas zu stark, das Schloß schnappte ein, und ich konnte ohne den Schlüssel die Tür nicht wieder öffnen. Um sie zu beruhigen, begab ich mich zu den Damen und sagte ihnen, der Advokat würde gleich zurückkommen, und dann würden wir erfahren, was der ganze Lärm zu bedeuten hätte. Um aber nichts von der kostbaren Zeit zu verlieren, nahm ich mir so viele Freiheiten, wie ich nur konnte, wobei mich noch die Schwäche des Widerstandes ermutigte. Da ich mich aber trotz aller Vorsicht etwas zu schwer auf meine Schöne gelegt hatte, brach das Bett zusammen, und da lagen wir nun alle drei im schönsten Durcheinander. Der Advokat kommt zurück und klopft an die Tür; die Schwester steht auf; ich gebe den Bitten meiner reizenden Freundin nach, taste mich nach der Tür und sage ihm, ohne den Schlüssel könnten wir ihn nicht hereinlassen. Die beiden Schwestern stehen hinter mir, ich strecke die Hand aus; diese wird kräftig zurückgestoßen, und ich merke, daß ich an die Schwester geraten bin. So wende ich mich nach der anderen Seite und habe da mehr Erfolg. Der Gatte war wieder zurückgekehrt und ein Schlüffelbund klirrte; so mußten wir denn alle drei uns wieder zu Bett legen.
Sobald die Tür offen war, eilte der Advokat an das Bett der armen erschrockenen Damen, um sie zu beruhigen. Aber er lachte laut auf, als er sie in ihrem zusammengebrochenen Bett vergraben sah. Er rief mir, ich solle mir das ansehen; aber ich war bescheiden und unterließ es. Hierauf erzählte er uns, der Lärm rühre davon her, daß ein deutsches Streifkorps die im Orte liegenden spanischen Truppen überfallen habe und daß diese sich fechtend zurückziehen. Eine Viertelstunde darauf war nichts mehr zu hören, und die Ruhe war vollkommen wieder hergestellt.
Nachdem er mir ein Kompliment über meine unerschütterliche Ruhe gemacht hatte, ging der Advokat wieder zu Bett und war bald eingeschlafen. Ich aber schloß absichtlich kein Auge mehr; beim ersten Morgengrauen stand ich auf, um mich ahzuwaschen und die Wäsche zu wechsln. Dies war höchst notwendig.
Zum Frühstück erschien ich wieder, und während wir den köstlichen Kaffee tranken, den Donna Lucrezia an diesem Tage, glaube ich, noch besser gemacht hatte als sonst, bemerkte ich, daß ihre Schwester mit mir schmollte. Aber welchen geringen Eindruck machte auf mich ihre kleine Verdrießlichkeit im Vergleich mit dem Entzücken, das die fröhliche Miene und der dankbare Blick meiner wundervollen Lucrezia mir durch alle Adern goß.
Wir kamen in Rom sehr zeitig an. In Torre hatten wir haltgemacht, um zu frühstücken, und da der Advokat bei fröhlicher Laune war, so schlug ich denselben Ton an, sagte ihm tausend freundliche Dinge, prophezeite ihm die Geburt eines Sohnes und nötigte scherzend seine Frau, ihm dies zu versprechen. Ich vergaß auch nicht die Schwester meiner anbetungswürdigen Lucrezia, und um sie zu meinen Gunsten umzustimmen, sagte ich ihr so viele hübsche Komplimente und bezeigte ihr eine so freundschaftliche Teilnahme, daß sie sich gezwungen sah, mir den Zusammenbruch des Bettes zu verzeihen. – Als wir uns trennten, versprach ich ihnen einen Besuch für den übernächsten Tag.
So war ich also in Rom, gut mit Kleidern, leidlich mit Geld versehen und im Besitze wertvoller Schmuckgegenstände. Ich besaß einige Erfahrung, hatte gute Empfehlungsbriefe, war vollkommen mein eigener Herr und stand in einem Alter, wo ein Mensch auf Glück rechnen kann, wenn er ein wenig Mut hat und ein Gesicht, das die Personen, mit denen er in Berührung kommt, zu seinen Gunsten einnimmt. Ich war nicht schön, aber ich hatte etwas an mir, was mehr wert ist, ein schwer zu erklärendes Etwas, das unwillkürlich Wohlwollen erregt, und ich fühlte mich zu allem fähig. Ich wußte, daß Rom die einzige Stadt ist, wo jemand, der aus dem Nichts hervorgeht, es zum Höchsten bringen kann. Dieser Gedanke spornte meinen Mut und, ich muß gestehen, ein schrankenloses Selbstbewußtsein, dem ich noch nicht mißtraute, weil ich noch keine Erfahrung hatte, erhöhte ganz beträchtlich meine Zuversicht.
Wer in der alten Hauptstadt der Welt sein Glück zu machen berufen ist, der muß ein Chamäleon sein, dessen Haut in allen Farben der ihn umgebenden Luft zu schillern vermag, er muß ein Proteus sein, der alle Gestalten anzunehmen weiß. Geschmeidig muß er sein, einschmeichelnd, falsch, undurchdringlich, oft niedrig, voll hinterlistiger Offenherzigkeit; stets muß er sich stellen, weniger zu wissen, als er wirklich weiß; er muß nur einen Ton der Stimme haben, muß geduldig sein, seine Gesichtszüge in Gewalt haben, kalt wie Eis sein, während ein anderer an seiner Stelle auflodern würde. Fehlt ihm unglücklicherweise die Religion des Herzens – was bei einem Charakter der geschilderten Art anzunehmen ist – so muß er verstandesmäßig religiös sein und muß friedfertig, wenn er ein ehrlicher Mann ist, die Kränkung ertragen, sich selber als Heuchler anerkennen zu müssen. Verabscheut er ein solches Verhalten, so muß er Rom verlassen und anderswo sein Glück zu machen suchen. Er gehe nach England. Ich weiß nicht, ob ich mich damit rühme oder mich beschuldige: von allen diesen Eigenschaften besaß ich nur jene Gefälligkeit, die alleinstehend ein Fehler ist. Im übrigen war ich nur ein interessanter Brausekopf, ein ganz gutes Rassepferd, das noch nicht oder – was schlimmer ist – schlecht zugeritten war.
Zu allererst überbrachte ich Don Lelics Brief dem Vater Georgi. Dies war ein gelehrter Mönch, der die Achtung der ganzen Stadt besaß und auf den der Papst selber große Stücke hielt, weil er die Jesuiten nicht liebte und keine Maske anlegte, um ihnen die Maske vom Gesicht zu reißen. Doch hielten die Jesuiten sich für stark genug, ihn verachten zu können.
Nachdem er mit großer Aufmerksamkeit den Brief gelesen hatte, sagte er mir, er sei bereit, mein Berater zu werden; es hänge also nur von mir ab, ihn dafür verantwortlich zu machen, daß mir kein Unheil widerfahre; denn wer sich gut betrage, habe kein Unglück zu befürchten. Er fragte mich hierauf, was ich in Rom anfangen wolle, und ich antwortete ihm, ich hoffe, daß er mir dies sagen werde.
„Das kann wohl sein, aber damit ich dazu imstande sei, besuchen Sie mich oft und verheimlichen Sie mir nichts, aber auch gar nichts von allem, was Sie angeht und was Ihnen begegnet.“
Ich sagte ihm nun, Don Lelio habe mir auch einen Brief für den Kardinal Acquaviva gegeben.
„Dazu wünsche ich Ihnen Glück; denn der ist in Rom mächtiger als der Papst.“
„Soll ich ihm den Brief sofort überbringen?“
„Nein; ich sehe ihn heute abend und werde ihn benachrichtigen. Besuchen Sie mich morgen; ich werde Ihnen sagen, wo und wann Sie den Brief bestellen müssen. Haben Sie Geld?“
„Auf mindestens ein Jahr genug für meinen Unterhalt.“
„Ausgezeichnet. Haben Sie Bekannte hier?“
„Niemand.“
„Machen Sie keine Bekanntschaften, ohne mich um Rat zu fragen; vor allen Dingen besuchen Sie keine Kaffeehäuser und Speisewirtschaften, und wenn Sie doch hingehen wollen, so hören Sie und sprechen Sie nicht. Seien Sie vorsichtig, wenn man Sie ausfragt, und wenn Sie aus Höflichkeit antworten müssen, so geschehe es ausweichend, falls es sich um etwas von Belang handelt. Sprechen Sie französisch?“
„Kein Wort.“
„Schade. Sie müssen es lernen. Haben Sie Ihre Studien gemacht?“
„Mangelhaft. Aber ich bin soweit infarinato, daß ich in Gesellschaft meinen Mann stelle.“
„Das ist ganz gut; aber seien Sie auf der Hut: Rom ist die Stadt der infarinati, die sich gegenseitig zu entlarven suchen und fortwährend sich in den Haaren liegen. Ich hoffe, wenn Sie dem Kardinal Ihren Brief überbringen, sind Sie als bescheidener Abbate gekleidet und tragen nicht diesen eleganten Anzug; denn der ist nicht dazu angetan, das Glück zu Ihren Gunsten zu beschwören. Also addio; auf morgen!“
Sehr befriedigt von dem Empfang, den ich bei dem Mönch gefunden und von dem, was er mir gesagt hatte, entfernte ich mich und begab mich nach dem Campo de’ fiori, um den Brief meines Vetters Don Antonio an Don Gasparo Vivaldi zu bestellen. Der prächtige Mensch empfing mich in seiner Bibliothek, wo er sich mit zwei ehrwürdigen Abbaten befand. Nachdem er mich aufs liebenswürdigste begrüßt hatte, fragte er mich nach meiner Adresse und lud mich für den folgenden Tag zum Mittagessen ein. Er sprach mit höchstem Lob vom Vater Georgi, und als er mich zum Abschied bis an die Treppe geleitete, sagte er mir, er würde mir am anderen Tage die Summe übergeben, die Don Antonio ihn beauftragte, an mich auszuzahlen.
Also noch ein Geldgeschenk, das mein freigebiger Vetter mitmachte. Es ist nicht schwer zu geben, wenn man die Mittel dazu hat; aber auf die rechte Art zu geben, das ist eine Kunst, die nicht jeder versteht. Ich bewunderte an Don Antonios Vorgehen weniger noch seine Großmut als sein Zartgefühl. Ich konnte und durfte seine Gabe nicht zurückweisen.
Als ich aus dem Hause trete, laufe ich unversehens dem Bruder Steffano in die Arme. Der sonderbare Kauz war immer noch der gleiche; er bezeigte mir auf tausenderlei Art seine Freude. Im Grunde verachtete ich ihn, aber ich konnte ihm nicht böse sein; denn ich mußte in ihm das Werkzeug sehen, dessen die Vorsehung sich bedient hatte, um mich vor dem Sturz in den Abgrund zu bewahren.
Er erzählte mir, er habe vom Papst alles erlangt, was er gewünscht; dann sagte er, ich solle mich hüten, dem bewußten Sbirren zu begegnen, der mir die zwei Zechinen geliehen habe, er wisse, daß ich ihn getäuscht habe, und wolle sich rächen. Ich sagte ihm, er solle veranlassen, daß mein Schuldschein bei einem ihm bekannten Kaufmann hinterlegt werde; dort werde ich ihn einlösen. So wurde es denn auch gemacht, und damit war alles erledigt.
Abends aß ich in einem Speisehaus mit Römern und Fremden zusammen; ich beobachtete sorgsam alle Vorschriften, die mir Vater Georgi gegeben hatte. Man schimpfte gewaltig über den Papst und den Kardinal-Minister, der daran schuld sei, daß der Kirchenstaat von achtzigtausend Mann fremder Truppen, Spanier wie Deutscher, überschwemmt sei. Am meisten aber überraschte mich, daß man Fleisch aß, obgleich es Samstag war. Übrigens erlebt man in Rom während der ersten Tage Überraschungen, an die man sich sehr schnell gewöhnt. Es gibt keine katholische Stadt, wo in religiösen Dingen so wenig Zwang ausgeübt wird. Die Römer gleichen den Angestellten beim Tabaksmonopol, die soviel umsonst nehmen dürfen, wie sie wollen. Man lebt dort in der größten Freiheit, abgesehen von den Ordini santissimi, die eben so sehr zu fürchten sind, wie es in Paris die berüchtigten lettres de cachet vor der Revolution waren.
Am nächsten Tage, den 1. Oktober 1743, entschloß ich mich, mich rasieren zu lassen. Mein Flaum war Bart geworden, und ich hielt es für zeitgemäß, auf gewisse Vorrechte des Jünglingsalters zu verzichten. Ich kleidete mich vollständig auf römische Art, die meines lieben Vetters Schneider sehr gut getroffen hatte; Vater Georgi war erfreut, mich in diesem Aufzug zu sehen.
Er lud mich zunächst ein, mit ihm eine Tasse Schokolade zu trinken; hierauf sagte er mir, der Kardinal sei schon durch einen Brief von Don Lelio benachrichtigt worden, und Seine Eminenz werde mich gegen Mittag in der Villa Negroni empfangen, wo sie einen Spaziergang machen wolle. Ich erzählte ihm, ich sei bei Herrn Vivaldi zum Essen eingeladen, und er riet mir, diesen recht oft zu besuchen.
Ich begab mich nach der Villa Negroni, und sobald mich der Kardinal bemerkte, blieb er stehen, um mir meinen Brief abzunehmen, während er zwei Herren, die bei ihm waren, weitergehen ließ. Er steckte den Brief in die Tasche, ohne ihn zu lesen, sah mich zwei Minuten lang an und fragte mich dann, oh ich Neigung für politische Angelegenheiten in mir verspüre. Ich antwortete ihm, bis jetzt hätte ich nur für nichtige Dinge Interesse gehabt; ich könne ihm nur für den größten Eifer bürgen, womit ich alle Befehle Seiner Eminenz ausführen würde, wenn er mich für würdig hielte, in seine Dienste zu treten.
„Kommen Sie“, sagte er, „morgen in meine Kanzlei und sprechen Sie mit dem Abbate Gama, dem ich meine Absichten mitteilen werde. Sie müssen sich bemühen, recht schnell Französisch zu lernen; die Sprache ist unentbehrlich.“
Hierauf erkundigte er sich, wie es Don Lelio gehe, reichte mir seine Hand zum Kuß und entließ mich.
Ich ging, ohne Zeit zu verlieren, zu Don Gasparo, bei dem ich in auserwählter Gesellschaft speiste. Er war unverheiratet und hatte keine andere Leidenschaft als für die Literatur. Er liebt die lateinische Poesie noch mehr als die italienische, und Horaz, den ich auswendig wußte, war sein Lieblingsdichter. Nach dem Essen gingen wir in sein Kabinett, wo er mir für Rechnung Don Antonios hundert römische Taler auszahlte und mir versicherte, ich würde ihm ein wirkliches Vergnügen bereiten, so oft ich mit ihm in seiner Bibliothek die Morgenschokolade trinken wollte.
Von Don Gasparo lenkte ich meine Schritte zur Minerva, ungeduldig, die Überraschung meiner Lucrezia und ihrer Schwester Angelica zu sehen. Ich fragte nach ihrer Mutter, Donna Cecilia Monti, und sah mit Erstaunen eine junge Witwe, die wie eine Schwester ihrer reizenden Töchter aussah. Ich brauchte nicht meinen Namen zu nennen; ich war angemeldet, und sie erwartete mich. Ihre Töchter kamen herein, und ihr Empfang bereitete mir einen angenehmen Augenblick, denn sie erkannten mich kaum wieder. Donna Lucrezia stellte mir ihre erst elf Jahre alte jüngere Schwester vor sowie ihren Bruder, einen bildhübschen Abbate von fünfzehn Jahren. Ich beobachtete sorgfältig eine Haltung, die der Mutter gefiel: ich war bescheiden, ehrfurchtsvoll und bezeigte die lebhafteste Teilnahme für alles, was ich sah. Der gute Advokat kam hinzu; er war überrascht, in mir einen ganz neuen Menschen zu sehen, aber er fühlte sich geschmeichelt, daß ich noch nicht vergessen hatte, ihn Väterchen zu nennen. Er machte allerlei scherzhafte Bemerkungen, auf die ich einging; doch achtete ich darauf, ihnen nicht jenen Anstrich von Lustigkeit zu geben, über die wir im Wagen so viel gelacht hatten. Er machte mir infolgedessen das Kompliment, den Bart, den ich mir habe abnehmen lassen, habe mein Geist und Verstand erhalten. Donna Luerezia wußte nicht, was sie von meiner veränderten Stimmung denken sollte.
Gegen Abend sah ich nach und nach fünf oder sechs weder schöne noch häßliche Damen erscheinen, und ebensoviel geistliche Herren, die mir wie Bücher vorkamen, mit deren Studium ich meinen Aufenthalt in Rom beginnen mußte. Die Herren hörten aufmerksam auf meine unbedeutendsten Bemerkungen, und ich richtete diese so ein, daß sie nach Belieben ihre Mutmaßungen darüber anstellen konnten. Donna Cecilia sagte zum Advokaten, er sei ein guter Maler, aber seine Bildnisse seien nicht ähnlich. Er antwortete, sie sehe das Porträt nur mit Maske, und ich tat, als sei ich durch die Bemerkung gekränkt. Donna Lucrezia sagte, sie finde mich völlig unverändert, und ihre Schwester bemerkte, die römische Luft gebe den Fremden ein ganz besonderes Aussehen. Dieser Ausspruch fand allgemeinen Beifall, über den Angelica vor Freude errötete. Nach vier Stunden entschlüpfte ich; der Advokat aber ging mir nach und sagte mir, seine Schwiegermutter wünsche, daß ich Freund des Hauses werde und ohne Zwang zu allen Stunden bei ihr verkehre. Ich dankte ihm herzlich und entfernte mich mit dem Wunsche, der reizenden Gesellschaft ebensosehr gefallen zu haben, wie sie mich entzückt hatte.
Am anderen Morgen stellte ich mich dem Abbate Gama vor. Er war ein Portugiese von etwa vierzig Jahren mit hübschem Gesicht, dessen Züge Aufrichtigkeit, Fröhlichkeit und Geist ausdrückten. Nach Benehmen und Sprache konnte er für einen Römer gelten. Er sagte mir mit zuckersüßen Worten, Seine Eminenz selber habe dem Haushofmeister seine Weisungen in bezug auf mich gegeben; ich würde im Palast selbst wohnen und mit den Sekretären zusammen essen. Bis ich Französisch gelernt hätte, sollte ich, ohne mir dabei Zwang anzutun, zur Ubung Auszüge aus Briefen machen, die er mir geben würde. Hierauf sagte er mir die Adresse des Sprachlehrers, mit dem er schon gesprochen hatte; es war ein römischer Advokat, namens Dalacqua, der dem spanischen Palast gerade gegenüber wohnte.
Nachdem er mir diese kurze Unterweisung gegeben und mir versichert hatte, daß ich auf seine Freundschaft rechnen könne, ließ er mich zum Haushofmeister fahren. Ich mußte in einem großen Buch meinen Namen unten auf eine Seite schreiben, auf der schon viele andere Namen standen; hierauf zählte er mir sechzig römische Taler als Gehalt für drei Monate im voraus auf. Dann rief er einen Lakai und ging mit mir nach dem dritten Stock in die für mich bestimmte sehr sauher eingerichtete Wohnung. Beim Fortgehen übergab der Bediente mir den Schlüssel und sagte mir, er werde jeden Morgen kommen, um mich zu bedienen, und der Haushofmeister begleitete mich bis an das Haustor, um mich dem Türhüter bekannt zu machen. Ich ging in meinen Gasthof und ließ mein bißchen Gepäck in den Palazzo di Spagna bringen. So fand ich mich in einem Hause untergebracht, worin ich ohne allen Zweifel ein glänzendes Glück gemacht haben würde, hätte ich nur ein Verhalten beobachten können, das zu sehr in Widerspruch mit meinem Charakter stand. Volentem ducit, nolentem trahit. – Den Willfährigen lenkt das Geschick, den Widerstrebenden reißt es mit sich fort.
Wie man sich denken kann, trieb mich das Gefühl zu allererst zu meinem Mentor, Vater Georgi, dem ich genauen Bericht erstattete. Er sagte mir, ich sei auf gutem Wege, und nachdem ich so ausgezeichnet eingeführt worden sei, könne mein Glück nur von meinem eigenen Verhalten abhängen. „Bedenken Sie eins!“ sagte mir der weise Mann; „damit Ihre Führung tadellos sei, müssen Sie sich Zwang auferlegen. Das Unangenehme, das Ihnen vielleicht beschieden ist, wird von keinem Menschen als ein Unglück aufgefaßt oder einer Schicksalsfügung zugeschrieben werden. Dies sind sinnlose Worte. Ihnen allein wird man die ganze Schuld beimessen.“
„Ich sehe mit Bedauern voraus, hochwürdiger Vater, daß meine Jugend und Mangel an Erfahrung mich nötigen werden, Sie oftmals zu belästigen. Ich fürchte, Ihnen schließlich unbequem zu werden, aber Sie werden mich gelehrig und gehorsam finden.“
„Mich werden Sie oft zu streng finden; aber ich sehe voraus, Sie werden mir nicht alles sagen.“
„Alles, alles ohne Ausnahme!“
„Gestatten Sie mir zu lachen. Sie sagten mir nicht, wo Sie gestern vier Stunden verbracht haben.“
„Ach, der Besuch hat nichts zu bedeuten. Ich habe die Bekanntschaft auf der Reise gemacht, und ich glaube, es ist ein ehrenwertes Haus, das ich besuchen kann, falls Sie mir nicht etwa das Gegenteil sagen.“
„Gott behüte! Es ist ein sehr anständiges Haus, das von ehrenwerten Leuten besucht wird. Man ist erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Sie haben der ganzen Gesellschaft gefallen, und man hofft, Sie werden sich anschließen. Das alles habe ich heute früh erfahren. Aber Sie dürfen in diesem Hause nicht verkehren.“
„Muß ich den Verkehr Knall und Fall aufgeben?“
„Nein. Das wäre unhöflich von Ihnen. Gehen Sie ein- oder zweimal wöchentlich hin, aber seien Sie kein ständiger Gast! Sie seufzen, mein Kind!“
„Nein… auf mein Wort, ich werde Ihnen gehorchen.“
„Ich wünsche, daß Sie mir nicht nur aus Gehorsam folgen, und ich möchte nicht, daß Ihr Herz dabei leidet. Aber Sie müssen es auf alle Fälle besiegen. Erinnern Sie sich, daß die Vernunft keinen größeren Feind hat, als das Herz.“
„Dennoch lassen sich beide in Einklang bringen.“
„Man bildet sich das ein. Aber mißtrauen Sie dem animum Ihres lieben Horaz. Sie wissen es gibt keinen Ausweg: Nisi paret, imperat. – Wenn es nicht gehorcht, befiehlt es.“
„Ich weiß. Aber in jenem Hause läuft mein Herz keine Gefahr.“
„Um so besser für Sie; denn dann kann es Ihnen keine Mühe machen, sich der Besuche zu enthalten. Erinnern Sie sich, daß meine Pflicht es mit sich bringt, Ihnen zu glauben.“
„Und meine, Ihren weisen Rat anzuhören und zu befolgen. Ich werde nur von Zeit zu Zeit zu Donna Cecilia gehen.“
Den Tod im Herzen ergriff ich seine Hand, um sie zu küssen. Er aber drückte mich väterlich an seine Brust, indem er sich abwandte, um mir seine Tränen zu verbergen.
Ich speiste im Spanischen Palast zusammen mit dem Abbate Gama an einer Tafel zu zwölf Gedecken, die für ebenso viele Abbaten bestimmt waren, denn in Rom ist jedermann Abbate oder will dafür gelten. Da es nicht verboten ist, geistliche Tracht anzulegen, so trägt sie jeder, der geachtet werden will, mit Ausnahme von jenem Teil des Adels, der nicht die geistliche Laufbahn eingeschlagen hat.
Vor Kummer vermochte ich während des ganzen Essens nicht den Mund aufzutun, und dieses Schweigen wurde mir als Schlauheit ausgelegt. Nach Tisch lud Abbate Gama mich ein, mit ihm den Tag zu verbringen; ich entschuldigte mich mit dem Vorwande, daß ich Briefe zu schreiben hätte, worauf ich dann aber auch wirklich sieben Stunden hintereinander verwandte. Ich schrieb an Don Lelio, an Don Antonio, an meinen jungen Freund Paolo und an den guten Bischof von Martorano, der mir aus voller Überzeugung antwortete, er möchte wohl an meiner Stelle sein.
Da ich in Lucrezia verliebt und glücklich war, so kam es mir barbarisch vor, sie zu verlassen. Einer glücklichen Zukunft zuliebe sollte ich die Gegenwart morden und Feind meines eigenen Herzens sein. Ich empörte mich gegen diese Notwendigkeit, die mir künstlich konstruiert zu sein schien und die ich nur anerkennen konnte, wenn ich mich vor dem Richterstuhl meiner eigenen Vernunft erniedrigte. Mir schien, Vater Georgi hätte mir, als er mir jenes Haus verbot, nicht zugleich sagen dürfen, daß es ein anständiges Haus sei; mein Schmerz wäre minder groß gewesen. Den ganzen Tag und einen Teil der Nacht verbrachte ich mit solchen Betrachtungen.
Am Morgen brachte Abbate Gama mir ein großes Buch voll von Gesandtschaftsbriefen, aus denen ich zu meiner Unterhaltung Auszüge machen sollte. Ich setzte eine geschäftsmäßige Miene auf und ging aus, um meine erste französische Stunde zu nehmen. Als ich nachher durch die strada condotta ging, um einen Spaziergang zu machen, wurde ich vom Abbate Gama angerufen, der in der Tür eines Kaffeehauses stand. Ich sagte ihm ins Ohr, Minerva habe mir den Besuch der römischen Kaffeehäuser verboten. „Minerva“ antwortete er mir, „befiehlt Ihnen, sich einen Begriff davon zu machen. Setzen Sie sich zu mir!“
Ich hörte einen jungen Abbate ganz laut eine wahre oder erfundene Geschichte erzählen, durch die geradezu, aber ohne Bitterkeit, die Gerechtigkeit des Heiligen Vaters angegriffen wurde. Alle lachten und stimmten bei. Ein anderer antwortete auf die Frage, warum er aus dem Dienst des Kardinals B. ausgetreten sei: es sei geschehen, weil Seine Eminenz behauptete, er brauche ihm gewisse Dienste nicht besonders zu bezahlen. Wieder lautes Gelächter! Ein dritter sagte dem Abbate Gama, wenn er nach Tisch nach der Villa Medici hinauskommen wolle, werde er ihn dort mit zwei kleinen Römerinnen finden, die mit einem quartino zufrieden seien. Dies ist eine Goldmünze im Werte von einer viertel Zechine. Noch ein anderer las ein Sonett voll Feuer und Flamme gegen die Regierung vor, und mehrere schrieben es ab. Wieder ein anderer las eine von ihm gedichtete Satire, worin die Ehre einer Familie vernichtet wurde. Plötzlich sah ich einen Abbate mit einnehmenden Gesichtszügen eintreten. Als ich seine Hüften sah, hielt ich ihn für ein verkleidetes Mädchen und sagte dies zum Abbate Gama. Dieser aber teilte mir mit, es sei ein berühmter Kastrat, namens Beppino della Mamana. Gama rief ihn heran und sagte ihm lachend, ich hätte ihn für ein Mädchen gehalten. Der Schamlose sah mich fest an und sagte, wenn ich Lust hätte, wollte er mir beweisen, daß ich recht oder daß ich unrecht hätte.
Beim Essen sprachen alle Tischgäste mit mir, und ich glaubte ihnen passende Antworten gegeben zu haben. Nach Tische lud Abbate Gama mich ein, den Kaffee auf seinem Zimmer zu trinken, und ich nahm die Einladung an. Sobald wir unter vier Augen waren, sagte er mir, alle Teilnehmer an unserem Mittagstisch seien anständige Leute; hierauf fragte er mich, ob ich glaubte, allgemein gefallen zu haben.
„Das hoffe ich.“
„Sie täuschen sich“, antwortete der Abbate; „bilden Sie sich das nur nicht ein. Sie sind so offenbar allen an Sie gerichteten Fragen ausgewichen, daß ein jeder Ihre Zurückhaltung bemerkt hat. Künftighin wird man Ihnen keine Fragen mehr stellen.“
„Das täte mir leid. Aber hätte ich denn meine Angelegenheiten an die große Glocke hängen sollen?“
„Nein; es gibt überall eine Mittelstraße.“
„Die, von der Horaz spricht. Aber diese ist oft sehr schwer zu gehen.“
„Man muß sich beliebt und zugleich geachtet machen.“
„Ich wünsche nichts Besseres.“
„Heute hatten Sie es mehr auf Achtung als auf Liehe abgesehen. Das ist gewiß recht schön und gut; aber machen Sie sich darauf gefaßt, Sie werden mit Neid und mit dessen Tochter, der Verleumdung, zu kämpfen haben. Wenn diese beiden Ungeheuer Sie nicht zu Boden drücken, so werden Sie als Sieger hervorgehen. Sie haben zum Beispiel Salicetti zerpflückt; er ist Physiker und Corse obendrein. Er muß es Ihnen übel genommen haben.“
„Konnte ich ihm zugeben, daß Gelüste der Frauen niemals den geringsten Einfluß auf die Haut des Fötus haben können? Ich weiß das Gegenteil aus Erfahrung. Sind Sie nicht auch meiner Meinung?“
„Ich bin weder Ihrer noch seiner Meinung; ich habe wohl Kinder mit sogenannten Merkmalen gesehen, aber ich kann nicht bestimmt entscheiden, ob diese Male davon herrühren, daß die Mütter vielleicht während der Schwangerschaft Gelüste gehabt haben.“
„Ich kann darauf schwören.“
„Um so besser für Sie, wenn Sie es so bestimmt wissen, und um so schlimmer für Salicetti, wenn er die Möglichkeit leugnet. Lassen Sie ihn in seinem Irrtum! Das ist besser, als wenn Sie ihm seinen Irrtum nachweisen und sich ihn dadurch zum Feinde machen.“
Am Abend ging ich zu Lucrezia. Man wußte alles und wünschte mir Glück. Sie sagte mir, ich schiene ihr traurig zu sein, und ich antwortete, ich trüge meine freie Zeit zu Grabe, denn ich wäre nicht mehr Herr darüber. Ihr Mann sagte ihr in seiner gewöhnlichen scherzenden Art, ich sei in sie verlieht; und seine Schwiegermutter riet ihm, er solle nur nicht so den Helden spielen. Ich verbrachte nur eine einzige Stunde im Kreise der reizenden Familie. Dann ging ich, von einer Feuersglut durchloht, daß ich mit meinem Atem die Luft entflammte. Zu Hause setzte ich mich an meinen Schreibtisch und brachte die ganze Nacht damit zu, eine Ode zu dichten, die ich am andern Morgen dem Advokaten schickte. Ich wußte, daß er sie seiner Frau geben würde, die für Poesie schwärmte, aber keine Ahnung davon hatte, daß diese auch meine Leidenschaft war. Die nächsten drei Tage enthielt ich mich jedes Besuches bei ihr. Ich lernte Französisch und machte Auszüge aus Gesandtschaftsbriefen.
Bei Seiner Eminenz war jeden Abend Gesellschaft, zu der sich der höchste römische Adel beiderlei Geschlechts einfand; ich ging nicht hin. Gama sagte mir, ich müsse wie er als anspruchsloser Gast hingehen. Ich tat es; niemand sprach ein Wort mit mir, da aber meine Erscheinung unbekannt war, sah mich jeder an, und jeder wollte wissen, wer ich sei. Abbate Gama fragte mich, welche von den anwesenden Damen mir als die liebenswürdigste erscheine; ich zeigte ihm die betreffende, aber es tat mir sofort leid, denn der Höfling hatte nichts Eiligeres zu tun, als zu ihr zu gehen und es ihr zu sagen. Bald darauf betrachtete sie mich durch die Lorgnette und lächelte mir zu. Es war die Marchesa G., deren Verehrer der Kardinal S. C. war.
Am Morgen des Tages, dessen Abend ich bei Donna Luerezia zu verbringen gedachte, kam der ehrenwerte Advokat in mein Zimmer. Er sagte mir, ich irrte mich sehr, wenn ich ihm durch mein Fernbleiben zu beweisen glaubte, daß ich nicht in seine Frau verliebt wäre. Dann lud er mich ein, am nächsten Donnerstag mit ihm und seiner ganzen Familie auf Testaccio einen Imbiß einzunehmen. Er versicherte mir, ich würde dort die einzige Pyramide sehen, die Rom hätte. „Meine Frau weiß Ihre Ode auswendig; sie hat sie Angelicas Bräutigam vordeklamiert, der seitdem den sehnlichen Wunsch hat, Sie kennenzulernen. Er ist ebenfalls Dichter und wird mit uns am Testaccio sein.“
Ich versprach ihm, am bestimmten Tage mit einem zweisitzigen Wagen zu ihnen zu kommen.
Zu jener Zeit waren in Rom die Donnerstage des Oktobermonats der Fröhlichkeit gewidmet. Am Abend war ich beim Advokaten; die Unterhaltung drehte sich nur um das geplante Vergnügen, und ich glaubte zu bemerken, daß Lucrezia ebensosehr darauf rechnete wie ich. Wir hatten keinen bestimmten Plan und konnten keinen haben, aber wir rechneten auf die Liebe und vertrauten stillschweigend auf deren Schutz.
Es lag mir daran, daß Vater Georgi von der geplanten Ausfahr durch niemanden früher erführe als durch mich selber, und ich ging daher zu ihm und bat in aller Form um Erlaubnis, daran teilnehmen zu dürfen. Damit er nichts dagegen einzuwenden hätte, tat ich, als ob mir die Sache völlig gleichgültig wäre. Der wackere Mönch sagte mir denn auch, ich müsse mich unbedingt beteiligen; es sei ja eine Familiengesellschaft; außerdem dürfte ich mich nicht abhalten lassen, die Umgebung von Rom kennen zu lernen und mich auf eine anständige Weise zu erlustigen.
Ich begab mich zu Donna Cecilia in einer geschlossenen zweisitzigen Kutsche, die ich von einem gewissen Roland aus Avignon mietete. Ich nenne ihn hier, weil ich in achtzehn Jahren von ihm werde zu sprechen haben und weil die Bekanntschaft mit ihm wichtige Folgen gehabt hat. Die reizende Witwe stellte mir ihren zukünftigen Schwiegersohn Don Francesco als einen großen Freund der Wissenschaften vor, der auch selber eine gediegene wissenschaftliche Bildung besitze. Ich nahm diese Mitteilung für bare Münze und behandelte ihn dementsprechend; trotzdem fand ich ihn recht schwerfällig, und sein Benehmen war nach meiner Ansicht durchaus nicht so, wie es sich für einen jungen Mann gehört hätte, der binnen kurzer Zeit eine so hübsche Person wie Angelica heiraten sollte. Aber er war ehrenhaft und reich, und das ist mehr wert als ein weltmännisches Benehmen und wissenschaftliche Bildung.
Als wir einsteigen wollten, sagte mir der Advokat, er würde mit mir in meinem Wagen fahren und die drei Damen mit Don Francesco in dem anderen. Ich antwortete ihm ohne Besinnen, er müsse mit Don Francesco fahren und Donna Cecilia müsse mir zufallen; ich wäre entehrt, wenn es anders gemacht würde. Mit diesen Worten bot ich meinen Arm der schönen Witwe, die meine Anordnung den Anstandsregeln der guten Gesellschaft entsprechend fand; ein beifälliger Blick meiner Lucrezia durchdrang mich mit dem angenehmsten Gefühl. Indessen machte die Bemerkung des Advokaten einen peinlichen Eindruck auf mich, denn sie stand in Widerspruch mit seinem früheren Benehmen und besonders mit dem, was er mir auf meinem Zimmer gesagt hatte. „Sollte er eifersüchtig geworden sein?“ fragte ich mich. Dies hätte mich beinahe verdrießlich gemacht, aber die Hoffnung, ihn beim Monte Testaccio auf andere Gedanken zu bringen, zerstreute den Nebel, und ich war liebenswürdig gegen Donna Cecilia.
Über der Spazierfahrt und dem Imbiß, den der Advokat bezahlte, wurde es schnell Abend; die Kosten der Lustigkeit wurden von mir bestritten, und von meiner Liebe zu Lucrezia war nicht ein einziges Mal die Rede; alle meine Aufmerksamkeiten galten ihrer Mutter. Zu Lucrezia sagte ich nur beiläufig ein paar Worte, mit dem Advokaten sprach ich überhaupt nicht. Mir schien, dies sei das beste Mittel, ihm begreiflich zu machen, daß er einen Verstoß gegen mich begangen habe.
Im Augenblick der Abfahrt nahm der Advokat mir Donna Cecilia weg und eilte mit ihr nach dem anderen Wagen, worin Angelica und Don Francesco bereits saßen. Ich konnte kaum meine Freude darüber verbergen, aber ich bot Donna Lucrezia meinen Arm, indem ich ein Kompliment ohne Sinn und Verstand hervorstotterte. Der Advokat lachte herzlich und schien sich viel einzubilden auf den Streich, den er mir gespielt zu haben glaubte.
Wieviel hätten wir uns nicht zu sagen gehabt, ehe wir uns unserer Zärtlichkeit überließen! Aber die Augenblicke waren ja so kostbar. Wir geizten damit, denn wir wußten, daß wir nur eine halbe Stunde vor uns hatten. Wir schwammen in der Trunkenheit des Glücks, da rief plötzlich Lucrezia: „O mein Himmel! wie sind wir unglücklich!“ Sie stößt mich zurück, setzt sich aufrecht, der Wagen hält, und der Diener öffnet den Schlag.
„Was ist denn los?“ frage ich.
„Wir sind zu Hause.“
So oft ich mir den Vorfall in die Erinnerung zurückrufe, erscheint es mir wie ein Märchen; denn es ist doch nicht möglich, daß eine halbe Stunde zu nichts wird – und unsere Fahrt hatte wirklich weniger als einen Augenblick gedauert. Dabei waren die Pferde die miserabelsten Klepper, die man sich denken kann. Aber wir hatten Glück. Die Nacht war finster und mein Engel saß so, daß sie zuerst aussteigen mußte. So ging, dank der Langsamkeit, womit Lucrezia ausstieg, alles vortrefflich, obwohl der Advokat ebenso schnell wie der Lakei am Schlage war. Ich blieb bis Mitternacht in Donna Cecilias Hause.
Sobald ich in meinem Zimmer war, ging ich zu Bett. Aber wie hätte ich schlafen können? In mir brannte die ganze Glut der Flamme, die ich wegen der zu kurzen Entfernung vom Testaccio bis Rom nicht wieder dem Herde hatte zurückgeben können, von dem ich sie empfangen hatte. Sie verzehrte mich. Weh denen, die den Wonnen der Venus auch dann noch Wert beimessen, wenn nicht zwei liebende Herzen in vollkommener Einigkeit ihrer genießen.
Ich stand erst auf, als ich meine französische Stunde nehmen mußte. Mein Lehrer hatte eine hübsche Tochter, Barbara, die während der ersten Zeit immer beim Unterricht anwesend war und mir zuweilen sogar selber noch gewissenhafter als der Vater meine Stunde gab. Ein hübscher junger Mensch, der ebenfalls Unterricht nahm, machte ihr den Hof und wurde von ihr geliebt, wie ich leicht bemerken konnte. Der junge Mann besuchte mich öfter, und ich hatte ihn gern, besonders weil er so verschwiegen war. Denn obwohl er mir auf meine Fragen seine Liebe eingestanden hatte, brachte er geschickt das Gespräch auf ein anderes Thema, so oft ich davon anfangen wollte.
Ich ehrte also sein Geheimnis und hatte seit mehreren Tagen nicht mehr davon gesprochen. Plötzlich aber fiel mir auf, daß ich ihn weder bei mir noch beim Sprachlehrer sah und daß auch das junge Mädchen nicht mehr in meine Stunde kam. Dies machte mich neugierig zu wissen, was da vorgefallen sein möchte, obgleich mich im Grunde die Sache sehr wenig interessierte.
Eines Tages, als ich aus der Messe von San Carlo kam, sah ich den jungen Mann und sprach ihn an. Ich machte ihm Vorwürfe, daß er sich gar nicht mehr sehen ließe. Er sagte mir, ihn verzehre ein bitterer Kummer, er habe den Kopf verloren und sei der Verzweiflung nahe. Die Tränen standen ihm in den Augen; ich wollte weiter gehen, aber er hielt mich zurück. Nun sagte ich ihm, er dürfe mich nicht mehr zu seinen Freunden rechnen, wenn er mir nicht sein Herz eröffnete. Er ging mit mir in den Kreuzgang eines nahen Klosters und erzählte mir folgendes:
„Seit sechs Monaten liebe ich Barbara; seit drei Monaten hat sie mir unbestreitbare Beweise ihrer Liebe gegeben. Die Magd verriet uns, und vor fünf Tagen früh um fünf Uhr überraschte uns der Vater in einer unzweideutigen Situation. Schweigend verließ er das Zimmer, und ich glaubte, mich ihm zu Füßen werfen zu können, um seiner Verzeihung gewiß zu sein. Aber im Augenblick, wo ich vor ihm erschien, packte er mich, schleppte mich an die Haustür und verbot mir, jemals wieder sein Haus zu betreten.“
„Ich kann nicht um ihre Hand anhalten, denn ich habe einen verheirateten Bruder, und mein Vater ist nicht reich; ich habe kein Einkommen, und meine Liebste hat auch nichts. Ach! Sagen Sie mir doch bitte, da ich Ihnen jetzt alles anvertraut habe: wie geht es ihr denn? Gewiß ist sie ebenso unglücklich wie ich. Ich kann ihr keinen Brief zukommen lassen, denn sie verläßt überhaupt das Haus nicht mehr; nicht einmal in die Messe geht sie. O, ich Unglücklicher! Was soll ich anfangen!“
Ich konnte ihn nur bedauern, denn als Ehrenmann durfte ich mich in diese Sache nicht einmischen. Ich sagte ihm, ich hätte sie seit fünf Tagen nicht gesehen. Und da ich nicht wußte, was ich ihm sonst noch sagen sollte, so gab ich ihm den Rat, den in derartigen Fällen alle Dummköpfe stets bei der Hand haben: er möge sie vergessen.
Wir waren inzwischen weitergegangen und befanden uns in der Nähe der Ripettabrücke. Da ich bemerkte, daß er mit stierem Blick auf die Wellen des Tibers sah, so fürchtete ich, er könne irgend etwas Verzweifeltes tun, und sagte, um ihn zu beruhigen, ich wolle mich nach seiner Freundin bei ihrem Vater erkundigen und ihm dann Bescheid geben. Dies Versprechen beruhigte ihn wirklich etwas, und er bat mich, es nicht zu vergessen.
Obgleich seit dem Ausflug nach Monte Testaccio alle meine Sinne lichterloh brannten, hatte ich seit vier Tagen meine Lucrezia nicht gesehen. Ich fürchtete die sanften Vorwürfe des Vaters Georgi und noch mehr, daß er mir vielleicht für die Folge seinen Rat entziehen könnte. Aber meine Sehnsucht war zu groß; ich suchte sie auf, sobald ich meine französische Stunde genommen hatte, und ich fand sie allein, mit trauriger und niedergeschlagener Miene. „Ach!“ sagte sie, als ich bei ihr eintrat, „es ist doch nicht möglich, daß Sie nicht soviel Zeit erübrigen können, mich einmal zu besuchen?“
„Meine zärtliche Freundin, an Zeit mangelt es mir nicht; aber so eifersüchtig bewache ich meine Liebe, daß ich lieber sterben, als sie der Welt kundgeben will. Ich habe daran gedacht, euch alle zum Mittagessen nach Frascati einzuladen. Ich werde euch einen Phaeton schicken und hoffe, daß irgendein glücklicher Zufall unserer Liebe hold sein wird.“
„Ach ja! Tun Sie das, lieber Freund. Ich bin gewiß, Ihre Einladung wird angenommen werden!“
Eine Viertelstunde später kamen die anderen nach Hause und ich lud sie ein, am nächsten Sonntag meine Gäste zu sein. Es war Sankt Ursula, der Namenstag von Lucrezias jüngster Schwester, Ich bat Donna Cecilia, auch sie und ihren Sohn mitzubringen. Mein Vorschlag wurde angenommen; ich sagte ihr, der Phaeton würde um sieben Uhr vor ihrer Tür stehen, und ich würde mit einem zweisitzigen Wagen ebenfalls um diese Stunde da sein.
Am anderen Tag ging ich wieder zu Dalacqua; als ich meine Stunde genommen hatte, sah ich beim Fortgehen Barbaruccia, die aus einem Zimmer nach einem anderen ging. Sie sah mich an und ließ ein Papier fallen. Ich glaubte es aufheben zu müssen, weil eine Magd, die die Treppe herabkam, es leicht hätte sehen und aufheben können. Es war ein Brief, der einen zweiten für ihren Liebhaber enthielt. Der an mich lautete folgendermaßen:
„Wenn Sie einen Fehler zu begehen glauben, indem Sie diesen Brief an Ihren Freund bestellen, so verbrennen Sie ihn. Haben Sie Mitleid mit einem unglücklichen Mädchen und seien Sie verschwiegen.“
Der eingelegte Brief war unverschlossen, er lautete: „Wenn Deine Liebe der meinen gleicht, so hoffst Du nicht, ohne mich glücklich leben zu können. Das einzige Mittel, uns zu sprechen oder zu schreiben, ist das, dessen ich mich zu bedienen wage. Ich bin bereit, rückhaltslos alles zu tun, was uns bis zu unserem Tode vereinigen kann. Überlege und bestimme!“
Die böse Lage des armen Mädchens tat mir in tiefster Seele leid. Trotzdem entschloß ich mich, ihr am nächsten Tage ihren Brief zurückzugeben. Ich legte ihn einem Briefchen bei, worin ich mich entschuldigte, ihr den von mir erwarteten Dienst nicht leisten zu können. Diesen Brief steckte ich in die Tasche.
Am anderen Tage ging ich wie gewöhnlich in meine Stunde; da ich aber Barbara nicht zu sehen bekam, konnte ich ihr den Brief nicht übergeben; ich dachte nun, ich könnte dies auch am nächsten Tage tun. Aber als ich nach Hause kam, trat der arme Liebhaber bei mir ein. Sein Auge flammte, seine Stimme bebte und er schilderte mir seine Verzweiflung in so bewegten Worten, daß ich irgendeine Übereilung befürchtete. Ich glaubte ihm daher den Trost, den ich ihm gewähren konnte, nicht vorenthalten zu dürfen. Er hatte von Selbstmord gesprochen, weil eine innere Stimme ihm sage, das Mädchen müsse sich vorgenommen haben, ihn zu vergessen. Nur der Brief konnte das widerlegen; und so verleitete Schwäche des Herzens mich zum ersten Fehltritt in dieser verhängnisvollen Angelegenheit.
Der arme Mensch las den Brief und las ihn wieder; er küßte ihn voll Entzücken; er weinte, fiel mir um den Hals, dankte mir, daß ich ihm das Leben gerettet hätte, und beschwor mich schließlich, eine Antwort zu befördern, weil doch seine Freundin gleichen Trostes wie er bedürftig sein müsse. Er versicherte mir, sein Brief würde mich ganz gewiß nicht bloßstellen; übrigens könnte ich ihn ja lesen.
Sein Brief war zwar sehr lang, aber er enthielt wirklich weiter nichts als Versicherungen ewiger Treue und chimärische Hoffnungen. Trotzdem hätte ich mich nicht zum Liebespostillon der jungen Leute hergeben dürfen. Ich hätte mir nur zu sagen brauchen, daß Abbate Georgi ganz gewiß nicht mit meiner Gefälligkeit einverstanden gewesen wäre.
Am folgenden Tage fand ich den alten Dalacqua krank; zu meiner Freude sah ich die Tochter an seinem Bett sitzen und glaubte daher, er werde ihr verziehen haben. Sie gab mir die Stunde, ohne das Bett ihres Vaters zu verlassen. Es gelang mir unschwer, ihr die Botschaft ihres Liebsten zuzustecken; sie steckte sie in die Tasche, aber dabei stieg ihr eine solche Glut ins Gesicht, daß sie sich leicht hätte verraten können. Als die Stunde aus war, sagte ich ihnen, am nächsten Tage würden sie mich nicht sehen. Es war der Tag der Heiligen Ursula, einer der jungfräulichen Märtyrerinnen und Königstöchter.
Abends war ich in der Gesellschaft bei Seiner Eminenz, die ich regelmäßig besuchte, obwohl nur selten irgend jemand von Bedeutung mich ansprach. Der Kardinal winkte mich zu sich heran; er sprach mit der schönen Marchesa G., welcher der Abbate Gama gesagt hatte, ich hätte sie für die hübscheste erklärt.
„Die gnädige Frau“, sagte mir der Kardinal auf französisch, „wünscht zu wissen, ob Sie in der französischen Sprache, die sie selber ausgezeichnet spricht, gute Fortschritte gemacht haben.“ Ich antwortete italienisch: ich hätte viel gelernt, getraute mich aber noch nicht zu sprechen.
„Man muß wagen“, sagte die Marchesa zu mir, „aber ohne Ansprüche zu machen. So bleibt man sicher vor Kritik.“
Da ich unwillkürlich dem Wort wagen eine Auslegung gab, an die die Marchesa wahrscheinlich nicht gedacht hatte, stieg mir das Blut ins Gesicht; die schöne Dame merkte es und fing ein anderes Gespräch an. Ich entfernte mich.
Am nächsten Tage war ich um sieben Uhr bei Donna Cecilia. Vor der Türe hielten mein Phaeton und mein Zweisitzer, diesmal ein elegantes Visavis mit weichen Polstern und so vorzüglichen Federn, daß Donna Cecilia den Wagen sehr lobte. „Bei der Rückfahrt nach Rom komme ich daran!“ sagte Lucrezia. Ich machte eine Verbeugung, wie wenn ich sie beim Wort nähme. So forderte sie den Verdacht heraus, um ihn zu zerstreuen! Meines Glückes sicher, überließ ich mich aller meiner natürlichen Heiterkeit. Nachdem ich ein auserlesenes Mahl bestellt hatte, gingen wir aus, um die Villa Ludovisi zu besichtigen, und da es leicht möglich war, uns zu verlaufen, so verabredeten wir, daß wir uns um ein Uhr im Gasthof treffen wollten. Die zartfühlende Witwe nahm den Arm ihres Schwiegersohnes, Angelica den ihres Bräutigams, und mein köstlicher Anteil war Lucrezia. Ursula und ihr Bruder liefen weg, um zu spielen, und in weniger als einer Viertelstunde war meine schöne Freundin allein mit mir.
„Hast du gehört“, fragte sie mich, „mit welcher Unschuldsmiene ich mir zwei Stunden süßen Alleinseins mit dir gesichert habe? Unser Wagen heißt nicht umsonst Visavis. Wie erfinderisch ist doch die Liebe!“
„Ja, meine anbetungswürdige Freundin, die Liebe hat unsere beiden Herzen verschmolzen und aus ihnen nur ein einziges gemacht. Ich bete dich an, und wenn ich lange Tage dir fern bleibe, so ertrage ich dies nur darum, weil ich mir dadurch den vollen Genuß eines einzigen Tages sichere.“
„Ich hätte es nicht für möglich gehalten; dies ist alles dein Werk; du weißt zuviel für dein Alter, mein Freund!“
„Vor einem Monat, angebetete Freundin, war ich ein unwissender Knabe. Du bist die erste Frau, die mich in die wirklichen Mysterien der Liebe eingeweiht hat. Deine Abreise, Lucrezia, wird mich unglücklich machen, denn ganz Italien kann kein anderes Weib besitzen, das dir gleich käme.“
„Wie? Ich bin deine erste Liebe? Ach, Unglücklicher, du wirst sie nie verwinden! Warum bin ich nicht dein? Auch du bist meines Herzens erste Liebe, und du wirst sicherlich seine letzte bleiben. Glücklich die Frau, die du nach mir liebst! Ich werde nicht eifersüchtig auf sie sein, aber eins macht mir Schmerz: sie wird dich nicht mit einem solchen Herzen lieben wie ich.“
Meine Augen standen voller Tränen; da ließ Lucrezia den ihren freien Lauf, und auf dem Rasen sitzend schlürften wir mit süßesten Küssen ihren Nektar ein. Wie süß sind Tränen der Liebe, wenn man im Rausche gegenseitiger Zärtlichkeit sie schlürft! Ich habe sie in ihrer ganzen Süße gekostet, diese wundervollen Zähren, und ich kann als Sachverständiger bestätigen, daß die alten Physiker recht hatten und die modernen unrecht haben.
In einem Augenblick der Ruhe sah ich sie an, wie sie in der entzückendsten Unordnung neben mir lag, und sagte ihr, wir könnten überrascht werden. „Fürchte das nicht, mein Freund! Wir stehen in der Hut unserer Schutzgeister.“
Aus unseren liebenden Blicken frische Kräfte schöpfend, ruhten wir uns aus, da sah plötzlich Lucrezia nach rechts und rief: „Sieh, mein Herz! Habe ich’s dir nicht gesagt? Ja, unsere Schutzgeister bewachen uns. Ach, wie er uns ansieht! Sein Blick sucht uns zu beruhigen. Sieh diesen kleinen Dämon! In ihm offenbart sich das tiefste Geheimnis der Natur. Bewundere ihn! Ganz gewiß ist er dein Schutzgeist oder der meinige.“
Ich glaubte, sie rede irre.
„Was sagst du, geliebtes Herz? Ich verstehe dich nicht. Was soll ich bewundern?“
„Siehst du denn nicht die schöne Schlange mit der flammenden Haut, die erhobenen Kopfes uns anzubeten scheint?“
Ich sah nun in die Richtung, nach der ihr Finger wies, und bemerkte eine Schlange mit schillernder Haut; sie war etwa eine Elle und sah uns wirklich an. Dieser Anblick machte mir kein Vergnügen, aber ich wollte nicht weniger unverzagt erscheinen als meine Schöne.
„Ist es möglich, meine angebetete Freundin“, rief ich, „daß ihr Anblick dich nicht erschreckt?“
„Ihr Anblick entzückt mich, sage ich dir; ich bin überzeugt, es ist eine Gottheit, die von der Schlange nur die Form oder vielmehr den äußeren Anschein hat.“
„Und wenn sie nun durch das Gras zischend auf dich losführe?“
„Ich würde dich noch fester gegen meinen Busen pressen und würde sie herausfordern, mir etwas Böses anzutun! In deinen Armen kennt Lucrezia keine Furcht. Sieh, da verschwindet sie! Schnell, schnell! Durch ihre Flucht kündigt sie uns an, daß irgendein Unberufener naht, und sagt uns, daß wir uns eine andere Zuflucht suchen müssen, um dort neue Wonnen zu finden. Auf!“
Kaum hatten wir uns erhoben und mit langsamen Schritten uns entfernt, da sahen wir aus einem nahen Baumgang Donna Cecilia und den Advokaten herauskommen. Wir wichen ihnen nicht aus und beeilten uns auch nicht, ihnen entgegenzugehen, sondern taten, als sei es ganz natürlich, daß wir uns begegneten. Ich fragte Donna Cecilia, ob ihre Tochter Furcht vor Schlangen habe.
„Trotz ihrer Klugheit“, antwortete mir die Witwe, „fürchtet sie den Donner so sehr, daß sie vor Angst ohnmächtig wird, und schreit auf, sobald sie die kleinste Schlange sieht. Es gibt hier Schlangen, aber sie braucht sich vor diesen nicht zu fürchten, denn sie sind nicht giftig.“
Mir standen vor Erstaunen die Haare zu Berge, denn diese Worte bewiesen mir, daß ich Zeuge eines wahren Liebeswunders gewesen war. In diesem Augenblick kamen die Kinder dazu, und in zwanglosester Weise trennten wir uns wieder.
„Sage mir, erstaunliches Wesen, entzückendes Weib: was hättest du gemacht, wenn du statt deiner schönen Schlange deinen Gatten und deine Mutter hättest kommen sehen?“
„Nichts! Weißt du denn nicht, daß in solchen feierlichen Augenblicken Liebende nur Liebende sind? Kannst du daran zweifeln, daß ich ganz und gar, mit Leib und Seele dein war?“
Diese Worte Lucrezias waren ein Gedicht; aber sie wußte es nicht. In ihren Blicken, im Ton ihrer Stimme lag lauterste Wahrheit.
„Glaubst du“, fragte ich sie, „daß jemand Verdacht auf uns hat?“
„Mein Mann hält uns nicht für verlieht, oder er mißt gewissen Kleinigkeiten, die die Tugend sich herauszunehmen pflegt, keine Bedeutung bei. Meine Mutter ist klug und errät vielleicht die Wahrheit; aber sie weiß, daß dergleichen sie nichts mehr angeht. Meine Schwester weiß natürlich alles, denn wie hätte sie das zusammengebrochene Bett vergessen können? Aber sie ist vernünftig; außerdem bedauert sie mich. Sie hat keine Ahnung, welcher Art meine Gefühle für dich sind. Ohne dich, mein süßer Freund, wäre ich wahrscheinlich durchs Leben gegangen, ohne je zu wissen, was Liebe ist. Denn was ich für meinen Gatten empfinde… Ich bringe ihm die Gefälligkeit entgegen, zu der mich unser Verhältnis verpflichtet.“
„Und doch ist er recht glücklich, und ich beneide ihn um sein Glück. Er kann dich in seine Arme pressen, so oft er will; kein lästiger Schleier entzieht ihm auch nur einen einzigen deiner Reize.“
„Wo bist du, meine liebe Schlange? Komm schnell. Schütze mich vor den Blicken Unberufener, daß ich den Wünschen meines Angebeteten mich ergebe!“
Den ganzen Morgen sagten wir uns, daß wir uns liebten, und gaben uns wiederholte Beweise davon.
Wir hatten ein leckeres Essen, und während der Mahlzeit war ich der aufmerksamste Kavalier der liebenswürdigen Cecilia. Meine schöne Schildpattdose, die ich mit ausgezeichnetem Tabak gefüllt hatte, machte mehrere Male die Runde. Als gerade Lucrezia, die links von mir saß, sie in der Hand hatte, sagte ihr Mann zu ihr, sie könne mir ihren Ring geben und dafür die Dose behalten. Ich glaubte, der Ring sei weniger wert als die Dose, und sagte schnell, ich nähme ihn beim Wort; aber er war wertvoller. Donna Lucrezia wollte keine Vernunft annehmen; sie steckte die Dose in die Tasche, und so mußte ich denn den Ring behalten.
Beim Nachtisch wurde die Unterhaltung immer lebhafter; plötzlich bat Angelicas Bräutigam um Silentium; er wolle ein Sonett vorlesen, das er mir zu Ehren gedichtet habe. Natürlich mußte ich mich bei ihm dafür bedanken; ich nahm das Sonett, steckte es in die Tasche und versprach ihm, ich wolle eine Erwiderung darauf dichten. Dies entsprach nun nicht eigentlich seinen Wünschen; er glaubte, mir würde der Wetteifer keine Ruhe lassen, ich würde flugs Tinte und Papier verlangen und seinem verdammten Apoll Stunden widmen, die ich einem Gott zu weihen gedachte, den sein Phlegma nur dem Namen nach kannte.
Wir tranken den Kaffee, ich bezahlte den Wirt, und dann drangen wir in die Labyrinthe der Villa Aldobrandini ein.
Wie süße Erinnerungen hat mir dieser Ort hinterlassen! Mir war’s, als sähe ich meine göttliche Lucrezia zum erstenmal. Unsere Blicke glühten, unsere beiden Herzen pochten vor zärtlicher Ungeduld, und eine unbewußte Ahnung leitete uns zum einsamsten Zufluchtsort, den die Hand der Liebe geschaffen zu haben schien, um dort die Mysterien ihres Geheimdienstes zu vollziehen. Dort inmitten eines langen Baumganges und unter dichtem Laub erhob sich eine breite Rasenbank vor einem Dickicht; vor uns schweiften unsere Blicke über eine große Ebene hin; auch nicht ein Kaninchen hätte unbemerkt heranschleichen können. Wir übersahen den Baumgang nach rechts und links in einer Entfernung, daß jede Uberraschung ausgeschlossen war. Unter einer Viertelstunde konnte niemand, selbst wenn er lief, uns erreichen. Nur hier in Dur habe ich einen ähnlichen Platz gesehen. Aber der deutsche Gärtner hat das Rasenbett vergessen. Wir brauchten nicht miteinander zu sprechen; unsere Herzen verstanden sich.
Ohne ein Wort zu sagen, hatten wir, voreinander stehend, bald mit geschickten Händen alle Hindernisse beseitigt und der Natur alle Reize zurückgegeben, die durch lästige Hüllen ihr entzogen werden. Zwei volle Stunden entschwanden in den süßesten Entzückungen. Endlich sahen wir uns befriedigt und entzückt an und riefen aus einem Munde: Liebe, ich danke dir!
Langsam begahen wir uns zu unseren Wagen, unterwegs durch die zärtlichsten Bekenntnisse uns erheiternd. Meine Lucrezia sagte mir, Angelicas Bräutigam sei reich; er besitze ein schönes Haus in Tivoli und werde uns wahrscheinlich einladen, mit ihm einen Ausflug zu machen und dort die Nacht zu verbringen.
„Ich beschwöre die Liebe“, rief sie, „sie möge mir ein Mittel eingeben, diese Nacht ohne Hindernisse zu verbringen, wie ich diesen Glückstag verbracht habe.“ Aber in traurigem Ton fuhr sie fort: „Leider geht der Prozeß, der meinen Mann hierher geführt hat, so gut vonstatten, daß ich eine Höllenangst habe, er erhält das Urteil zu früh!“
Auf der Rückfahrt verbrachten wir zwei Stunden in meinem Visavis. Wir forderten sozusagen die Natur heraus und verlangten von ihr mehr als sie geben konnte: bei der Ankunft in Rom mußten wir den Vorhang herablassen, bevor noch das Stück zu Ende war, in dem wir zu unserer großen Befriedigung die einzigen Mitwirkenden waren.
Etwas ermüdet kam ich nach Hause; aber ein Schlaf, wie man in diesem Alter ihn hat, gab mir meine ganze Kraft wieder, und am Morgen ging ich um die gewöhnliche Zeit in meine französische Stunde.
Die köstlichen Briefe des geistreichen Abbate Galiani erschienen im Herbst 1906, zum erstenmal vollständig übersetzt von Heinrich Conrad und Margherita Conrad, herausgegeben und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Wilhelm Weigand bei Georg Müller in München. (2 Bände, Preis M. 15.–, geb. M. 20,–).
Im Anfang des 1. Kapitels nennnt Casanova diesen nachgeborenen Sohn Marcantonios: Giacomo.
oberflächlich bewandert; wörtlich: mit Mehl eingestäubt