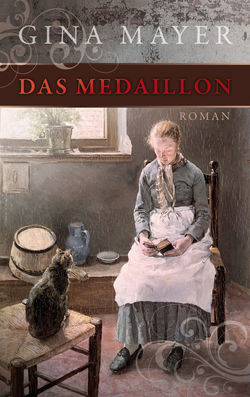Читать книгу Das Medaillon - Gina Mayer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
Оглавление»Nach Untersuchung dieses Gerippes, namentlich des Schädels, gehörte das menschliche Wesen zu dem Geschlecht der Flachköpfe, deren noch heute im amerikanischen Westen wohnen, von denen man in den letzten Jahren noch mehrere Schädel an der obern Donau bei Sigmaringen gefunden hat. Vielleicht trägt dieser Fund zur Erörterung der Frage bei: ob diese Gerippe einem mitteleuropäischen Urvolke oder bloß einer (mit Attila?) streifenden Horde angehört haben.«
(aus einem Artikel im »Barmer Bürgerblatt« vom 9. September 1856)
Dorothea pflückte ein paar Brombeeren vom Strauch und hielt sie in der Hand. Plötzlich verspürte sie das fast unwiderstehliche Bedürfnis, ihre Finger zusammenzupressen und die glänzenden Beeren zu zerquetschen. Aber dann ließ sie die Früchte zu den anderen Beeren in den Korb fallen.
Sie dachte darüber nach, was Rosalie soeben zu ihr gesagt hatte. Dass dieser Fuhlrott auf die Knochen eines Urmenschen gestoßen sei.
Die Knochen eines Urmenschen. Das war ja noch schlimmer als damals die Sache mit den Steinen, die Fuhlrott in der Eifel gefunden hatte und die angeblich mehrere hunderttausend Jahre alt waren. Rosalie hatte Dorothea davon berichtet und Dorothea hatte wiederum ihrer Familie beim Abendbrot davon erzählt. Ihr Vater war außer sich geraten. »Dieser Ketzer, dieser römische Ketzer!«, hatte er getobt, obwohl sie den Namen Fuhlrott gar nicht erwähnt hatte. Dorothea hatte die Augen auf ihren Teller gesenkt und geschwiegen und sich selbst verwünscht, dass sie den Mund nicht hatte halten können.
Abends war ihr Vater dann zu ihr in die Kammer getreten, mit der Bibel in der Hand, sie hatte gerade noch Zeit gehabt, ihr Buch unter dem Kopfkissen verschwinden zu lassen. Sie setzte sich aufs Bett und er setzte sich ihr gegenüber auf den Stuhl, dann schlug er die Schrift auf, das Buch Genesis, und las ihr das Geschlechtsregister von Adam bis Noah und von Sem bis Abraham vor und dann das Geschlechtsregister Esaus und die Könige und Stammesfürsten der Edomiter und schließlich noch einige andere Abschnitte und als ihr schon der Kopf schwirrte von den vielen Namen und Altersangaben und sie sich fragte, ob ihr Vater auf diese Weise das ganze Alte Testament durchgehen wollte, ließ er das Buch sinken und sah sie an.
»Verstehst du?«, fragte er. Sie verstand überhaupt nichts, aber das wollte sie ihm nicht sagen, weil sie befürchtete, dass er dann aufs Neue mit seinem Vortrag beginnen würde. Also nickte sie nur und senkte den Blick.
»Wer Ohren hat zu hören, der höre«, sagte ihr Vater. »Und wer rechnen kann, der rechne. Nach der Heiligen Schrift ist unsere Erde etliche tausend Jahre alt, aber nicht älter, und jeder, der etwas anderes behauptet, stellt sein Wort gegen das des Herrn.« Dann hatte er mit ihr gebetet, und seitdem hatten sie nicht mehr über den Vorfall gesprochen.
So hatte ihr Vater reagiert, als sie nur von altertümlichen Steinen erzählt hatte, und jetzt fing Rosalie sogar von den Skelettresten eines grobschlächtigen Urzeitmenschen an, die dieser verrückte Lehrer gefunden haben wollte. Doch damit wollte Dorothea nichts zu tun haben.
»Aber Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen am sechsten Tag«, sagte sie laut und bestimmt. »In der Bibel steht nichts davon, dass er ihn nach der Erschaffung noch weiter verbessert hat.«
Rosalie pflückte schweigend weiter und Dorothea fragte sich, ob sie die Freundin gekränkt hatte. Rosalie wuchs in einer so ungezwungenen Umgebung auf, ihr Vater ließ sie tun und machen, was sie wollte, so lange sie ihm nur einigermaßen den Haushalt in Ordnung hielt. Schon in der Volksschule hatte ihr ihre freie Art eine Menge Probleme bereitet, dieses Nachfragen und Nachhaken um jeden Preis. Dieses Verlangen, Zusammenhänge zu verstehen, die nicht zu verstehen waren.
Jetzt hätte Dorothea gerne etwas Versöhnliches gesagt, irgendetwas Belangloses, Freundliches, aber ihr fiel nichts ein. Und dann fing Rosalie auch noch von Kirschbaum an. Warum hatte sie ihr nur davon erzählt? Dass sie ihre Eltern hinterging, war schlimm genug. Aber sie hätte die Angelegenheit wenigstens für sich behalten müssen, statt mit Rosalie zu reden, die die Bedeutung dieser Sache ohnehin nie verstehen würde.
Am Montag begann sie ihre Arbeit für Isaak Kirschbaum. Sie betrat den kleinen Laden auf der Alten Freiheit, wie sie ihn unzählige Male zuvor schon betreten hatte: Sie schaute hastig über ihre Schulter, ob sie vielleicht jemand beobachtete, den sie kannte, dann zog sie das Kopftuch tiefer ins Gesicht und ging mit schnellen, kleinen Schritten über die Straße auf die Ladentür zu. Als sie die Tür öffnete, spürte sie die hohen, runden Fenster der Reformierten Kirche hinter sich, wie Augen bohrten sie sich in ihren Rücken. Es war nicht ihre Gemeinde, aber es wäre ihr dennoch lieber gewesen, wenn da ein anderes Gebäude gestanden hätte, nicht ausgerechnet eine Kirche.
Drinnen atmete sie aus und dann tief ein. Wie sie ihn liebte, diesen staubigen, muffigen Geruch nach Papier und die hohen, schmalen Regale, die sich deckenhoch und dicht an dicht drängten. Voller Bücher.
»Wünsche einen guten Morgen«, hörte sie eine vertraute Stimme irgendwo hinter den Regalen, auch das war wie immer.
»Guten Morgen«, gab sie zurück und zog dabei ihr Kopftuch vom Haar und den Mantel aus und das war neu.
Herr Kirschbaum kam zwischen zwei Regalreihen hervor und gab ihr die Hand. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, war sie überrascht darüber, wie klein er war, nur ein wenig größer als sie selbst. »Ich freue mich sehr«, sagte er förmlich. »Hätte nicht gedacht ...«, dann brach er ab, drehte sich um und ging vor ihr her zu dem Schreibtisch, der auf einer kleinen Empore inmitten der Regale stand.
»Hier, das wäre ... das ist Ihr Platz«, begann er. Ihr Blick wanderte zum Fenster, vom Schreibtisch aus konnte man auf die Straße sehen und von der Straße auf den Schreibtisch. Jeder, der vorbeiging, würde sie sehen können, wie sie an diesem Schreibtisch saß und arbeitete.
»Oder, wenn Sie wünschen, dort, im Hinterzimmer«, sagte Kirschbaum, der ihrem Blick gefolgt war.
Den ganzen Vormittag saß sie dort, umgeben von hohen Bücherstapeln, Büchern, die von den Lesern wieder zurückgebracht worden waren und deren Titel sie nun in der Ausleihkartei suchte. Wenn sie die betreffende Karte gefunden hatte, dann strich sie den untersten Namen auf der Liste durch und sortierte die Karte in alphabetischer Ordnung zurück in die Kartei. Und am Ende nahm sie die Bücher und stellte jeden Band zurück an seine Stelle im Regal.
Neben dem Tisch lag ein hoher Stapel mit neuen Büchern, druckfrisch von Verlagen, die sie für den Verleih vorzubereiten hatte, und während sie die Seiten aufschnitt, las sie hier einen Absatz und dort ein Wort, und immer wieder begann ihr Herz schnell und aufgeregt zu schlagen, so sehr freute sie sich, dass sie hier war. Und so sehr schämte sie sich.
Ihre Eltern dachten, dass sie sich um Tante Lioba kümmerte, die oben in der Nordstadt in einem kleinen Häuschen ganz alleine wohnte, aber die man nicht mehr allein lassen konnte, seit sie geworden war wie ein kleines Kind. Aber statt Dorothea ging die alte Walpurga zur Tante und Dorothea gab ihr dafür fast das ganze Geld, das sie bei Kirschbaum verdiente. Einen kleinen Teil gab sie ihr dafür, dass sie auf die Tante aufpasste und für sie kochte und ihr das Haus in Ordnung hielt, und einen größeren Teil gab sie ihr, damit sie den Mund hielt und niemandem davon erzählte.
Um zwölf Uhr ging Kirschbaum in seine kleine Wohnung hinter der Bibliothek und kurze Zeit später zog ein wunderbarer Geruch durch die halb offene Tür in den Raum, in dem Dorothea saß und arbeitete, und sie merkte, dass sie hungrig war. Sie fragte sich, ob es nun an der Zeit war, die Brote herauszuholen, die sie von zu Hause mitgebracht hatte, aber während sie noch darüber nachdachte, hörte sie ein Geräusch. Als sie aufblickte, sah sie Kirschbaum auf der Türschwelle stehen, klein und rundlich und ernst. Seine dunklen Augen unter den dichten Brauen wirkten irgendwie überrascht, als wunderte er sich, sie hier zu sehen.
»Also«, sagte er nach ein paar Sekunden leise. »Das Essen ist fertig.«
Dann drehte er sich um und ging. Sie folgte ihm in eine kleine, dunkle Küche, deren schmales Fenster unter der Decke lag, so dass man nicht hinaussehen konnte. Auf einem winzigen Tisch standen zwei Teller mit Suppe und davor warteten zwei Stühle, er hatte tatsächlich für sie gekocht. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, er sagte auch nichts und setzte sich schweigend hin, also nahm sie auf dem anderen Stuhl Platz. »Einen guten Appetit wünsche ich.« Er nahm den Löffel und begann zu essen.
»Danke«, sagte sie und dann senkte sie die Augen und faltete die Hände unter dem Tisch und sprach lautlos den Segen, weil sie es so gewohnt war. Als sie die Augen wieder aufschlug und ihn ansah, nickte er ihr zu und lächelte, und sie lächelte zurück.
Nach einigen Tagen hörte sie auf, sich morgens heimlich Brote zu machen, denn Kirschbaum kochte jeden Mittag für sie. Dabei hatte er eine Dienstmagd, die ihm den Haushalt machte, die für ihn putzte und wusch, aber das Kochen überließ er ihr nicht. Vielleicht beherrschte sie die komplizierten Regeln nicht, nach denen die Juden ihre Speisen zubereiteten, dachte Dorothea.
»Warum sprechen Sie Ihr Gebet nicht laut?«, fragte er am dritten Tag, nachdem sie vor dem Essen wieder still gebetet hatte. »Es stört mich nicht, im Gegenteil sogar.«
»Nein«, wehrte sie rasch ab. »Es ist nur meine Gewohnheit zu beten.«
»Ich weiß.« Er lächelte. »Nun, ich habe diese Gewohnheit leider verloren, deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie es für mich tun.«
»Aber ich bete doch zu einem anderen Gott«, sagte sie zögernd.
»Ich dachte immer, es gibt nur einen einzigen.«
»Natürlich«, meinte sie schnell und warf ihm von der Seite einen unsicheren Blick zu, um herauszufinden, ob er sich über sie lustig machte. Seine runden Augen waren ruhig und ernst. Ein bisschen traurig wie immer.
Abends nach der Arbeit ging sie immer in die Nordstadt, um bei Tante Lioba nach dem Rechten zu sehen. Der Weg dauerte eine Viertelstunde, sie ging so schnell sie konnte, mit gesenktem Kopf und mit niedergeschlagenen Augen, und hoffte, dass sie keiner sah und ansprach. Aber heute war die Hoffnung vergeblich.
»Wohin rennst du denn?«, fragte eine laute Stimme. Rosalie stand vor der Apotheke am Heckweiher, an einen Laternenpfahl gelehnt, als habe sie auf Dorothea gewartet.
»Ich muss zu Tantchen«, sagte Dorothea.
»Kommst du mit mir in die Apotheke?«, fragte Rosalie. »Ich muss meinem Vater ein paar Dinge besorgen. Hinterher begleite ich dich in die Nordstadt.«
Sie betraten zusammen den dunklen Ladenraum, Rosalie ging mit schwungvollen Schritten auf den jungen Mann hinter der Theke zu und streckte ihm einem Zettel entgegen. »Das ist Fräulein Leder«, stellte sie Dorothea vor.
Der Apotheker reichte Dorothea seine Hand über die Ladentheke. »Minter mein Name. Angenehm.«
Er war groß, sehr groß, Dorothea musste ihren Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht zu blicken. Ein schöner Mann, aber irgendetwas an ihm flößte ihr ein Unbehagen ein. Sie hatte auch das Gefühl, dass sie ihn von irgendwoher kannte, dass sie ihn schon gesehen hatte, nicht nur einmal, sondern oft, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie etwas entgegnen musste. »Angenehm«, stotterte sie.
Die dunklen Augen musterten sie amüsiert. Dann wandte Minter sich Rosalie zu. »Ich habe die Tropfen schon vorbereitet, es dauert nur einen kleinen Moment.« Er ging in den Nebenraum und Dorothea und Rosalie warteten. Während sie auf die Regale starrten, hörten sie plötzlich über sich ein lautes Poltern und dann ein Dröhnen, wie von einem Erdbeben. Dorothea sah Rosalie fragend an, aber diese zuckte nur mit den Schultern. Schließlich kam Minter aus dem Nebenzimmer zurück und reichte Rosalie eine bräunliche Glasflasche.
»Vater sagt, ich soll Sie für den morgigen Abend einladen«, sagte Rosalie. »Dr. Fuhlrott wird auch zugegen sein.«
»Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich der Gebeine?«, fragte der Apotheker.
Dorothea senkte den Blick zu Boden, als hätte er etwas Unzüchtiges gesagt. Diese elenden Knochen.
Rosalie zuckte mit den Schultern. »Fragen Sie ihn selbst.«
»Werden Sie auch da sein?«, fragte Minter.
Rosalie zögerte einen Augenblick, sie drehte die Flasche in ihrer Hand hin und her, dann verzog sie verächtlich ihren großen Mund. »Sicher bin ich dabei, wo sollte ich auch sonst hin.«
Zum Abendbrot gab es Kartoffeln mit saurer Milch und die ganze Familie saß an dem langen Tisch in der Küche, die Eltern und Dorothea und ihre jüngeren Brüder Traugott, Tobias, Matthis und der kleine Hermann. Hermann zerdrückte seine Kartoffel zu einem klumpigen Brei und zog dann mit der Gabel Furchen, so dass die dicke Milch durch die Rinnen floss. Dorothea beugte sich so weit es ging über ihren Teller, damit der Vater vom Tischende aus nicht sehen konnte, dass Hermann spielte anstatt zu essen.
»Die Männer werden morgen Abend gleich nach der Arbeit hier eintreffen und hungrig sein«, sagte Frau Leder. »Es ist vielleicht nicht genug, wenn wir ihnen nur Brot und Griebenschmalz anbieten. Ich werde in der Frühe noch eine Kohlsuppe kochen, das ist sicherlich besser.« Der Satz war keine Frage, dennoch hob sie die Stimme am Ende und sah ihren Mann an, der seine Fingernägel betrachtete.
»Die Gemeinde kommt aber nicht zum Essen, sondern zum Gebet«, meinte er, ohne ihren Blick zu erwidern. »Hungrig soll gewiss keiner gehen, aber Brot und Schmalz stillen den Hunger genauso gut wie Wasser den Durst.« Jetzt blickte er auf und sah so missbilligend aus, als habe sie vorgeschlagen, Bier oder Wein zu reichen.
Frau Leder nickte, dabei legte sie Hermann noch eine Kartoffel auf den Teller und zerstörte so seinen kunstvoll errichteten Dammsee. Dorothea blickte auf das Bild über dem Esstisch, das Jesus zeigte, wie er auf dem See Genezareth über das Wasser wandelte. Sein dunkles Haar fiel in sanften Wellen auf sein weißes Gewand, die warmen, braunen Augen blickten versonnen in die Ferne und plötzlich wusste Dorothea, an wen dieser Apotheker, dieser Minter, sie vorhin erinnert hatte. Mit seinen langen Haaren sah er aus wie Jesus.
Rosalie war so schroff und abweisend zu ihm gewesen, als er sie auf das Treffen in ihrem Haus angesprochen hatte. Ob sie ihn nicht mochte?
Morgen würden sie hier ihre Andacht halten und zur gleichen Zeit würden die beiden Doktoren, dieser Apotheker und Rosalie sich genauso andächtig über diese Knochen beugen und darüber spekulieren, welchem altertümlichen Wesen sie gehört hatten. Und waren sich nicht einmal bewusst, dass sie Gottes heiliges Wort in Frage stellten, dachte Dorothea und fragte sich, ob das die Sache besser machte oder schlimmer.
»Dorothea?« Die Stimme ihres Vaters riss sie aus den Gedanken.
»Ja?«
»Hast du nicht zugehört? Ich sprach von Tante Lioba.«
»Von Tante Lioba?« Ihr Herz setzte einen Schlag aus und begann dann zu rasen.
»Ob du sie morgen mitbringen kannst, zur Andacht.«
»Ich weiß nicht«, meinte Dorothea. »Sie ist ja so verwirrt. Ich weiß wirklich nicht.« Sie schwieg, während sie verzweifelt versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Warum wollte ihr Vater Tante Lioba dabeihaben? Auch früher, als sie noch bei Verstand gewesen war, war sie niemals zu ihren Andachten gekommen. Sie war auch kein Glied der Niederländisch-reformierten Gemeinde. Ahnte er etwas? Wollte er Dorothea am Ende gar auf die Probe stellen? Wie sollte sie sich verhalten?
Er betrachtete wieder seine Hände. »Gut.« Er nickte langsam. »Es werden so viele Leute kommen, auch die Ältesten, und wenn sie unruhig wird und laut, dann kann sich keiner sammeln.«
Dorothea nickte ebenfalls. Ihr Herz schlug jetzt wieder langsamer, weil die Gefahr vorüber war, aber sie fühlte sich schuldig, obwohl sie nichts anderes gesagt hatte als die Wahrheit. Tante Lioba würde ganz ohne Zweifel alles durcheinanderbringen. Aber das war nicht der Grund, warum sie sie nicht dabeihaben wollte. Sie hatte Angst, dass sie sie verraten würde. Und dass dann alle erfuhren, dass Dorothea das vierte Gebot brach und auch das achte, Tag für Tag aufs Neue.
Sie musste damit aufhören, sie musste dieses Doppelleben aufgeben. Aber dann dachte sie wieder an das Halbdunkel in der Bibliothek, an den Geruch von altem Papier und die Stapel neuer Bücher, die auf ihrem Schreibtisch im Hinterzimmer auf sie warteten, und sie spürte ein warmes, fast wollüstiges Gefühl in ihrem Leib und wusste, dass es immer so weitergehen würde, bis es nicht mehr weiterging.
Als sie an den Regalen von A bis Kr vorbei war und ihr kleines Büro fast erreicht hatte, hörte sie die Stimmen. Herrn Kirschbaums Stimme und eine Frauenstimme, die dünn und jämmerlich klang. Sie kamen aus den hinteren Räumen, in denen Kirschbaum lebte, und weil er noch niemals Besuch gehabt hatte, seit sie für ihn arbeitete, hielt sie inne und lauschte. »Ich bitte darum, nur dieses einzige Mal, es ist doch gewiss nicht zu viel verlangt ...«, klagte die Frauenstimme.
Dorothea schüttelte den Kopf über ihre Neugierde und wollte die Tür hinter sich schließen, aber jetzt kam die Frau aus Kirschbaums Wohnung. Sie war viel älter als Dorothea, eine kräftige Person mit hoch aufgetürmtem schwarzen Haar, die ein Taschentuch vor den Mund presste. Ihre runden Schultern hoben und senkten sich in raschem Wechsel. Sie weinte und als sie fast an der Tür vorbei war, wandte sie plötzlich den Kopf und starrte Dorothea an. Ihre schwarzen Augen lagen tief in runzeligen, rot verweinten Höhlen, aber aus diesen Tiefen heraus brannten sie so verächtlich, so hasserfüllt, dass Dorothea die Tür abrupt ins Schloss zog und mit zitternden Beinen an ihrem Tisch Platz nahm.
Was war das für eine Frau? Weshalb war sie so außer sich? Was für ein Geheimnis verbarg Kirschbaum, dieser ruhige, unscheinbare Mann?
Eine Affäre. Die Frau liebte ihn, und er hatte sie abgewiesen. Dorothea runzelte die Stirn. Was für ein Unsinn.
Die Frau war eine Leserin, die ein Buch ausgeliehen und verloren hatte und nun nicht dafür aufkommen wollte. Nein, dachte sie, die Frau hatte nicht verlegen ausgesehen oder ungehalten, sondern richtiggehend verzweifelt.
Sie schob die Gedanken von sich und zog stattdessen eines der Bücher von dem Stapel, der sich links auf ihrem Tisch auftürmte, der Stapel mit den Rückgaben. Sie musste die dazugehörige Karte aus dem Karteikasten holen und das Buch zurückschreiben und dann an seinen Platz ins Regal bringen, in diesem Fall war es das Regal von S bis Sh, denn es handelte sich um William Shakespeares dramatische Werke, übersetzt von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck.
Sie suchte die Karteikarte im Kasten und setzte einen winzigen Haken hinter den Namen des letzten Lesers, der das Werk entliehen hatte, legte die Karte vorne zwischen den Einband und die Titelseite und dann ließ sie das Buch fallen. Sie ließ es nicht absichtlich fallen, es glitt ihr einfach aus den Händen und blieb aufgeschlagen auf dem Boden liegen, mit dem Rücken nach oben wie ein toter Vogel.
Sie hob es schnell wieder auf, pustete den Staub vom Einband und wollte es eben weglegen, als ihr Blick auf die Stelle fiel, an der sich das Buch geöffnet hatte. Es war eine Stelle aus dem Kaufmann von Venedig, und ohne darüber nachzudenken, warum sie es tat, las sie den Satz, den der Daumen ihrer linken Hand unterstrich.
»Shylock:« las sie. »Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht stiehlt.« Und im selben Moment verstand sie und erschrak.
Sie hatte das Stück vor Jahren gelesen und erinnerte sich nicht an alles, aber sie wusste, dass es um zwei Freunde ging, von denen der eine Geld brauchte und der andere borgte es für ihn bei dem reichen Juden Shylock. Und dieser Shylock machte es zur Bedingung, dass er sich ein Pfund Fleisch aus dem Leib des Christenmenschen herausschneiden dürfe, so die Schuld nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden würde. Ein Pfund Fleisch nahe beim Herzen. Das war kein Zufall. Das war ein Zeichen. Dieses Buch. Dieses Stück. Und ausgerechnet dieser Spruch. Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht stiehlt. Und dann die weinende Frau mit den schwarzen Haaren. Und Kirschbaum, der Jude war. Natürlich ging es um Geld, sagte das Zeichen, und ihr gesunder Menschenverstand sagte es auch, wenn sie eins und eins zusammenzählte. Kirschbaums Leihbibliothek warf guten Gewinn ab und nach Judenart verlieh er ihn gegen Zins an andere. Und die Frau konnte ihre Schuld nicht zurückzahlen, deshalb war sie so verzweifelt gewesen.
Dorothea schob das Buch mit spitzen Fingern weg, als wäre es klebrig oder heiß, dann hob sie den Kopf und sah, dass die Tür offen war, die sie vorhin geschlossen hatte, und dass Kirschbaum auf der Schwelle stand und sein stilles, in sich gekehrtes Lächeln lächelte. Sie spürte, wie ihr Gesicht zu glühen begann, als habe er sie bei etwas Verbotenem ertappt. Das Buch lag da, mitten auf dem Schreibtisch, William Shakespeares dramatische Werke, und sie hatte das Gefühl, dass es alles verriet, was sie über ihn wusste, aber das war natürlich Unsinn, es waren doch nur alte Theaterstücke.
Dennoch verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht von einem Moment zum anderen. »Ich bitte um Vergebung, ich war mir nicht bewusst, dass Sie schon da sind, weil die Tür geschlossen war ...«, sagte er förmlich. »Ich habe sie nur zugemacht, weil Sie Besuch hatten«, entgegnete sie ruhig. Sein Gesicht wurde noch ernster. Jetzt wusste er, dass sie wusste, worin sein eigentliches Geschäft bestand, womit er sein Geld verdiente.
Er nickte rasch mehrmals hintereinander, dann wandte er sich wieder zum Gehen. »Soll ich sie nun auflassen oder möchten Sie lieber ungestört ...?«
»Lassen Sie sie ruhig offen «, sagte sie, dann zog sie die Shakespeare-Ausgabe wieder zu sich und begann zu arbeiten.
Als er kurz vor halb zwölf nach hinten ging, um mit dem Kochen zu beginnen, passte sie ihn ab. »Ich muss heute Mittag in die Nordstadt«, sagte sie. »Ich kann ... ich werde also nicht mit Ihnen essen.« Es war ihr unangenehm, dass sie ausgerechnet heute keine Zeit dafür hatte, sie hatte sich tatsächlich schon am Morgen vorgenommen, über Mittag zu Tante Lioba zu gehen und eine Stunde bei ihr zu sitzen, als Ausgleich dafür, dass sie sie abends nicht mit zur Bibelstunde nehmen würde. Aber gleichzeitig war sie auch erleichtert, dass sie nun nicht mit Kirschbaum zusammen sein musste, sie hätte heute bestimmt nicht gewusst, was sie mit ihm reden sollte. Es war ja nichts Verwerfliches, dass er Geld verlieh, so lange er keinen Wucher betrieb. Und dennoch, es führte ihr so deutlich vor Augen, dass Kirschbaum anders war als sie und die Ihren, dass er andere Maßstäbe hatte und andere Werte. Dass er Jude war. Und sie, die Christin, arbeitete heimlich für ihn, ohne die Billigung ihrer Eltern, und half ihm so, seinen Gewinn zu mehren. Sie dachte an den verächtlichen Blick der schwarzhaarigen Frau und schauderte.
»Das ist sehr schade«, sagte Kirschbaum und seine braunen Augen glänzten so traurig, als könne er ihre Gedanken lesen.
Tante Liobas Häuschen auf der Friedrichstraße hinter der Gathe war immer ihr ganzer Stolz gewesen, mit seinem schwarzen Fachwerk und dem Schieferdach, aber jetzt war es in die Jahre gekommen, so wie sie selbst auch. Die Holzbalken krümmten sich, der weiße Putz war grau und porös, an einigen Stellen war er ganz abgeplatzt, so dass der gelbliche Lehm zu Tage trat wie das Innere einer Wunde. Das Dach war schief und wellig, eine alte, schuppige Haut, die sich über einen knochigen Körper spannt. Die anderen Häuser sahen nicht besser aus, sie beugten sich krumm zueinander hin, voneinander weg, die ganze Straße schien inmitten einer taumelnden, schwankenden Bewegung erstarrt zu sein. Auch das Kopfsteinpflaster zwischen den Häusern war alt und holprig, einzelne Steine waren tief im Boden versunken, andere ragten schief und krumm nach oben, und in den Fugen wuchsen Gras und Unkraut.
Bevor die beiden jüngsten Brüder geboren waren, hatten sie alle hier gewohnt, zusammen mit Tante Lioba, aber vor zehn Jahren waren die Leders dann in die Königsstraße gezogen und Tante Lioba war allein zurückgeblieben. Das Haus war zu klein für uns alle, sagten ihre Eltern immer. Aber ihre jetzige Wohnung im Luisenviertel war nicht größer als die obere Etage in Liobas Haus, die sie seit Jahren nicht mehr bewohnte, weil die Treppe schief und schadhaft war und das Dach undicht. Man könnte das obere Stockwerk doch herrichten, hatte Dorothea ihren Eltern vorgeschlagen, damals, als die Verwirrtheiten der Tante anfingen und sich täglich einer auf den Weg machen musste, um nach ihr zu sehen. Von der Friedrichstraße hätten sie es auch viel näher zur Kirche der Niederländisch-reformierten Gemeinde gehabt. Aber ihr Vater hatte nur mit dem Kopf geschüttelt, schnell und unwillig. »Nein, alles ist gut so, wie es ist.«
Jetzt fand auch Dorothea, dass alles gut war, wie es war, denn sonst hätte sie nicht in der Leihbibliothek arbeiten können.
Sie drehte den schweren Schlüssel im Schloss und die Haustür gab mit einem leichten Ächzen nach. Unter ihrer Hand fühlte sich das Holz morsch an, so als könnte sie die Tür ganz einfach eindrücken. »Tante Lioba«, rief sie laut. Und dann: »Walpurga?«
»So früh kommst du heute?« Die alte Walpurga steckte ihren Kopf aus der Stube, sie sah missmutig aus, als habe Dorothea kein Recht, einfach so zu erscheinen, wie und wann es ihr passte.
»Hat sie schon gegessen?«, fragte Dorothea und schob sich an ihr vorbei. Tantchen saß auf ihrem Lehnstuhl am Fenster, sie schaute auf die Straße und schien sie gar nicht zu bemerken. An manchen Tagen benahm sie sich ungebärdig und wild wie ein freches Kind, so dass man sie nicht aus den Augen lassen durfte, und dann saß sie wiederum den ganzen Tag nur da und starrte vor sich hin und gab keinen Ton von sich. Heute war wohl einer ihrer ruhigen Tage.
»Hab ihr was zubereitet, aber sie will ja partout nichts zu sich nehmen«, murrte Walpurga.
Dorothea seufzte und nickte. »Du kannst nun gehen, Walpurga. Wenn du nur um Viertel nach eins wieder hier bist.«
Walpurga starrte sie an und zupfte an den breiten Bändern ihrer Schürze, als habe sie sie nicht verstanden.
»Gibt es noch etwas?«, fragte Dorothea.
Walpurgas Augen wurden ganz schmal, sie öffnete den Mund, aber dann schloss sie ihn wieder.
»Walpurga«, sagte Dorothea, »wenn etwas nicht beim Rechten ist, dann sprich nur frei heraus. Und wenn du die Arbeit mit Tantchen nicht mehr machen willst, weil sie dir zu beschwerlich ist, so muss ich eben eine andere finden, die es übernimmt.«
Sie hatte in einem leisen, sanften Ton gesprochen, aber Walpurga hatte verstanden. »Dann komme ich also kurz nach eins wieder.«
Dorothea holte einen Apfel aus der Küche, dann schob sie einen Stuhl ans Fenster, so dass sie Tante Lioba gegenüber saß, und begann, das Obst zu schälen. Sie schnitt den Apfel danach in feine Streifen und reichte diese der Alten, die einen nach dem anderen zwischen ihren fast zahnlosen Kiefern zerdrückte.
Dorothea dachte an früher, als Tante Lioba noch nicht verrückt gewesen war. Damals hatte sie ihr alles erzählen können, ihre Freude und ihren Kummer und ihre Geheimnisse. Tante Lioba hatte sie verstanden. Sie hatte nie viel gesagt zu dem, was Dorothea ihr erzählte, zwei, drei belanglose Sätze oder manchmal auch gar nichts, dann hatte sie ihr übers Haar gestrichen oder ihre Hand festgehalten und mit ihren rauen Fingern ihre weiche Haut gestreichelt, wieder und wieder. Und diese wenigen Worte, diese spärlichen Gesten fehlten ihr jetzt so, dass sich ihre Brust zusammenzog, wenn sie daran dachte.
»Du hast den Verstand verloren«, sagte sie leise, während sie auf die knotigen Finger der alten Frau blickte, die sich in ihrem Schoß ineinander krampften. »Und ich den Halt.«
Dann musste sie lachen, weil es sich so dumm anhörte. Tante Lioba hob den Kopf und lachte ebenfalls, sie lachte ihr fröhliches, tiefes Lachen, das überhaupt nicht verrückt klang, sondern ganz normal, so wie früher. Daraufhin hörte Dorothea auf zu lachen und fing an zu weinen. Sie dachte an ihre Eltern, die sie belog, an Rosalie, die die Schöpfungsgeschichte leugnete, und an Kirschbaums traurige Augen. Sie weinte eine ganze Weile lang und Tante Lioba hörte ihr aufmerksam dabei zu, ganz so, als erinnerte sie Dorotheas Weinen an etwas, das weit zurücklag und das sie sich wieder ins Gedächtnis rufen wollte. Und während Dorothea weinte, schälte sie die Äpfel und reichte die Schnitze ihrer Tante, die sie zwischen ihre fast zahnlosen Kiefer schob und zermalmte. Aber irgendwann hörte Lioba auf zu essen und beugte sich nach vorn und ergriff Dorotheas Hand, die Hand, die das Apfelmesser festhielt. Dorothea ließ das Messer los und Tante Lioba zog ihre Hand in ihren Schoß und streichelte sie, ein wenig unsicher, aber sonst ganz wie früher.
»Tante Lioba«, schluchzte Dorothea. »Vergib mir, dass ich dich so benutze, aber ich will nun einmal bei Kirschbaum arbeiten und weiß mir sonst keinen anderen Rat. Und vergib mir, dass ich dich nicht mit zur Bibelandacht nehme.«
Tante Lioba hielt Dorotheas Hand in ihrem Schoß fest und streichelte sie mit Daumen und Zeigefinger, während sich ihr Blick wieder nach draußen auf die Straße richtete, und Dorothea fragte sich, ob sie etwas von dem verstanden hatte, was sie gesagt hatte, oder kein Wort davon oder alles.
Seit sie ihr Doppelleben begonnen hatte, traf sie sich morgens nicht mehr mit Rosalie an der Pumpe am Königsplatz, das Wasserholen erledigte jetzt Tobias vor der Schule. Aber heute war Tobias krank und deshalb hastete Dorothea vor der Arbeit mit den Eimern los. Sie war früher unterwegs als sonst, auf dem Platz begannen die Marktfrauen gerade ihre Waren auszubreiten, spannten Schirme auf und wuchteten Holzfässer und Kisten darunter und stapelten Obst, Gemüse und Kartoffeln zu spitzen Pyramiden. Während Dorothea ihre vollen Gefäße im Ziehwagen verstaute, hielt sie nach Rosalie Ausschau, und gerade als sie gehen wollte, bog ihre Freundin um die Ecke.
»Hast du deine Arbeit aufgegeben?«, fragte Rosalie sofort, als sie Dorothea sah.
Dorothea schüttelte den Kopf. »Ich gehe heute etwas später hin.« Rosalie nickte und Dorothea fragte sich wie so oft, ob sie ihr Doppelleben missbilligte oder ob sie sie verstand.
»Wie war eure Andacht gestern Abend?«, erkundigte sich Rosalie und schob dabei ihren Eimer unter die Pumpe.
Dorothea nickte kurz und murmelte etwas Unverbindliches. Als ihre Familie vor einigen Jahren die Reformierte Kirche verlassen hatte und der Niederländisch-reformierten Gemeinde beigetreten war, waren Rosalie und ihr Vater in der ursprünglichen Gemeinde verblieben. Wie viele andere Elberfelder betrachtete Dr. Kuhn Pastor Kohlbrügge mit Skepsis, er hielt seinen leidenschaftlichen Einsatz für die reine protestantische Lehre für übertrieben. »Religion in Maßen, das wollen diese«, pflegte Dorotheas Vater voller Verachtung über Leute wie Kuhn zu sagen. »Aber das gibt es genauso wenig wie Seligkeit in Maßen. Ganz oder gar nicht, das ist die Losung.«
Zu den Abendandachten, die reihum bei den Gliedern der Gemeinde abgehalten wurden, kamen die Familien, die in der Nähe wohnten. Manchmal erschienen zwanzig, mitunter auch nur zehn Leute. Gestern Abend bei den Leders waren jedoch viele, sehr viele Menschen erschienen, dicht an dicht hatten sie sich in der kleinen Stube und in der Küche zusammengedrängt. Die Stapel von Schmalzbroten, die Frau Leder und Dorothea vorbereitet hatten, waren nach der Andacht innerhalb von Sekunden verschwunden, als habe sie ein großer, hungriger Mund auf einmal eingeatmet.
Von den drei Ältesten waren zwei gekommen – Daniel von der Heydt und Friedrich Thiel – und von den Diakonen August Wolf. Nur Pastor Kohlbrügge selbst war nicht dagewesen.
»Es geht ihm nicht gut«, hatte Daniel von der Heydt Herrn Leder erklärt. »Aber er sendet seine herzlichsten Segenswünsche.« Ihr Vater hatte genickt, verständnisvoll und furchtbar enttäuscht.
»Und bei euch?«, fragte Dorothea Rosalie. »Hat sich etwas Neues wegen der Knochen ergeben?« Genau wie Rosalie stellte sie die Frage mehr aus Höflichkeit als aus wirklichem Interesse, und Rosalie schien das zu spüren. Sie musterte sie einen Moment lang aus leicht zusammengekniffenen Augen.
»Hast du es nicht gelesen? Sie haben in der Zeitung über den Fund geschrieben, Fuhlrott war äußerst erbost darüber.«
Bei den Leders wurden keine Zeitungen gelesen, aber darauf ging Dorothea jetzt nicht ein. »Was haben sie denn berichtet?«
»Dass die Schädeluntersuchung eindeutig ergeben habe, dass das Wesen dem Geschlecht der Flachköpfe angehört, einer frühen Rasse, die heute noch im amerikanischen Westen zu finden ist. Und dass man sich nicht sicher sei, ob es einem Urvolk zuzurechnen ist oder Attilas Hunnenhorden.«
Oder auch einem kürzlich verstorbenen Landstreicher, dachte Dorothea. »Woher wusste die Zeitung denn von den Knochenfunden?«, fragte sie laut.
»Das fragt Fuhlrott sich auch. Vermutlich war es einer aus dem Naturwissenschaftlichen Verein, der gehört hat, wie sich Fuhlrott mit meinem Vater über die Sache unterhalten hat. In jedem Fall ist der Doktor ganz außer sich über das unwissenschaftliche Gerede, das die Veröffentlichung provoziert hat. Außerdem haben ihn zwei Professoren aus Bonn angeschrieben, die ihn bedrängen, ihnen die Gebeine zur Begutachtung zu überlassen.«
»Aha«, sagte Dorothea. Sollte dieser Fuhlrott die Knochen doch nach Bonn schicken, dann wären sie zumindest weg und Rosalie hätte endlich wieder Sinn für etwas anderes.
»Und dieser Apotheker«, fragte sie dann, um dem Gespräch eine neue Wendung zu geben. »Was hält er denn von der Angelegenheit?«
Rosalie verschränkte die Arme vor der Brust, als wäre ihr kalt. »Woher sollte ich wissen, was er denkt?«, fragte sie und klang plötzlich verärgert.
Dorothea zuckte mit den Schultern, dann begannen die Glocken der Laurentiuskirche zu schlagen. »Ich muss los«, sagte sie.
Mittags erzählte sie Kirschbaum von den Gebeinen. Im Grunde fing sie nur deshalb damit an, weil sie nicht wusste, worüber sie sonst mit ihm reden sollte. Seit sie die weinende Frau gesehen hatte, fühlte sie sich ihm fremd. Er ließ seine Gabel sinken und hörte ihr aufmerksam zu, wie er es immer tat, wenn sie etwas erzählte.
»Ich glaube, ich kann mich an die Notiz in der Zeitung erinnern«, sagte er schließlich. »Fossile Knochen, das wäre in der Tat bemerkenswert.«
»Ich glaube auch, dass es einer von Attilas Hunnen war oder ein Mensch aus einer noch späteren Zeit«, sagte Dorothea.
»Warum glauben Sie das?«, fragte er erstaunt.
»Weil ich an die Worte der Bibel glaube«, gab sie ebenso erstaunt zurück. Die Schöpfungsgeschichte aus dem Ersten Buch Mose musste er doch kennen, das Alte Testament galt schließlich auch für die Juden.
»Sicher glauben Sie daran«, nickte er. Dann stach er ein Stück Kartoffel auf seine Gabel und führte es zum Mund, aber auf halbem Weg ließ er die Gabel wieder sinken und sah sie an. »Aber wenn das eine stimmt, dann muss das andere doch nicht falsch sein.«
»Wie meinen Sie das?«
Er strich die Kartoffel wieder von der Gabel und legte das Besteck neben den Teller. »Sehen Sie«, sagte er. »Die Bibel ist von Menschen geschrieben worden. Von besonderen Menschen, Auserwählten ohne Zweifel, aber gleichwohl von Menschen.«
Sie nickte.
»So haben sie das, was Gott ihnen offenbarte, mit Menschenworten beschrieben. Sie haben die göttliche Wahrheit für unseren kleinen Menschenverstand begreiflich gemacht.«
Sie nickte wieder, unsicher, worauf er hinauswollte.
»Aber Gott, der sich hinter ihren Berichten verbirgt, ist groß und mächtig und unbegreiflich. Verstehen Sie, es kommt nicht darauf an, ob er die Welt in sechs Tagen erschaffen hat oder in zwei Wochen oder in Jahrhunderten. Es ist nicht wichtig, ob er zuerst die Vögel oder die Fische ins Leben gerufen hat. Entscheidend ist allein, dass er es getan hat. Ob Sie glauben, dass er es getan hat. Das allein zählt.«
Es war die längste Rede, die sie je von ihm gehört hatte.
Sie wusste nicht, was sie von seinen Worten halten sollte. Leugnete er die Bedeutung der Schrift oder gab er ihr eine neue, eine viel größere Bedeutung? Sie dachte noch darüber nach, als er seinen halb vollen Teller von sich schob und seufzte. »Der Glaube, Fräulein Leder, das ist das Entscheidende. Bewahren Sie sich Ihren Glauben.«
Er sprach mit einer solchen Wehmut, mit einer solchen Sehnsucht, dass sie ihm am liebsten mehrere Fragen auf einmal gestellt hätte. Wann er seinen Glauben verloren hatte und warum. Was es mit der weinenden Frau auf sich hatte. Ob er wirklich Geldgeschäfte betrieb. Aber sämtliche Fragen erschienen ihr viel zu persönlich und zu indiskret, so dass sie sie zusammen mit einem Stück Kartoffel und etwas Kohl hinunterschluckte.