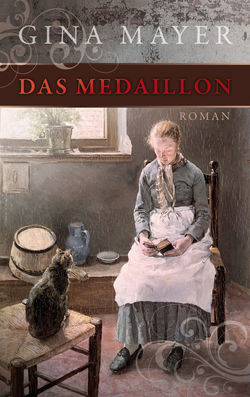Читать книгу Das Medaillon - Gina Mayer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel
Оглавление„Wir mögen daher ein System von Organen vornehmen, welches wir wollen, die Vergleichung ihrer Modificationen in der Affenreihe führt uns zu einem und demselben Resultate: daß die anatomischen Verschiedenheiten, welche den Menschen vom Gorilla und Schimpansen scheiden, nicht so große sind, als die, welche den Gorilla von den niedrigeren Affen trennen ... Und so kommt denn der vorausblickende Scharfsinn des großen Gesetzgebers der systematischen Zoologie, Linné, zu seinem Rechte; ein Jahrhundert anatomischer Untersuchung bringt uns zu seiner Folgerung zurück, dass der Mensch ein Glied derselben Ordnung ist ... wie die Affen und Lemuren.«
(aus »Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur« von Thomas Henry Huxley, 1863)
Tante Lioba wurde immer kleiner. Vielleicht würde sie niemals sterben, sondern nur immer weiter in sich zusammensinken, der Kopf in den Hals, der Hals in die Schultern, die Schultern in den Rücken und so weiter, bis sie irgendwann so winzig wie eine Ameise wäre und dann ganz verschwunden. Es gab jetzt Tage, an denen sie ganz klar war, aber Dorothea hatte keine Angst mehr, dass sie sie verraten könnte. Tantchen hatte von allem Abschied genommen, sie interessierte sich für nichts mehr, ob Dorothea da war und sich um sie kümmerte oder ob Walpurga neben ihr saß, es schien sie nicht zu berühren. Von diesen irdischen Dingen hatte sie sich abgewandt, aber zum großen Kummer von Dorotheas Eltern wandte sie sich stattdessen nicht dem Überirdischen zu. Sonntags nach der Kirche gingen sie sie jetzt immer besuchen, um mit ihr zu beten und sie auf das Jenseits vorzubereiten, aber während Herr Leder die Psalmen vorlas und Frau Leder und Dorothea die Augen auf die gefalteten Hände senkten, saß die Tante in ihrem Lehnstuhl und schaute auf ihre Holzpantoffeln, die viel zu groß geworden waren für ihre kleinen Füße, und schien über alles Mögliche nachzudenken, nur nicht über ihr Seelenheil.
»Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange!«, las ihr Vater. Dorothea sah Tante Lioba an, ohne dabei den Kopf zu heben. Tantchen sah nicht so aus, als sei sie erschrocken, sie wirkte vielmehr müde und ein wenig ratlos.
Wie viel Zeit ihr wohl noch blieb? Ein Jahr oder ein Monat oder vielleicht nur noch ein paar Tage? Was würde aus ihr, Dorothea, werden, wenn die Tante nicht mehr war? Hören Sie auf zu lügen, hatte Kirschbaum damals gesagt, als sie ihm von ihrem Doppelleben erzählt hatte. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Vor sechs Monaten, als Hermann gestorben war, war es fast so weit gewesen. Ihre Eltern hatten Tobias zur Tante geschickt, um Dorothea nach Hause zu holen, aber natürlich hatte er nur die alte Walpurga angetroffen, die jedoch schlau gewesen war. Dorothea sei auf dem Markt, hatte sie angegeben, sie würde ihr schon Bescheid geben. Und dann war sie in die Bibliothek gekommen.
Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte ihr Geheimnis damals entdeckt. Dann wäre jetzt alles geklärt. Sie hätte ihre Arbeit bei Kirschbaum aufgegeben und Buße getan und alles wäre wieder gut.
»Ich bin so müde vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager«, las ihr Vater.
Tantchen war immer sehr erleichtert, wenn Herr und Frau Leder sich wieder verabschiedeten. Dann ließ sie sich von Dorothea zu Bett bringen und schlief sofort ein, wie ein Säugling lag sie auf dem Rücken und schnarchte laut aus ihrem zahnlosen Mund.
Dorothea wusste genau, wie sie sich fühlte, ihr selbst ging es nicht anders. Sie war inzwischen ganz in das kleine Häuschen hinter der Gathe eingezogen, denn man konnte Tante Lioba nicht mehr allein lassen, jetzt da es so schlimm um sie stand. Seit Ende Juni lebte Dorothea schon hier und sie war noch nie in ihrem Leben so glücklich gewesen.
Morgens machte sie das Frühstück für sich und Lioba, die kaum noch etwas aß, und dann kam Walpurga und Dorothea ging ins Luisenviertel und abends hatte sie das kleine Haus ganz für sich allein, denn Tante Lioba ging früh schlafen. Sie schlief so viel in diesen Tagen und Dorothea las und las und las. Natürlich hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie dieses Glück allein Liobas Elend zu verdanken hatte, aber ein schlechtes Gewissen war für sie in den letzen Monaten zur Normalität geworden, daran hatte sie sich gewöhnt.
Jetzt räumte sie auf und bereitete das Mittagessen vor und dann setzte sie sich mit einem Buch in den Lehnstuhl ans Fenster. Draußen auf der Straße spielten ein paar Kinder in der flirrenden Hitze, sie musste an Hermann denken, als sie sie sah, und wurde traurig.
»Wenn du möchtest«, hatte ihre Mutter gesagt, als sie sich vorhin verabschiedet hatte, »kann ich heute Nachmittag ein bisschen bei Tantchen sitzen, von vier Uhr bis zur Andacht um sechs. Dann kannst du ein paar Schritte tun, du kommst ja gar nicht mehr aus dem Haus.«
Ihre Eltern und die ganze Gemeinde betrachteten Dorotheas aufopfernde Fürsorge mit größtem Wohlwollen, Dorothea hatte selbst einmal gehört, wie einer der Ältesten sie einem jungen Mädchen als Vorbild hinstellte. Sie, Dorothea, die Lügnerin, die Betrügerin. Wenn ihr wüsstet, hatte sie gedacht, und dann wieder an Kirschbaums Worte. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Sie würde Rosalie besuchen, solange ihre Mutter auf Tante Lioba aufpasste. Früher hatten sie ihre Sonntagnachmittage immer gemeinsam verbracht. Damals hatten sie sich auch jeden Morgen an der Pumpe auf dem Königsplatz getroffen. Inzwischen sahen sie sich kaum noch. Hier oben in der Nordstadt bei Tante Lioba hatte Rosalie sie noch kein einziges Mal besucht und auch Dorothea war monatelang nicht mehr bei Rosalie gewesen.
Als sie sich auf den Weg machte, war es nicht mehr so heiß, dennoch war sie schon nach wenigen Schritten nass geschwitzt. In der Laurentiusstraße dauerte es lange, bis jemand öffnete. Als Dr. Kuhn vor ihr stand und sie aus großen verschwommenen Brillenaugen musterte, wusste Dorothea, dass Rosalie nicht zu Hause war.
»Sie ist ... spazieren«, erklärte Kuhn.
»Spazieren?«, fragte Dorothea. »Ganz allein? Wie lange ist sie denn schon weg? Und wo ist sie hin?« Vielleicht konnte sie sie ja noch einholen.
»Eine Weile schon«, sagte Kuhn vage. Auf die anderen beiden Fragen antwortete er gar nicht, er sah Dorothea nur ratlos an. Ganz offensichtlich wurde ihm erst jetzt bewusst, dass er keine Ahnung hatte, wo seine Tochter steckte.
»Schade«, sagte Dorothea. »Nun, wenn sie zurückkommt, richten Sie ihr doch bitte aus, dass ich hier gewesen bin.«
»Dorothea«, fügte sie schnell hinzu, als sie bemerkte, wie sich seine blauen Augen zusammenzogen.
»Dorothea«, nickte Kuhn. »Natürlich.«
Auf dem Weg nach Hause ging sie über den Heckweiher, an der Apotheke waren die Gitter vor den Fenstern zugezogen und mit großen schmiedeeisernen Schlössern gesichert. Sie dachte an die Botschaft des Apothekers, die sie Rosalie nie ausgerichtet hatte. Ob Rosalie jemals davon erfahren hatte?
Wo mochte sie sein? Früher wäre es undenkbar gewesen, dass eine von ihnen nicht wusste, was die andere tat. Früher hatten sie einander verstanden, sie hatten sich vertraut, bei aller Gegensätzlichkeit. Aber jetzt hatten sie sich auseinandergelebt.
Vom Neumarkt aus bog sie in die Friedrichstraße ein. Die Häuser waren mit dunklem Schiefer verkleidet, die Fassaden grau und schuppig wie die Haut alter Echsen. Fensterscheiben glitzerten im Sonnenlicht wie Augen.
Dorothea versuchte sich zu erinnern, wann ihre Entfremdung begonnen hatte. Mit ihrer Arbeit bei Kirschbaum. Aber eigentlich schon früher. Es waren die Knochen aus dem Neandertal. Damit hatte es angefangen.
Am nächsten Morgen kam Rosalie in die Bibliothek, Kirschbaum brachte sie zu Dorothea ins Hinterzimmer.
»Du warst gestern bei mir«, sagte Rosalie. »Ist etwas passiert?«
»Ich hatte ein wenig Zeit und wollte mit dir spazieren gehen. Aber du warst nicht da.«
»Ich war auf dem Nützenberg. Mit Karl Bomann und Elisabeth Kraus und noch einigen mehr, wir haben ein Picknick gemacht bei dem schönen Wetter.«
Rosalie traf sich manchmal mit den jungen Leuten aus dem Viertel, sie fuhren zusammen aufs Land und wanderten oder gingen zum Tanzen. Dorothea war niemals dabei, ihre Eltern hätten es nicht erlaubt, und sie machte sich auch nichts daraus.
Es hätte also stimmen können, aber es war nicht wahr. Dorothea war inzwischen so geübt im Lügen, dass man ihr nichts mehr vormachen konnte, sie merkte es sofort, wenn jemand nicht die Wahrheit sagte. Rosalie log sie an, die Erkenntnis machte Dorothea so schwindlig, dass sie nach der Tischkante griff, um sich daran festzuhalten. Rosalie, die Aufrichtige, die Kompromisslose, die Ehrliche. Die Einzige, die über Dorotheas Doppelleben Bescheid wusste, Kirschbaum einmal ausgenommen. So weit hatten sie sich also voneinander entfernt. Das war aus ihrer Freundschaft geworden.
Dorothea nahm ein Buch von dem Stapel auf ihrem Schreibtisch und starrte hinein, um Rosalie nicht ansehen zu müssen. »War es schön?«, fragte sie. Ihre Stimme klang ein bisschen dünn.
Rosalie schwieg, vielleicht nickte sie, aber da Dorothea nicht von ihrem Buch aufblickte, konnte sie es nicht sehen. »Wie geht es Tante Lioba?«, hörte sie Rosalie fragen. »Du bist jetzt ganz zu ihr gezogen, steht es sehr schlimm um sie?«
»Schlecht.«
»Du meine Güte«, murmelte Rosalie, und dann schwiegen sie beide. Dorothea klappte ihr Buch wieder zu und legte es zur Seite, dann starrte sie auf den Stapel Bücher zu ihrer Linken, die alle noch aufgeschnitten werden mussten, bevor sie Karteikarten dafür schreiben konnte. Plötzlich wünschte sie sich, dass Rosalie endlich ginge, sie hatte noch so viel zu tun, und statt zu arbeiten saß sie hier herum und redete dummes Zeug und wurde angelogen.
Aber dann sah sie Rosalie an und sah, dass ihre Augen ganz feucht waren.
»Ich war gar nicht mit Karl und Elisabeth auf dem Nützenberg«, flüsterte sie. »Sondern mit jemand anderem.«
»Ich weiß.« Dorothea hatte jetzt selbst Tränen in den Augen, obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Rosalie hatte sich mit dem Apotheker getroffen. Obwohl Dorothea seine Nachricht nicht ausgerichtet hatte, waren die beiden doch zusammengekommen, und nun trafen sie sich heimlich.
»Minter«, sagte sie laut.
Rosalie nickte nicht, aber sie schüttelte auch nicht mit dem Kopf, sie sah Dorothea nur an und schwieg.
»Warum darf dein Vater nicht von ihm wissen?«, frage Dorothea. »Die beiden verstehen sich doch so gut, wäre er nicht erfreut über eure Verbindung?«
Rosalie zuckte mit den Achseln. »Es gibt auch viel Trennendes zwischen ihnen«, sagte sie dann. »Minter ist ihm zu radikal in seinen Ansichten.«
Aber das war nicht der Grund, warum sie ihrem Vater die Zusammentreffen mit dem Apotheker verschwieg, dachte Dorothea. Es gab einen anderen Grund, warum die Verbindung geheim bleiben sollte.
»Pass auf, was du tust, Rosalie«, meinte sie ernst.
Rosalie wirkte einen Moment lang, als wollte sie in Tränen ausbrechen, aber dann lachte sie, ein kurzes, spöttisches Lachen. Wie recht sie hatte.
Dorothea war die Richtige, so zu reden.
Die Kirche in der Deweerthstraße war schlicht und streng und ernst. Mochten sich andere Gotteshäuser zum Himmel türmen oder aufplustern wie Pfauen, die Kirche der Niederländisch-Reformierten blieb am Boden. Der Glockenturm auf dem Vorbau mit seiner einsamen Glocke, die nur die volle Stunde schlug, überragte das Dach des Mittelschiffs nur um wenige Zentimeter. Hochmut, sagte das Gebäude jedem, der es hören wollte, Hochmut ist im Angesicht Gottes fehl am Platze. Wer Ihn ehren will, der senke die Augen und übe sich in Demut und Bescheidenheit.
Auch innen war die Kirche schlicht. Ein rechteckiger Saal mit flachen Kassettendecken und weiß getünchten Wänden. Eine hölzerne Kanzel, zu der eine leicht geschwungene Treppe hinaufführte. Hölzerne Liedbretter an den Wänden, ansonsten kein Bild, kein Ornament, kein Schmuck.
Gerade weil der Raum so niedrig war, erschien er in seiner Ausbreitung umso beeindruckender. Die vielen Sitzreihen, eine dunkelbraune Bank hinter der anderen und davor eine Reihe Stühle und das große, freie Podium unter der Kanzel, auf dem bei Abendmahlfeiern die Tische aufgebaut wurden.
Dorothea ließ sich neben ihrer Mutter im Mittelteil des Saales nieder, während sich ihr Vater und die Brüder auf die rechte Seite setzten, denn beide Seitenflügel waren den Männern vorbehalten. Sie faltete die Hände und schloss die Augen. In der Dunkelheit hinter ihren Lidern jagten die Gedanken durcheinander. Rosalie und der Apotheker. Tante Lioba und Kirschbaum. Wohin sie auch dachte, überall waren Geheimnisse, Lügen, Dinge, über die man nicht sprach, über die man nicht sprechen durfte. Herr, mein Gott, dachte sie, du bist sehr herrlich; du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast, und sie spürte, wie sich ihre Gedanken ordneten und dahinglitten wie ein ruhiger Fluss.
Dann legte sich die Hand ihrer Mutter auf ihren Unterarm, ihre Gedanken fuhren auseinander, sie riss die Augen wieder auf. Frau Leder saß ganz aufrecht da, aber ihr Kopf machte eine winzige Bewegung zur rechten Seite, und als Dorotheas Augen ihr folgten, sah sie einen jungen Mann, dunkel gekleidet, in eine Bank treten. Er senkte den Kopf zum Gebet, dabei schlossen sich seine Hände um seinen schwarzen Hut
»Der junge Packenius«, flüsterte ihre Mutter. »Er ist wieder zurück.« Dorothea hatte von ihm gehört. Andreas Packenius, der Missionar. Sohn einer reichen Kaufmannsfamilie, seine Leute gehörten zu den angesehensten Gemeindegliedern, obwohl sie erst vor einigen Jahren in die Niederländisch-reformierte Kirche eingetreten waren.
Der junge Packenius war in Afrika gewesen, um dort die Heiden zu missionieren. Jetzt aber war er zurück. Das harte Tageslicht, das aus dem Rundbogenfenster auf sein Gesicht fiel, ließ seine braune Haut fahl erscheinen, als wäre er geschminkt.
»Starr nicht so hinüber zu ihm«, flüsterte ihre Mutter, obwohl sie es gewesen war, die Dorothea auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Dorothea blickte hastig nach vorn, dann begann die Orgel zu spielen.
Nach dem Gottesdienst ging die ganze Familie mit zu Tante Lioba, aber sie quälten sie jetzt nicht mehr mit Bibellesungen und endlosen Gebeten. Lioba hätte sie gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, sie lag jetzt nur noch im Bett und verschlief den halben Tag, röchelnd und schnaubend, sie kämpfte um jeden Atemzug. Dorothea hatte manchmal das Gefühl, dass sie es nur ihretwegen tat, dass die Tante weiterlebte, damit sie selbst auch weiterleben konnte.
»Gott segne dich, Lioba«, sagte Herr Leder, während er an das Krankenbett trat und auf die Schwester seiner Mutter herabblickte. Tante Lioba machte ein leises, schmatzendes Geräusch mit den zahnlosen Kiefern und drehte den Kopf weg.
Das Verhältnis zwischen ihrem Vater und der Tante war nie wirklich gut gewesen. Dorothea war neun Jahre alt, als sie hier weggezogen waren, aber sie erinnerte sich noch gut an die Auseinandersetzungen. Kein lauter Streit, sondern Wortwechsel, die sanft begannen und im Ton immer schärfer wurden, bis das Gespräch abbrach und man sich beleidigt zurückzog. Sie erinnerte sich daran, wie ihre Mutter die Schultern hochzog und den Kopf duckte, wenn es wieder anfing. Dorothea hatte nie verstanden, worum es ging, warum die beiden nicht miteinander auskamen. Es war die Zeit, in der sich die Niederländisch-Reformierten von der offiziellen reformierten Gemeinde abgespalten hatten. Tante Lioba war damals den Schritt nicht mitgegangen, vielleicht war das ja der Grund der Missstimmung gewesen. Sie hätte Lioba zu gerne danach gefragt, aber jetzt war es zu spät. Jetzt konnte sie ihr nicht mehr antworten und von ihrem Vater würde sie niemals etwas erfahren.
»Heute Abend lädt Familie Packenius zur Andacht in ihr Haus«, sagte Frau Leder, nachdem sie Tante Liobas schlaffe Hand ergriffen und dann wieder weggelegt hatte.
»Ich kann aber nicht dabei sein«, erklärte Dorothea. »Ich habe Walpurga freigegeben, sie ...« ... hat in der letzten Zeit so viel gearbeitet, wollte sie fortfahren, gerade noch rechtzeitig biss sie sich auf die Lippen. »Sie hat zu tun.«
»Sie hat zu tun?«, wiederholte ihr Vater befremdet. »Heute am Sonntag? Was gibt es da zu tun?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Dorothea. »Vielleicht möchte sie selbst zur Kirche, immerhin hat sie unseretwegen schon den Gottesdienst verpasst.«
Dagegen war nichts zu sagen, ihre Eltern sahen dennoch unzufrieden aus und Dorothea bemerkte, wie sie einen schnellen Blick wechselten. »Es ist aber nicht angebracht, dass du ständig fehlst bei der Andacht«, meinte ihr Vater. »Tobias bleibt bei Tante und du kommst mit uns.«
Also war das entschieden.
Die Packenius’ wohnten auf der Marienstraße, nicht weit von Tante Liobas Häuschen entfernt, aber es war eine andere Welt. Das Haus stand breit und selbstgefällig da, die Fassade verziert mit steinernen Balkons, Rundsäulen und Friesen über den Fenstern, die Front endete in einem eleganten Giebel, dessen Spitze zum Himmel zeigte wie der Finger eines eifrigen Schulkindes.
Dorothea zählte die Stufen der Steintreppe, die von der Straße zur Haustür führte. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dann waren sie oben und ihr Vater zog am Band der Glocke, die aussah, als wäre sie aus Messing, aber vielleicht war sie auch aus Gold. Er wirkte ein wenig eingeschüchtert, obwohl sie doch alle Brüder und Schwestern in Gott waren, Glieder derselben Gemeinde. Eine Familie.
Ein Dienstmädchen öffnete die Tür, sie trug ein weißes Häubchen, das ihr schwarzes Gesicht noch dunkler erschienen ließ. Herr und Frau Leder starrten sie an, als wäre sie der Leibhaftige.
»Zur Andacht«, stammelte Herr Leder.
»Bitte schön«, sagte das Mädchen und ging vor ihnen her, durch einen Vorraum mit Marmorboden in einen breiten Korridor, dann standen sie vor zwei Flügeltüren mit Einsätzen aus honigfarbenem Glas, durch das man nicht hindurchblicken konnte. Das gelbliche Licht hellte das Gesicht des Mädchens auf, ihre Haut sah warm und braun aus, als sie eine Tür aufzog und zurücktrat, um ihnen den Vortritt zu lassen. Herr Leder zögerte einen Moment lang, bevor er losging, und seine Frau und Dorothea und Traugott folgten ihm.
Der Saal war mit dunklem Holz verkleidet und voller Menschen, die meisten von ihnen einfache Leute wie sie selbst. Schwarz und schlicht gekleidet, Männer und Frauen. Dorothea sah den Hausherrn im Gespräch mit zwei der Ältesten, den Brüdern von der Heydt. Als er Herrn Leder erblickte, winkte er sie zu sich heran.
»Wie schön, dass ich Sie begrüßen darf«, sagte Packenius, als habe er die ganze Zeit nur auf sie gewartet. Er trug einen mächtigen Backenbart, aber seine Oberlippe und sein Kinn waren glatt rasiert.
»Traugott, mein Sohn, und meine Tochter Dorothea.« Herr Leder wies auf seine beiden Kinder, als wollte er sie dem Kaufmann zum Geschenk machen.
»Traugott und Dorothea«, wiederholte Herr Packenius und nickte gütig, und dann wanderten seine Augen über ihre Schultern zur Tür, zu den nächsten Besuchern, die eintraten und sich unsicher umschauten wie vorhin sie selbst.
Nach der Andacht stand man wieder in kleinen Grüppchen zusammen und redete mit gedämpfter Stimme, es gab nichts zu essen, nicht einmal Schmalzbrote, und Dorothea war hungrig. Sie wartete in der Nähe der Tür darauf, dass ihre Eltern sich verabschiedeten und sie endlich nach Hause konnte zu Tante Lioba. Ihr Magen knurrte leise und drohend und sie legte schnell eine Hand auf ihren Leib, als könnte sie ihn dadurch besänftigen, dann blickte sie auf, weil jemand neben sie getreten war.
»Wir sind noch nicht miteinander bekannt gemacht worden.« Es war der junge Mann, den sie morgens in der Kirche gesehen hatte. »Andreas Packenius.« Er reichte ihr seine Hand. Lange, braune Finger.
»Angenehm«, sagte sie. »Dorothea Leder.«
»Meine Eltern und mein Bruder stehen dort drüben«, fügte sie dann hinzu und wies mit dem Kopf in ihre Richtung, aber er wandte den Blick nicht von ihrem Gesicht. Er trug einen Vollbart und das dünne Haare wellig aus der Stirn gekämmt, wie es heute keiner mehr hatte, aber vielleicht war das Mode in Afrika.
»Sie sind gerade aus dem Ausland zurückgekehrt?«, fragte sie, als er nichts sagte. Er lächelte und sie sah, dass seine Zähne klein waren und in einem Abstand voneinander standen wie bei einem Raubtier, obwohl es bei ihm nicht gefährlich wirkte.
»Seit zwei Tagen bin ich aus dem Süden Afrikas zurück. Ich war in der Mission tätig, ein Jahr lang.«
»Bleiben Sie jetzt für immer hier oder ist es nur ein kurzer Heimaturlaub?«
»Ich werde zurückkehren nach einer gewissen Zeit«, sagte er und lächelte wieder, als habe er nur einen Scherz gemacht.
Während sie überlegte, was sie noch sagen könnte, begann ihr Bauch wieder zu knurren, noch lauter als vorhin. Sein eben noch lächelndes Gesicht verzog sich zu einem Ausdruck der Bestürzung.
»Sie haben Hunger!«, rief er so laut, dass sich ein paar der anderen Gäste nach ihnen umwandten. »Kommen Sie, kommen Sie nur«, meinte er dann und machte ein paar Schritte in Richtung Tür, dann drehte er sich nach ihr um, ob sie ihm auch folgte.
Sie gingen durch den Korridor in eine Küche, die so groß war wie ihre ganze Wohnung in der Königsstraße. Am Tisch schälten zwei Mädchen Kartoffeln, einem von ihnen flüsterte Packenius etwas zu, worauf er zum Herd ging und aus einem dampfenden Kessel Suppe schöpfte, einen Teller voll. »Bitte schön«, sagte Packenius wieder, zeigte die kleinen Zähne und reichte Dorothea einen Löffel.
»Nein«, wehrte sie ab. »Ich bin gar nicht hungrig.« Aber dann knurrte ihr Magen wieder, so laut, dass es sogar das Dienstmädchen hörte und lächelte. »Also gut«, murmelte sie und nahm den Löffel.
Er setzte sich neben sie und sah ihr beim Essen zu, in leicht vorgebeugter Haltung und mit geneigtem Kopf, als wollte er kontrollieren, dass sie auch wirklich alles aufaß.
»Danke«, sagte sie schließlich und schob den Teller von sich. »Vielen Dank.«
Er nickte und lächelte.
»Ich muss jetzt zurück, meine Eltern suchen mich bestimmt.«
Er stand auf und sie stand auf und plötzlich standen sie sich eng gegenüber. Sie traten beide einen Schritt zurück und senkten die Köpfe. Dann brachte er sie zurück zum Saal, aber er ging nicht mit ihr hinein, er öffnete nur die Tür für sie und blieb auf der Schwelle stehen.
»Auf Wiedersehen, Fräulein Dorothea«, sagte er. »Gott segne Sie.« Wieder sprach er so laut, dass ihnen viele die Köpfe zuwandten.
»Auf Wiedersehen, Herr Packenius«, meinte Dorothea hastig. Dann ging sie in den Saal und drehte sich nicht mehr nach ihm um.
Als sie am nächsten Morgen in die Alte Freiheit einbog, verließ die Frau mit den hoch aufgetürmten schwarzen Haaren die Leihbibliothek. Dorothea erkannte sie sofort wieder, obwohl es beinahe ein Jahr her war, dass sie sie gesehen hatte. Die Frau kam auf sie zu und war fast an ihr vorbei, als auch sie Dorothea erkannte und stehen blieb. Sie schauten sich einen Augenblick lang an, Dorothea fühlte, wie die Augen der anderen an ihrem Körper entlangglitten, abschätzend und verächtlich, und wie ihr Blick schließlich in ihrem Gesicht landete. Es war fast wie eine Berührung, wie ein hastiges, grobes Abtasten.
Dorothea ließ die Blicke schweigend über sich ergehen, dann wandte sich die Frau ab und lief weiter. Dorothea ging auch weiter, aber mit langsamen Schritten. Es hatte so viel Hass in diesem Blick gelegen, so viel Abscheu, vielleicht ging es doch um Geldgeschäfte, vielleicht verachtete die Frau sie, weil sie für einen gierigen Juden arbeitete. Aber es passte einfach nicht zu Kirschbaum, jetzt, da sie ihn ein Jahr lang kannte, passte es noch weniger zu ihm. Ein anderer Gedanke, ein anderer Verdacht passten dagegen viel besser, auch zu dem wenigen, was sie von ihm wusste. Dass diese Frau seine Frau war.
Sie beschloss, Kirschbaum einfach zu fragen, was es mit der Fremden auf sich hatte. Aber als sie die Tür zur Bibliothek aufstieß und Kirschbaum sah – er stand oben auf der Leiter vor dem Regal Be bis Chr und wirkte so klein, obwohl sie zu ihm aufblickte –, da wusste sie, dass sie die Fremde nicht erwähnen würde, dass sie lieber gar nicht wissen wollte, wer sie war.
»Wie geht es Ihrer Tante?«, fragte er beim Mittagessen.
»Es sieht sehr schlecht aus«, meinte sie. »Vielleicht ist morgen schon alles zu Ende.«
Er nickte und nahm ein paar Bissen von seinem Gemüse, kaute langsam und schluckte und dachte nach. »Und dann? Was werden Sie dann tun?«
Sie zuckte mit den Schultern. Sie hatte schon so viel darüber nachgedacht, sie war müde vom Seufzen und hatte mit ihren Tränen ihr Bett geschwemmt, aber es hatte nichts gebracht, sie fand keine Lösung, weil es keine Lösung gab. Jetzt schob sie den Gedanken einfach weg, sobald er auftauchte. Sie würde sich damit auseinandersetzen, wenn es so weit war. Morgen oder übermorgen.
»Fräulein Leder«, sagte Kirschbaum, als sie nicht antwortete. »Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich Ihnen helfen kann in Ihrer Lage. Ich kann Ihnen Ihre Entscheidung nicht abnehmen, aber ich habe etliche Mittel, wenn Sie also Unterstützung benötigen sollten, wenn es daran liegt ...«
Sie hob den Kopf und starrte ihn ungläubig an. Bot er ihr Credit an? Zeigte er jetzt sein wahres Gesicht?
»Ich will Ihr Geld nicht«, stieß sie hervor und dabei klang ihre Stimme kälter, als sie es beabsichtigte.
Er wirkte zuerst ratlos, aber dann senkte er den Blick, weil er verstanden hatte. »Ach ja«, murmelte er und lächelte traurig in die Hand, auf die er sein Gesicht stützte. »Die Juden und das Geld, das ist ja so eine Sache, das habe ich gar nicht bedacht. Da habe ich nun meinen Glauben verloren, aber von meiner Religion kann ich mich nicht lösen.«
»Nein«, sagte sie und mit einem Mal schämte sie sich so, wie sie sich noch nie einem Menschen gegenüber geschämt hatte, auch wenn ihr Vater und ihre Mutter und die halbe Gemeinde jetzt in die Bibliothek gekommen wären und sie hier am Tisch gesehen hätten, hätte sie sich nicht schlimmer fühlen können. »Das haben Sie falsch verstanden, das habe ich bestimmt nicht so gemeint.«
Aber er war schon aufgestanden und trug seinen Teller und sein Besteck zum Spülstein, obwohl er noch gar nicht aufgegessen hatte, und er sah sie dabei nicht an.
Nach dem Essen ging sie in die Nordstadt und als sie die Tür zu Liobas Häuschen aufschloss, löste sich eine Gestalt aus einer Toreinfahrt, aus dem Augenwinkel sah sie einen Mann auf sich zukommen. Sie beeilte sich mit dem Schlüssel, hier oben hinter der Gathe trieben sich so viele zwielichtige Gestalten herum, aber bevor die Tür offen war, hatte der Mann sie erreicht. »Fräulein Dorothea«, sagte er und sie erkannte Andreas Packenius, der mit einem breiten Lächeln auf sie zukam.
»Habe ich Sie erschreckt?« Von einer Sekunde zur anderen verwandelte sich seine freudige Miene in einen Ausdruck der Bestürzung. Sie fragte sich, wie lange er wohl schon da gestanden und auf sie gewartet haben mochte.
»Möchten Sie eintreten?«, fragte sie ihn.
Er hob erschrocken beide Hände. »Nein, nein! Ich wollte Sie etwas fragen und Ihre Eltern waren so freundlich, mir mitzuteilen, wo Sie wohnen«
Er war also bei ihren Eltern gewesen und sie hatten ihm Liobas Adresse genannt, einem jungen Mann, den sie gar nicht kannten, aber natürlich war er aus der Gemeinde und zudem Missionar.
»Worum geht es denn?«, fragte sie, eine Hand schon an der Tür. Erst das Mittagessen mit Kirschbaum, den sie so gekränkt hatte. Und jetzt dieser Missionar. Es gefiel ihr nicht, dass er hier war, wenn er öfter kam, würde er schnell feststellen, dass sie tagsüber nicht zu Hause war, vielleicht hatte er ja jetzt schon einen Verdacht geschöpft.
»Würden Sie mit mir spazieren gehen, am Sonntag nach der Kirche?«, fragte Packenius.
»Das geht nicht, leider. Während des Gottesdienstes habe ich jemanden für Tantchen, aber danach muss ich mich wieder um sie kümmern.«
»Ihre Mutter hat sich angeboten.“ Er öffnete den Mund und lächelte sein harmloses Raubtierlächeln und das machte sie wütend.
»Hat sie das?«, fragte sie spitz. »Nun, dann ist die Sache ja abgemacht. Warum fragen Sie mich überhaupt noch?«
Das Lächeln hing noch eine Weile in seinen Zügen, dann verschwand es.
»Wir sehen uns also am Sonntag«, meinte sie. »Und kommen Sie bitte nicht mehr hierher. Es ist ... wegen der Nachbarn. Sie verstehen?«
»Ich verstehe.« Er flüsterte es fast.
Nach dem Gottesdienst wartete er auf sie, mit gesenktem Kopf, den Hut tief in die Stirn gezogen. »Geh schon zu ihm«, sagte ihre Mutter, während sie Dorothea die Bibel und das Gesangbuch aus der Hand nahm.
»Es wird nicht lange dauern, ich bin baldmöglichst wieder zurück«, meinte Dorothea, hauptsächlich um ihre Mutter zu ärgern, der so viel daran lag, dass sie sich gut mit dem Missionar verstand.
Sein Gesicht leuchtete auf, als er sie sah, und sein Oberkörper beugte sich ihr entgegen, während er ihr die Hand schüttelte. »Wenn Sie einverstanden wären, gehen wir auf die Hardt«, schlug er vor.
Sie zuckte mit den Schultern und spürte die Blicke ihrer Mutter in ihrem Rücken. »Wie Sie wollen.«
Es war ein heißer Sommertag und der Himmel war wie Glas vor einer blauen Leinwand. Der Weg zum Aussichtsturm schlängelte sich durch Wiesen, vor ihnen lag die bewaldete Kuppel der Anhöhe, aber wo sie gingen gab es kaum einen Baum, der Schatten warf. Andreas Packenius machte große Schritte und pries abwechselnd das gute Wetter und den blauen Himmel und Gottes schöne Natur. Das gleichzeitige Gehen und Reden und die Hitze setzten ihm zu, seine Schläfen glänzten vor Schweiß, durchsichtige Perlen rollten über die Wangen in den dunklen Vollbart, der so dünn war, dass die Haut darunter hervorschimmerte. Er zog ein Taschentuch aus der Jacke und wischte sich damit über das Gesicht. Sie wunderte sich, dass er so schwitzte, er musste die Hitze doch gewöhnt sein.
»In Afrika ist es jetzt Winter«, sagte er, als habe er ihren Gedanken erraten.
»Winter? Mit Schnee und Eis, meinen Sie?«
»Nein, natürlich nicht.« Er zeigte die kleinen, spitzen Zähne. »Mit Regen, Unmengen von Regen, gerade jetzt im August.«
»Regen mitten in der Wüste«, sagte sie ungläubig.
»Es ist nicht alles Wüste in Afrika. Im Kapland, wo ich war, ganz an der südlichen Spitze, gibt es grüne Hügel und Felder und Blumen, sogar Weinberge, ganz so wie hier, nur dass alles noch prachtvoller und üppiger ist.«
»Und Urwälder«, ergänzte sie.
»Nein, Urwälder gibt es dort nicht.«
»Aber wilde Tiere, die gibt es doch, oder ist das auch alles erfunden?«
»Affen und Löwen, ja. Aber nicht in der Missionsstation, man hört sie nur zuweilen brüllen. Einen richtigen Löwen habe ich selbst nur einmal zu Gesicht bekommen, und zwar aus der Ferne.«
»Aha«, nickte sie. »Und die Menschen, die dort leben? Die sind doch allesamt schwarz, so wie das Negermädchen im Hause Ihrer Eltern.«
»Ja, die Eingeborenen sind Neger, das ist wohl richtig.«
Sie hatte sich fest vorgenommen, ihm die kalte Schulter zu zeigen, zu schweigen, so dass er sie künftig in Ruhe lassen würde, aber was er erlebt hatte, interessierte sie. Sie erinnerte sich an einen Artikel, den sie in einer Ausgabe von Westermanns Illustrierten Monatsheften gelesen hatte. Über einen englischen Missionar in Afrika, vielleicht kannte ihn Packenius ja sogar persönlich.
»Livingstone«, sagte sie. »Kennen Sie David Livingstone?«
Er sah sie mit großen, runden Augen an. »Wer?«
»Ein englischer Missionar, der das südliche Afrika auf Reisen erkundet und die Wilden bekehrt«, erklärte sie, voller Überraschung, dass ihm der Name nicht vertraut war.
Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Es sind so viele dort und auf Reisen bin ich persönlich nie gewesen. Es ist mir zu riskant und die Arbeit in der Mission lässt einem ja auch wenig Zeit.«
»Aha.“
»Wissen Sie«, sagte er, »unser Leben als Missionare in Afrika unterscheidet sich im Wesentlichen wenig vom Leben hierzulande. Die Hitze, der Regen, das extreme Wetter, ja das lässt sich nicht zähmen, aber ansonsten ist es ja unser Anliegen, den Eingeborenen die Zivilisation näherzubringen, ihnen eine Kultur zu geben und die rechte Religion. Deswegen darf man sich eine Missionsstation auch nicht als Negerkral vorstellen. Die Missionare in der Station Wupperthal bei Clanwilliam, wo ich war, wohnen in ordentlichen Steinhäusern, bescheiden, aber durchaus zivilisiert.«
»Aha«, sagte sie noch einmal. »Und was tun Sie dort auf Ihrer Missionsstation? Man kann doch nicht von früh bis spät taufen.«
»Nein«, sagte er ernsthaft, fast erschrocken. »Predigen und Bekehren ist nur ein Teil. Zur Station gehört ein weites Weideland, etliche Obstplantagen und Tabakfelder, die es zu bewirtschaften gilt. Die Hottentoten, die dort leben, müssen angeleitet und überwacht werden, das ist recht mühsam, denn die meisten von ihnen sind nicht an Arbeit gewöhnt, so dass man sie ständig antreiben muss.«
»Das war also Ihr Bereich? Die Landwirtschaft?«
»Ich habe auch missioniert und etliche Kinder getauft und auch Erwachsene. Aber es ist nicht immer der Hunger nach dem Wort des Lebens, der die Neger zu uns treibt. Viele kommen, weil es Arbeit auf der Station gibt und Brot und eine Schule für die Kinder. Manche erscheinen auch aus bloßer Neugierde, weil sie noch nie in ihrem Leben einen zivilisierten Menschen gesehen haben. Sie sind dann voller Furcht, aber einige treten mutig vor und berühren unsere Haut, weil sie glauben, dass wir uns nur mit weißer Farbe bemalt haben.«
Dorothea dachte an das schwarze Dienstmädchen und dass sie ihr dunkles Gesicht auch gerne berührt hätte.
Andreas Packenius fuhr fort zu reden, er erzählte davon, dass sie nicht nur die Negerkinder im Lesen und Schreiben unterrichtet hatten, sondern auch die Erwachsenen, denn es gab kaum Schulen in Afrika, und dass ein Missionar nicht nur Seelsorger, sondern auch Arzt und Pfleger war, weil es dort nur Medizinmänner gab, die die Krankheiten mit greulichen Masken und Hokuspokus zu vertreiben versuchten. »Mit allerlei heidnischem Hexenzauber«, sagte Packenius und während Dorothea ihm zuhörte, sah sie einen kleinen Herrn, der ihnen vom Aussichtsturm her entgegenkam, ein rundlicher Mann mit breitkrempigem Hut und Spazierstock. Die laute Stimme des Missionars wurde zu einem Dröhnen, als sie Isaak Kirschbaum erkannte und im selben Moment blickte er auf und ihre Augen begegneten sich. Er wandte sein Gesicht sofort wieder ab und ging weiter, ohne irgendeine Regung zu zeigen, aber sie wusste, dass er sie erkannt hatte und dass er sie nicht begrüßen würde, weil ihre Verbindung geheim bleiben musste.
Sie hätte den Missionar am liebsten stehen gelassen und wäre zu Kirschbaum gegangen. Je näher er ihnen kam, desto größer wurde ihr Bedürfnis, er war so allein, und sie war es auch, obwohl sie Packenius an ihrer Seite hatte oder gerade deswegen. Als sie nur noch wenige Schritte voneinander entfernt waren, hielt sie es nicht mehr aus.
»Guten Tag, Herr Kirschbaum. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen«, rief sie so laut, dass sie sogar die Stimme des Missionars übertönte. Packenius klappte den Mund zu und sah den fremden Mann irritiert an. Kirschbaum hob den Kopf und sah Dorothea an, zuerst überrascht und dann lächelte er und hob seinen Hut.
»Einen schönen Sonntag«, sagte er. »Das wünsche ich Ihnen auch, Fräulein Leder.«