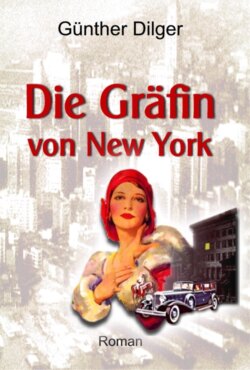Читать книгу Die Gräfin von New York - Günther Dilger - Страница 10
Rose will es wissen
ОглавлениеViele achtjährige Knaben aus besserem Hause in einer Großstadt empfinden es als lästige Einschränkung: sie dürfen ohne Begleitung eines Erwachsenen noch nicht hinaus in die urbane Wildbahn.
Hinaus in diesen für sie noch unerforschten Dschungel aus den Straßen der Stadt und all ihren dunklen Winkeln und Ecken. Diese Welt, auf die sie so neugierig sind, die sie mit ihrem Ungestüm erkunden wollen.
Dorthin, wo etwa gleichaltrige Jungs der ärmeren Leute längst selbständig und unbeaufsichtigt herumtollen und ihren Spaß haben.
Nicht selten auf Kosten älterer Leute oder Geschäftsinhaber, die schon mal von den halbwüchsigen Horden nach Herzenslust gefoppt und veralbert, manchmal aber auch zu deren weit größerem Missvergnügen bestohlen werden.
Noch problematischer ist diese Situation für solche Jungs betuchter Eltern, wenn sie eine oder mehrere ältere Schwestern haben. Dann kann es ihnen ergehen wie John.
Seine Schwester Rose hatte kürzlich das Angebot von Vater O’Reilly angenommen, immer montags zu seiner neu eingerichteten Bibelstunde zu kommen. O’Reilly war Priester an der Basilica of St. Patrick’s Old Cathedral und unterrichtete an der privaten Junior High School, in der Rose eingeschrieben war. Der Sprengel hatte für dieses Sekundarstufen-Institut die Trägerschaft übernommen.
Das Angebot zur Teilnahme galt für Mädchen im Alter von neun bis fünfzehn Jahren. Es sollte dem Bekunden des Pädagogen nach dazu dienen, zusammen mit den Heranwachsenden herauszufinden, ob die eine oder andere sich vielleicht für eine noch engere Bindung an die Kirche berufen fühle. Die Möglichkeit auszuloten, ob eines der Mädchen, statt sich dem weltlichen Leben hinzugeben, sich der vollen Hingabe an den Herrn in Form einer Aufnahme in ein Kloster verschreiben wolle.
Also die Aufnahme in eine Gruppe von frommen Frauen, bei denen im entsprechenden Alter neben der Pubertät auch schon die Ablehnung der nachfolgenden Möglichkeiten daraus eingesetzt hat. Der Anschluss an so eine Gemeinschaft war bei Bestehen der Anforderungen sozusagen der Hauptgewinn.
Selbstredend schilderte der listige Pfarrer das andächtige Leben in einem Stift auf eine so begeisternde Art und Weise, dass manchen der noch unbedarften Mädchen die freiwillige Internierung in so eine frömmelnde Frauengesellschaft als erstrebenswertes Ziel erschien.
Hätte Rose von vorneherein gewusst, wie sich der Lehrplan speziell für sie selbst entwickeln sollte, sie hätte die Stunden vielleicht abgesagt.
Oder aber genau aus diesem Grund weiter teilgenommen.
Wie auch immer, sie hatte sich jedenfalls auch in diese Liste für Bewerberinnen eingetragen. Aber nicht etwa, weil sie ernsthaft daran interessiert gewesen wäre, in irgendeiner Weise in einem kirchlichen Dienst tätig zu werden, geschweige denn, in ein Kloster einzutreten. Allein der Gedanke daran ließ sie schon erschauern.
Nein, sie hatte einen ganz anderen, sehr simplen Grund, dort dabei zu sein: um zu provozieren.
Die Freymans, außer vielleicht dem Patron, waren generell keine besonders tiefgläubigen Menschen.
Bei John konnte man noch nicht so genau absehen, welchen Verlauf bei ihm die diesbezügliche Entwicklung nehmen werde. Da musste man noch abwarten.
Aber die anderen alle lebten den Glauben etwa so, wie man seine Staatsangehörigkeit lebte: man wurde als Amerikaner geboren, also war man Amerikaner. Und man wurde als Katholik geboren, also war man Katholik.
Genauso selbstverständlich wie man als Staatsangehöriger die Gesetze seines Landes befolgte, genauso selbstverständlich befolgte man die Regeln der Kirche.
Und auch genauso emotionslos.
Und im gleichen Maße bedenkenlos, wie man sich kleinere Übertretungen der jeweiligen Landesgesetze erlaubte, genauso bedenkenlos verstieß man gegen Vorschriften seiner Religion. Man befolgte seine eigenen ethischen Grundsätze.
Und die waren grundsätzlich höchst ehrbar.
Außer vielleicht in sehr seltenen Ausnahmesituationen.
Während Mary-Ann und auch ihre Eltern die pompös zelebrierte Liturgie ihrer Kirche und die salbungsvollen Predigten der umtriebigen Funktionäre doch etwas ernster nahmen, empfand Rose den streng regulierten Ablauf während der Messen und all das andere Drumherum eher als lächerliches Brimborium.
Sie schrieb dem allen eine sehr starke Ähnlichkeit mit den Riten der Schamanen von Urvölkern zu. Nur eben durchgeführt in etwas abgewandelter Form.
Die Geschichten und Erzählungen aus dem Katechismus tat sie geringschätzig ab mit dem Wort ‚Ammenmärchen‘.
Die Sache mit der Befruchtung Marias durch den Heiligen Geist sah sie als die höchst unverfrorene, aber unheimlich clevere Ausrede eines jungen Mädchens, um ein uneheliches Kind zu rechtfertigen.
Es war für sie die erfolgreichste Lüge, die Eltern nach einem sexuellen Fehltritt jemals aufgetischt wurde. Darüber hinaus hielt sie diese Behauptung für den folgenreichsten Schwindel in der Geschichte der Menschheit.
Als ihr Vater sie während einer Diskussion einmal fragte, ob sie denn die ‚Zehn Gebote‘ nicht für ein sinnvolles Regelwerk halte - für das Zusammenleben einer Gesellschaft, der christlichen zum Beispiel - da antwortete sie:
„Ein einziges Gebot finde ich völlig ausreichend, um einer Gemeinschaft die nötige Leitlinie für ein ethisch korrektes Miteinander zu geben. Eines, das alle Eventualitäten des Zusammenlebens abdeckt. Nämlich dieses: Man solle nie etwas tun, was man von sich selber nicht wünscht, dass es einem angetan wird. Fertig.
Darin ist bereits alles umfassend enthalten; es ist die Reduktion der Zehn Gebote auf nur ein einziges. Verdampft dabei sind die überflüssigen Regeln für die Religion und ihre Götter, zu deren Existenz nicht der Hauch von wissenschaftlichen Nachweisen vorliegt.“
Joseph Freyman überlegte sich, in welchem Umfeld sie ihre zum Teil schlecht widerlegbaren Weisheiten wohl aufgeschnappt haben könnte.
„Woher hast du eigentlich all diese Ideen? In welchen Kreisen verkehrst du denn?“, fragte er, während ihm gleichzeitig bewusst wurde, wie wenig er sich wegen seiner beruflichen Auslastung um seine Kinder, besonders aber um seine Töchter, bisher gekümmert hatte.
„Es soll Leute geben, denen Spirituelles wichtiger ist als Materielles“, gab Rose schnippisch zurück. „Aus Queens kommt öfter eine Gruppe indischer Schüler und Studenten in den Central Park, um dort im Schatten der Bäume zu philosophieren. Sehr nette und vor allem sehr feinsinnige Menschen. Sie haben mich bereitwillig zuhören und auch an ihren Gesprächen teilnehmen lassen. Ich habe von ihnen weit mehr gelernt als die letzten Jahre in der Schule“
Ihr Vater hörte die Bewunderung über die von ihr gemachten Erfahrungen mit diesen Angehörigen einer fremden und friedfertigen Religion aus jedem ihrer Worte heraus.
„Ich habe mich im Rahmen meiner Arbeit auch intensiv mit indischer Architektur befasst“, sagte er, weil er glaubte, sich rechtfertigen zu müssen, „und ich habe dabei tatsächlich gespürt - oder sagen wir mal, ich glaubte wenigstens, zu spüren - dass im asiatischen Raum für die Baumeister Ideelles schon das Maß der Dinge ist - oder es mindestens war.
Ja, das fehlt in unserer Kultur. Nicht völlig, aber es fließt nicht stark genug in unsere Denkweise ein.“
Um sein eigenes Schaffen nicht gänzlich in Frage zu stellen, fügte er noch hinzu: „Ich jedenfalls habe mich immer darum bemüht, das zu berücksichtigen.“
Rose wurde jetzt etwas allgemeiner.
„Weiß du Dad, es ist tatsächlich eine Frage des Glaubens, der Erziehung, der Religion letztendlich, soweit sie für die Erziehung maßgeblich ist. Und das ist sie bei uns.
Schau, in den polytheistischen Religionen suchen die Menschen nach Erleuchtung - meist ihr ganzes Leben lang.
In den monotheistischen Glaubensgemeinschaften dagegen, vor allem meine ich damit die katholische, da glauben sie sich bereits erleuchtet.
Vor allem der anmaßende Klerus, der sich damit über die Gemeinde der Gläubigen erhöht und sich dadurch das Recht herausnimmt, sie mit ihrem angeblichen Sendungsauftrag zu drangsalieren und zu beherrschen.“
„Die haben dich ganz schön indoktriniert, deine feinsinnigen Freunde“, merkte Joseph Freyman leicht spöttisch an.
Aber er musste auch zugeben: „Im Grunde haben sie schon Recht, aber die Gesellschaften entwickeln sich eben unterschiedlich im Lauf von Jahrhunderten. Eine Religion sollte grundsätzlich auch nicht mehr sein, als eine grobe Orientierungshilfe für die Allgemeinheit. Jeder einzelne Mensch aber muss für sich selbst seinen ethischen Standard festlegen und ihn dann auch befolgen.“
Soviel an fortschrittlichem Denken hatte Rose ihrem Vater gar nicht zugetraut. Es waren ja fast ihre eigenen Worte. Sie war baff. Hatte ihn wohl unterschätzt. Sie fürchtete, sie habe ihm in Gedanken Unrecht getan.
„Tut mir leid, Dad, dass ich dich reaktionärer eingeschätzt habe als du offenbar bist. Aber wir kennen uns scheinbar zu wenig. Bisher haben wir uns ja auch vor allem über Fragen zu korrektem Benehmen, Schulnoten und Geschenke zu irgendwelchen Festtagen unterhalten.
Weißt du was? Ich möchte dich gerne zu einem Eis in die neue Eisdiele gegenüber einladen, ins ‚Venezia‘.
Ein Cousin von Ricarda und Greg hat sie vor drei Wochen direkt neben dem Obstgeschäft der Delanos eröffnet. Sie haben es sehr gemütlich eingerichtet. Da können wir einmal in aller Ruhe und vom Rest der Familie völlig ungestört über Gott und die Welt quatschen.“
„Okay“. Joseph Freyman zog seinen abgewetzten Terminkalender aus der Gesäßtasche seiner Hose, um einen freien Termin für diese Unterredung herauszusuchen, zu der ihn seine Tochter soeben eingeladen hatte.
Er hatte ihn zum Glück noch nicht aufgeschlagen, da wurde ihm gerade noch bewusst, dass er gerade im Begriff war, eine der größten Dummheiten seines Lebens zu begehen.
Er hob schnell seinen Hintern etwas vom Stuhl hoch und setzte sich dann wieder. Verlegen brummelte er: „Dieses verdammte Büchlein ist so unbequem beim Sitzen“, und warf es neben einen Stapel Zeitungen, die auf dem Tisch lagen. Dann legte er mit ausgestrecktem Arm die rechte Handfläche auf den Tisch, hob sie einmal kurz hoch und patschte sie zurück auf die Tischplatte.
„Rose, das ist eine gute Idee, das machen wir; wann immer du willst, ich freue mich schon darauf.“
Er wirkte erleichtert. Geradezu aufgekratzt. Aber nicht nur, weil er gerade noch die Kurve gekriegt hatte.
Deswegen auch, aber vor allem deshalb, weil es ihm endlich einmal gelungen war, über seinen eigenen Schatten zu springen und der Familie Vorrang gegenüber irgendwelchen geschäftlichen Terminen einzuräumen.
Rose konnte er mit seinem durchsichtigen Manöver nicht täuschen. Sie wusste genau, was er mit seinem Notizbuch eigentlich vorgehabt hatte. Tausende Male hatte sie gesehen, wie er zu allen möglichen Gelegenheiten, zu den privatesten Festen sogar, als erstes diesen Kalender zu Rate gezogen hatte. Sie vermutete gar, dass er auch seinen eigenen Hochzeitstermin dem Diktat dieses schwarzen Büchleins unterworfen hatte. Umso mehr freute sie sich nun über den überraschenden Sinneswandel ihres Vaters.
Sie war einfach glücklich.
Sie nickte nur heftig mit dem Kopf, den Tränen nahe, antwortete aber nicht. Rose hatte Bedenken, ihre Stimme verriete ihm zu viel von ihrer Freude. Und gegenüber einem Mann hätte sie das in ihrem jugendlichen Eigensinn als eine Art Unterwerfung angesehen - auch wenn dieser Mann ihr eigener Vater war.
Selbst wenn sie sich jetzt zu den Bibelstunden gemeldet hatte, die angeblich ihre Qualifikation zum Eintritt in ein Kloster feststellen sollten, so war Rose doch eher zur Revolutionärin denn als Nonne geeignet.
Das offenbarte sie mit all ihren Ansichten, die sie auch freimütig äußerte. Und mit den Schlüssen, die sie aus ihrem bereits angesammelten umfangreichen Wissen zog.
Wenn Mutter zur obligatorischen Kaffeestunde mit ihren engeren Freundinnen über die Aktionen der Frauenrechtlerinnen und die Entwicklung ihrer Organisationen diskutierte, dann spitzte sie regelmäßig die Ohren.
Fast schon andächtig saß sie dann auf ihrem Stuhl und hörte aufmerksam zu, wenn in dieser Runde von Emmeline Pankhurst die Rede war – einer der bekanntesten Protagonisten unter den avantgardistischen Protestlerinnen und deren inzwischen zahlreichen Sympathisanten.
Sie fand es überaus lustig, wie sich die vor ihr sitzenden gehorsamen Vertreterinnen der Rolle, die ihnen von der Gesellschaft zugedacht war, anfangs über das ‚aufmüpfige Weibsvolk‘ geäußert hatten. Inzwischen hörten sich die Unterhaltungen über die immer erfolgreicheren Suffragetten weit respektvoller an.
Der aus England gerade in die USA schwappenden feministischen Bewegung gehörte ihre ganze Aufmerksamkeit. Und das mit ihren erst vierzehn Jahren.
Rose hatte immer schon alles wissen wollen und machte sich Gedanken über alles Mögliche. Mit sechs hatte sie ihre Mutter während eines Spazierganges im Central Park plötzlich gefragt, warum den Schmetterlingen bei ihrem doch so schaukelnden Geflattere nie schwindlig wird.
Rose war in vielfacher Hinsicht reifer als ihre Altersgenossinnen - und auch reifer als manche Erwachsene.
Und der bedauernswerte John?
Statt mit Gleichgesinnten auf der Straße toben zu dürfenunauffällig, was ja ohnehin untersagt war, oder wenigstens unbeaufsichtigt zu Hause bleiben zu dürfen, wurde er jetzt montags von Rose zu ihrem Unterricht mitgeschleppt. Was Eltern aus Fürsorge zur Sicherheit ihrer Kinder beschließen, wird von denen oft als Strafe wahrgenommen.
Immerhin musste John nicht auch noch selber den Bibelstunden beiwohnen.
Das wäre aus ganz bestimmten Gründen auch alles andere als im Sinne von Vater O’Reilly gewesen. Da fand sich eine andere, für ihn wesentlich günstigere Lösung.
Es gab einige als stichhaltig eingestufte Gründe in der Familie, dass man diese montägliche Aufsichtspflicht gegenüber John gerade Rose übertragen hatte.
Zum einen hatten montags beide Hausmädchen der Freymans üblicherweise ihren freien Tag. Nur zu ganz besonderen Anlässen wurde diese Regel durchbrochen. Die zwei Filipinas hatten diesen für die Familie ungünstigen Dienstplan ausgehandelt, obwohl Joseph Freyman zuerst heftigen Protest dagegen eingelegt hatte. Aber da die zwei Mädchen sonst niemanden in der Stadt kannten, konnte man ihnen schlecht zumuten, immer alleine auszugehen.
Der Patron hatte sich schließlich geschlagen gegeben und etwas widerwillig in diese Regelung eingewilligt.
Diese beiden fielen also aus.
Mrs. Freyman selbst konnte sich nicht um John kümmern, da sie jeden Montag am späten Nachmittag das Haus verließ, um sich mit anderen Mitgliedern ihres Wohltätigkeitsvereins zu treffen. Die spendierfreudigen Damen hatten großes Vergnügen daran, das von ihren Gatten emsig herbeigeschaffte Vermögen, wohl dosiert verteilt, in eigenes gutes Gewissen umzumünzen.
Gerade jetzt konnte Madame diese Treffen unmöglich aussetzen. Sie ging momentan ganz in ihrem neuesten Projekt auf, das darin bestand, ausreichend Geld zu sammeln, um den aktuell sehr populären Sänger Enrico Caruso für ein privates Engagement zu gewinnen.
Das war dringlich, denn man wusste nicht, für wie lange Zeit sich der Barde noch in den USA aufhalten werde.
Sein Auftritt sollte im Hause der Freymans, in dem großen Ballsaal, stattfinden. Dann wollten sie das Zehnfache der Gage als Eintritt auf die Gäste umlegen und den auf diese Weise erwirtschafteten Überschuss dem Waisenhaus am Battery Park zukommen lassen.
Keineswegs wollten sie sich selber im Glanze des berühmten Tenors sonnen, ganz gewiss nicht; das beteuerten sie sich gegenseitig und anderen gegenüber immer wieder. Nein, es ging ausschließlich um die Spenden für eine gute Sache.
Diese so wichtige Angelegenheit also duldete auch keinen Aufschub und so war auch Mrs. Freyman, gerade jetzt, montags absolut unabkömmlich.
Sie fiel also aus.
Es kam bedauerlicherweise hinzu, dass Mary-Ann ausgerechnet montags zur betreffenden Zeit ihren Klavierunterricht hatte. Den durfte sie auch auf gar keinen Fall versäumen. Auf einem der nächsten großen Feste der Freymans, mit dem man die Fertigstellung eines bedeutenden Bauprojektes am Vernon Boulevard feiern würde, sollte sie eine erste Kostprobe ihres Könnens geben.
Und da mochte die Familie sich unter keinen Umständen mit ihr blamieren. Also musste sie fleißig lernen und üben.
Das große Talent der Mutter, die damit jederzeit eine große Karriere als Pianistin hätte machen können, war allen bekannt. Zu Mary-Anns Leidwesen hatte sie nur sehr spärlich davon abbekommen. Also musste sie die fehlende Begabung durch entsprechenden Eifer und Fleiß ersetzen.
Sie fiel also aus.
Blieb nur noch Rose.
Die durfte folglich zur Bibelstunde nur unter der Auflage, dass sie John mitnehmen könne. Damit war die Sache scheinbar von vornherein erledigt.
Dachten die Eltern.
Ihnen war die Teilnahme an diesen Stunden ohnehin eher suspekt. Es war sicher unmöglich, zu solchen Veranstaltungen kleine Jungs mitnehmen zu können. Darauf zählten sie.
Sie hatten sich getäuscht.
Es war möglich. Weil neben dem Haus des Pfarrers auch seine Haushälterin lebte, die an anderen Tagen neben ihren Aufgaben im Haushalt auch einen kleinen Kindergarten betreute. Eltern, Mütter oder Väter, die gerade eine Messe besuchten oder auch nur zum Beten kamen, konnten dort ihren Nachwuchs für die Zeit des Gottesdienstes oder des Gebetes in Obhut geben. Damit sie in ihrer Andacht ungestört seien.
Die gute Frau hatte sich auf Nachfrage bereit erklärt, während der montäglichen Bibelstunde von Vater O’Reilly auf John aufzupassen. Seine Zusage auf ein erkleckliches Entgelt für diese zusätzliche Aufgabe hatte sie wohl überzeugt.
Die gutmütige und duldsame Frau kannte wegen ihrer langjährigen Erfahrung im Umgang mit kleinen Kindern ausreichend Geschichten und Spiele, mit denen sie John die Wartezeit unterhaltsam verkürzen konnte.
Am ersten Abend konnte Vater O’Reilly vierzehn Teilnehmerinnen begrüßen. Mit so vielen hatte er gar nicht gerechnet. Da saßen sie nun, gespannt, erwartungsvoll - und harrten der Dinge, die da kommen sollten.
Rose verhielt sich abwartend und wollte die erste Stunde erst einmal nur zuhören. Sie verhielt sich so unauffällig wie es ihr möglich war. Und so verlief die Unterrichtung exakt so, wie es Vater O’Reilly vorgesehen hatte. Er musterte die Mädchen der Reihe nach, lange, und jede einzeln, so als ob er bereits eine Vorauswahl treffen wolle. Die etwas älteren Mädchen begriffen schnell, welches Spiel hier gespielt werden sollte; die Reise nach Jerusalem war es sicher nicht.
Dass der Gottesmann in seiner Gerechtigkeit auch die weniger frommen Kinder in seiner Zuneigung keineswegs ausschließen wollte, das bewies er nachdrücklich durch die zärtlichen Berührungen, mit denen er ausnahmslos alle der Teilnehmerinnen bedachte.
Manchen der Mädchen war dieses Verhalten mehr als unangenehm. Einige erzählten nach dieser ersten Stunde auch ihren Eltern davon, wie der Herr Pfarrer das Jesuswort ‚Lasset die Kinder zu mir kommen‘ auszulegen pflegte.
Die Reaktionen waren typisch für Menschen, die keinen Ärger mit Schule oder Pfarrhaus haben wollten.
Am zweiten Montag waren sie nur noch zu fünft.
Die anderen hatten abgesagt, fast alle aus vorgeschobenen Zeitgründen. Klavierstunde, Geigenstunde, Flötenstunde, Gesangsstunde, Bastelstunde, Sportstunde – und was ihnen oder ihren Eltern sonst noch alles eingefallen war. Zu mehr als zu diesen Absagen hatten sie keinen Mut.
Dabei wäre es erforderlich gewesen, diesem Burschen unter allen Umständen sofort das Handwerk zu legen.
Aber man durfte sich ja nicht so einfach gegen den Sprengel wenden. Das ging gar nicht.
Was sollten denn die von einem denken! Was könnte das für Folgen für sie selber haben?
Und noch war ja auch gar nichts passiert. Man hatte nichts Konkretes in der Hand, nur Vermutungen.
Vater O’Reilly lobte derweil den Wissensdurst und vor allem die Beständigkeit der verbliebenen Schülerinnen.
Diese Eigenschaften seien eine der unabdingbaren Voraussetzungen ‚für den höheren Dienst am Schöpfer unseres Universums‘, wie er es gestelzt in Worte kleidete.
Und weiter: ‚Er habe schon geahnt, dass nicht alle Schülerinnen der ersten Stunde die spirituelle Kraft hätten, sich im Herrn zu ergehen‘.
Die Mädchen sahen seine Worte als Lob, obwohl kaum eine so richtig verstand, was er damit meinte.
Am dritten Tag des Kursus sah sich Rose zu ihrer Überraschung völlig allein im Unterrichtsraum sitzen.
Niemand da, außer ihr. Merkwürdig.
Keines der anderen Mädchen allerdings hatte sich dieses Mal von sich aus verweigert oder war von seinen Eltern von der Teilnahme abgehalten worden.
Der Priester seinerseits hatte ihnen abgesagt.
Mit der vorgeschützten Begründung, er habe an diesem Tag anderweitig zu tun.
Rose saß verdutzt auf ihrem Stuhl und grübelte darüber nach, was es wohl bedeuten könne, dass heute außer ihr niemand gekommen war. Hatten die bisher Verbliebenen nun auch alle abgesagt, außer ihr?
Oder war das eine besondere Form des Nachsitzens? Eine Art Strafe für ihr vorlautes Verhalten am letzten Montag?
Sie hatte die Woche zuvor während der Stunde etliche Male recht schnippisch auf einige Fragen des Priesters geantwortet. Da konnte sie eine disziplinierende Maßnahme seinerseits nicht ausschließen.
Vater O’Reilly kam zur Tür herein. Seine Mine wirkte alles andere als streng.
Er war ein sehr gutmütig, fast sanft wirkender Mann, der auf dem Weg zu seinen Fünfzigern schon ein gutes Stück weit vorangekommen war.
„Rose, mein Kind“, begann er, und faltete die Hände, „viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Du aber, du bist schon durch deine Klugheit gesegnet. Vielleicht willst du sie in den Dienst des Herrn stellen und dich hingeben, auf dass der Segen des Himmels dir vollends zuteil werde.“
Dann setzte er sich neben sie.
Bin gespannt, was der jetzt vorhat, dachte Rose.
Sie sollte es gleich erfahren.