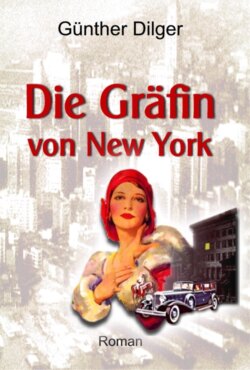Читать книгу Die Gräfin von New York - Günther Dilger - Страница 5
Rätselhafter Mord in Hendersonville
ОглавлениеHier konnte man nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Bereits auf den ersten Blick war ihm das klar geworden. Dazu brauchte man auch gewiss keine besonderen medizinischen Kenntnisse.
Schon der Anblick war so entsetzlich und erschütternd, dass Gregory Delano urplötzlich das scheußliche Gefühl hatte, sein Magen drehe sich gerade um. Während ihn im gleichen Moment ein heftiger Würgereiz plagte.
Der in New York ausgebildete Cop, jetzt Sheriff in Hendersonville, hatte in seinem Leben schon viele Abscheulichkeiten gesehen. Aber was Gregory Delano hier zu Gesicht bekam, das raubte ihm schier die Fassung.
Es schien nicht nur das Ergebnis brutaler Gewalt; es konnte nur der finale Akt einer rasenden Blutrunst gewesen sein. Die Tat eines barbarischen Sadisten, einer wahren Ausgeburt der Hölle.
In diesem ersten, so verstörenden Augenblick ahnte der junge Polizist nicht ansatzweise, in welchem Ausmaß dieses scheußliche Verbrechen bald sein eigenes Leben beeinflussen und durcheinanderwirbeln sollte.
Gregory Delano hatte im Jahr 1926 mit seinen erst einundzwanzig Jahren auf eine vielversprechende Karriere im New Yorker Police Department verzichtet. Stattdessen hatte er, aus ganz persönlichen Gründen, den Posten des Sheriffs in dem kleinen Örtchen Hendersonville in West Virginia übernommen. Im Lauf der Jahre hatte er die Stadt zu einem schon fast beschaulichen Hort der Sicherheit gemacht. Noch nie seit seinem Dienstantritt hatte es eine Bluttat in dieser grausigen Brutalität gegeben.
Jetzt schwor er angesichts des grausigen Anblicks beim Leben seiner Mutter - und gleich auch noch beim Leben seiner Großmutter - den Täter unter allen Umständen schnell zu fassen und zur Rechenschaft zu ziehen.
Das war er seiner Ehre schuldig. Schließlich war er italienischer Abstammung und hatte den Stolz schon mit der Muttermilch eingesogen.
Ich krieg dich - tot oder lebendig! – dieser in leidenschaftlicher Entschlossenheit gefasste Vorsatz war nicht nur ein banaler Schwur, es bedeutete für ihn nichts weniger als ein heiliges Gelübde.
‚Tot oder lebendig‘. In der Aufgebrachtheit des Moments war der zweite Teil der Formel ‚…oder lebendig‘ eine rein theoretische Möglichkeit, die er erst gar nicht ernsthaft in Erwägung zog.
Diesen Eid leistete der sonst eher besonnen und kühl agierende Sheriff nicht nur wegen der verübten Grausamkeit gegenüber dem vor ihm liegenden Opfer. Er tat es vor allem deswegen, weil der Leidtragende kein Unbekannter für ihn war. Der Tote, der so unfassbar barbarisch und schändlich zugerichtet vor ihm lag, war sein langjähriger guter Freund.
Es war John Freyman.
Der ältere Junior, wie ihn manche in Anspielung auf seinen viel jüngeren Bruder Dorian nannten, von dem man nicht so genau wusste, ob er tatsächlich sein Bruder war.
Schon seit ihren frühesten gemeinsamen Kindertagen in New York waren John und er besonders enge Kumpels gewesen. Das hatte seine Gründe. Vertraute, Verbündete waren sie - ungeachtet der Tatsache, dass John zehn Jahre älter war als er. John war sein allerbester Freund gewesen, schon mehr so etwas wie sein eigener Bruder.
Der bohrende Schmerz über den unersetzlichen Verlust eines so nahestehenden Menschen fachte seinen Zorn auf den Mörder an, so wie Sturm einen Steppenbrand.
John Freyman war über all die Jahre seiner Ansässigkeit in Hendersonville zum großzügigen Gönner dieser beschaulichen Stadt geworden. Durch ein ganz besonderes und einzigartiges Zusammenspiel zwischen Topologie und Fauna auf seinem hiesigen ausgedehnten Besitztum hatte er, der schon von Haus aus wohlsituiert war, noch zusätzlich ein gewaltiges Vermögen gemacht.
Gregory Delano wiederum hatte wegen ihm seine aussichtsreiche Zukunft im New Yorker Polizeiapparat aufgegeben und gegen den vakanten Sheriffsposten in Hendersonville eingetauscht. Nur um in der Nähe seines Jugendfreundes John leben zu können.
Jetzt lag dieser Freund, in Rückenlage und in erbärmlich zugerichteten Zustand, vor dem Sheriff auf seinem Bett: mausetot, starr, und bettelarm. All sein bisheriges Eigentum gehörte bereits seinen Erben.
Und das einzige, was ein Toter noch besitzen kann, seine Würde - derer hatte man ihn auch noch beraubt.
An den beiden Handgelenken war John Freyman, mit weit ausgestreckten Armen, an die zwei oberen Bettpfosten gefesselt. Die Fußknöchel waren festgebunden an den zwei unteren. Die abgeschürfte, blutunterlaufene Haut an den Stellen, an denen die dünnen Lederriemen angelegt waren, zeugte von verzweifelten Versuchen, sich zu befreien. Sein wachsgraues Antlitz war versteinert zu einer schmerzverzerrten Totenmaske.
Der Anblick eines solchen Gesichtes, das in der Sekunde des Todes die letzte Pein widerspiegelt, war nicht wirklich neu für den Sheriff.
Der Grund für die unendliche Abscheu, die er für den abartigen Mörder empfand, das war der erbarmungswürdige Zustand des Leibes von John Freyman.
Mit einem langen glatten Schnitt hatte ihm der Täter ab dem letzten Rippenbogen die Bauchdecke aufgeschlitzt, bis hinunter zum Schambein.
Sein Penis samt Hoden lag, in Blut getränkt, wie in jähem Zorn hingeschleudert, am Boden, auf dem Bettvorleger.
Auf der weißen Marmorplatte des Nachttisches befand sich ein blutverschmiertes, übergroßes Messer. Bei einem Pferdemetzger hatte der Sheriff eines in ähnlicher Größe vor einiger Zeit schon einmal gesehen.
Offenbar mit einem in das Blut des Opfers getauchten Finger waren auf die milchig schimmernde Steinplatte undeutlich drei einzelne Worte hingeschmiert.
Erst bei genauerem Hinsehen konnte Sheriff Delano sie schließlich unzweideutig erkennen:
‚tit for tat‘, Zug um Zug.
Das Gedärm und andere Eingeweide waren teilweise aus der gewaltsam gezogenen Körperöffnung herausgequollen. Und mit dem blutverschmierten Messer auf dem Nachtkasten waren sie allem Anschein nach freigelegt worden.
An einigen Stellen sah es so aus, als ob in dem offenliegenden Bauchinhalt herumgewühlt worden sei. Als ob man darin etwas gesucht hätte - oder die Innereien einfach mit kruder Lust durcheinander bringen wollte.
Eindeutig war das nicht erkennbar; hier war dann doch medizinischer Sachverstand vonnöten. Der Arzt, der den Totenschein ausstellt, musste darüber befinden.
Der sollte jetzt ganz schnell kommen, am besten gleich zusammen mit dem Bestatter. Schon krochen im warmen Licht der Morgensonne die ersten, schillernd glänzenden Fliegen im halbgetrockneten Blut auf den Innereien herum.
Gregory wandte sich angeekelt ab.
Er hielt sich die Hand vor den Mund und drückte mit Daumen und Zeigefinger die Nasenflügel gegeneinander. Der penetrante Geruch beginnender Verwesung war nur schwer zu ertragen.
Dennoch trat er rasch noch einmal an seinen verstümmelten Freund heran und drückte ihm als letztmöglichen Freundesdienst die Lider über die weit aufgerissenen Augen.
Gregory schämte sich kein bisschen darüber, dass seine Hände dabei leicht zitterten. Warum sollte er auch?
Es war der sichtbare Ausdruck seines tiefen Mitgefühls für John. Ausdruck auch des Leids, das ihm selber durch den Tod des besten Freundes zugefügt worden war.
Mit einem letzten kurzen Kopfnicken nahm er Abschied vom so eng vertrauten Freund. Seine Kehle fühlte sich an wie zugeschnürt.
Mit dem schlechten Gefühl, seinen Gefährten jetzt für immer alleine zu lassen, wandte er sich ab und begab sich hinüber zur anderen Seite des Bettes. Dort lag, gleich daneben auf dem Boden, die Gattin seines Freundes. Sie hatte der Mörder immerhin nicht so grausig verstümmelt.
Erst den Tag davor hatte John sie geehelicht. Es war keine gewöhnliche Hochzeit, ein rauschendes Fest war es gewesen. Nicht einmal die Feier zur Aufhebung der Prohibition eine Woche zuvor hatte da mithalten können.
Vor der Trauung hatte Mrs. Freyman noch Sandra Brown geheißen; und alle unverheirateten Männer in Hendersonville hatten sich bis zu diesem amtlich besiegelten Zeitpunkt noch immer Hoffnung auf die Gunst dieser so attraktiven jungen Frau gemacht.
Und nicht nur die unverheirateten, auch eine bemerkenswerte Anzahl der verheirateten Männer in der Stadt spielte mit dem Gedanken, sie für sich zu gewinnen.
So manch einer von ihnen hätte für die schöne Sandra ohne Bedenken seine Frau verlassen – und einige auch trotz ihrer Bedenken.
In Gedanken waren viele Ehemänner in der Stadt ihren angeheirateten Damen wegen Sandra schon längst untreu geworden. Und diese Ausflüge in ihre amourösen Luftschlösser waren auch nicht ganz unverständlich.
Sandra Brown war eine junge Frau, bei deren Anblick man unwillkürlich innehielt. Und das ging nicht nur Männern so, aber denen natürlich ganz besonders. Und Sandra machte das sogenannte starke Geschlecht, was das Verhältnis zu ihr betraf, im Handumdrehen zum schwachen.
Sie verdrehte ihnen völlig den Kopf.
Auch die Frauen verfielen ihr insgeheim, versuchten, ihr nachzueifern. Sie fingen an, das Haar so zu tragen wie sie, ihren Kleidungsstil zu imitieren oder gar ihre Sprechweise nachzuahmen. Vor allem bei jenen Damen, die von der Natur bezüglich ihres Aussehens eher stiefmütterlich bedacht waren, wirkte solch Nachäfferei geradezu peinlich.
Sandra Brown war eine außergewöhnlich attraktive Erscheinung, zu der es in ganz Hendersonville keinerlei Entsprechung gab. Und sicher auch keine, hätte man ein weitaus größeres Umfeld zu solchen Vergleichen mit einbezogen. Und sei es gleich das ganze County.
Ein schönes, ebenmäßiges Gesicht, als hätte es ein Maler nach seinen Idealvorstellungen auf Leinwand gebannt. Kindliche Züge im heranreifenden Antlitz, die in jedem Mann sofort den Beschützerinstinkt wachriefen.
Augen in einem strahlenden Grün, die geheimnisvoll aufzuflammen schienen, wenn sie jemanden ansah. Augen, die den Eindruck vermittelten, sie könne einem damit direkt in die Seele schauen - und die einem gleichzeitig vorgaukelten, Einblick in ihre eigene zu geben.
Eine wohlgeformte Nase, die Haut wie Alabaster. Das engelhafte Angesicht eingerahmt in schulterlanges, ganz leicht gelocktes, hellblondes Haar; mit natürlich eingewebten, fast weißen Strähnen. Im Licht der Sonne loderte diese Haarpracht in einem eigentümlichen Glanz.
Manche ihrer bekennenden Verehrer versicherten in heillosem Überschwang: „Man muss erst in persönlichem Kontakt mit ihr treten und dabei ihre liebenswürdige Natur und ihre menschliche Wesensart kennenlernen, um sie nicht einer ganz anderen Welt zuzuordnen.“
„Ja, da ist schon ein bisschen was dran, trotzdem muss man nicht gleich so übertreiben“, sagten kopfschüttelnd die eher nüchtern denkenden Menschen dazu.
Die von so vielen begehrte vormalige Sandra Brown, mit dem vielgerühmten Engelsgesicht, lag jetzt völlig reglos vor Gregory Delano, halb auf die Seite gedreht; auf dem blutbesudelten Bettvorleger neben ihrer zerwühlten Schlafstatt.
Ihre Augen waren geschlossen. Mit einem Strick um Beine und Bauch war sie an den Fuß an der Stirnseite des Bettes gebunden. Nichts an ihr glich mehr einem überirdischen Wesen aus einer anderen Welt.
Blutverschmiertes Haar hing ihr strähnig und glanzlos ins Gesicht. Nichts darin loderte mehr.
Ihr Nachthemd, halb hochgezogen, über und über beschmutzt durch bräunliche und rötliche Flecken von getrocknetem und halb getrockneten Blut.
Offene, an den Rändern teilweise bereits schwarz-rot verkrustete Wunden an rechtem Arm und Oberschenkel.
Kein schöner Anblick.
Gregory Delano, auch einer dieser bis gestern noch hoffnungsvollen Unverheirateten, sah, dass die Frau eine bedrohliche Menge an Blut verloren haben musste. Auf einen ersten Blick aber konnte er nur am rechten Arm und am rechten Oberschenkel längere Schnittwunden erkennen.
Er kniete sich nieder, beugte sich über sie und legte seinen Handrücken auf ihre Halsschlagader. Es schien noch Leben in ihrem Körper zu sein. Der Puls ging langsam. Er war so flach, dass Delano ihn kaum noch zu spüren vermochte.
Vielleicht konnte ihr noch geholfen werden. Fachkundige Hilfe müsste ihr aber binnen kürzester Zeit zuteilwerden, wenn die Erhaltung dieses Lebens halbwegs Aussicht auf Erfolg haben sollte.
Davon war der erfahrene Polizeimann überzeugt. Der flauschige Vorleger, auf dem Mrs. Freyman ausgestreckt lag, war in seiner ganzen Länge blutdurchtränkt.
Hastig richtete sich der Sheriff auf und drehte sich um. Jetzt ging es um Minuten.
In der Tür zum Schlafgemach stand immer noch Paco, der Hausverwalter und Diener, der ihn am frühen Morgen aus der Stadt geholt hatte.
Der war es auch gewesen, der seine Herrschaften beim Versuch, ihnen das Frühstück ans Bett zu bringen, im jetzigen Zustand vorgefunden hatte. Ein ziemlich zeitiges Frühstück für den Morgen nach einer Hochzeitsnacht.
Aber die Freymans wollten nicht allzu spät aufstehen. Es war eine längere Hochzeitsreise quer durch Europa geplant. Für einen der beiden, für John Freyman, war die geplante Reise schon beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Er hatte bereits seine allerletzte Reise angetreten, ohne Begleitung. Für die andere, für Sandra Freyman, stand das Ende der Reise noch nicht unumstößlich fest.
Noch war das Schicksal dabei, den Fahrplan auszuarbeiten.
„Paco, subito, mach ganz schnell, sag deiner Frau, sie soll rasch einen der Pickups direkt vor die Tür fahren; nein, nicht irgendeinen, sie soll den Chevy nehmen, der hat die größte Ladefläche von allen; und du kommst dann sofort zurück, um mir hier zu helfen. Wir müssen die Lady so schnell wie nur irgend möglich in die Stadt bringen.“
„Sí, Señor Sheriff, ya voy“, murmelte Paco eilfertig, drehte sich auf dem Absatz herum und hastete in einem Tempo die Treppe hinunter, dass seine Sporen nur so schepperten.
Paco trug die versilberten Messingsterne selbstverständlich nur aus Tradition - als Schmuck. John Freyman hätte niemals geduldet, dass er mit diesen stacheligen Dingern eines der Pferde auch nur berührte.
Bald hörte man Paco, wie er die Anweisung des Sheriffs wortreich an seine Frau Carmen weitergab; in seinem schnell und nuschlig herausgequirlten Kastilisch, bei dem nur seine Ehefrau auf Anhieb jedes Wort verstand, weil sie es von ihm seit jeher nicht anders gewöhnt war.
„Pero rápido! Y no lo olvidas: el Chevy!“, rief er ihr noch nach, ehe er selber wieder die breite geschwungene Treppe hochrannte. Wieder erklang der klirrende Wirbel seiner Sporen. An ihrem stakkatoartigen Rhythmus konnte man erkennen, dass auch er es drängend eilig hatte.
Ihm lag sehr am Leben Sandra Freymans. Das Überleben seiner Herrin konnte ihm seinen Job sichern, ihr Ableben aber vielleicht dessen Verlust bescheren.
Neben diesen existenziellen Angelegenheiten bekümmerte den Angestellten zusätzlich eine Frage, und zwar bezüglich einer Beobachtung am Abend zuvor. In Zusammenhang mit dem jetzigen Zustand seiner Arbeitgeber erachtete er sie selber alles in allem für möglicherweise sehr wichtig.
Aber er war sich wiederum nicht sicher, ob er seine Wahrnehmung vom Abend zuvor dem Sheriff anvertrauen, oder sie lieber für sich behalten solle.
Gregory Delano hatte inzwischen Sandra Freyman, die gestern noch Sandra Brown hieß, vom Fuß des Bettes losgebunden. Er fasste sie an den Schultern vorsichtig unter die Arme, während er Paco mit einer Kopfbewegung bedeutete, sie an den Füßen hoch zu nehmen.
Dann trugen die zwei Männer, so vorsichtig wie möglich, den Körper der bewusstlosen Frau Stufe für Stufe die Treppe hinunter; hinüber zur offen stehenden Eingangstür bis hin an den bereitstehenden Lieferwagen.
Begierig atmete der Sheriff die frische Luft des jungen Morgens in seine Lungen. Nach dem Aufenthalt im Zimmer mit John Freymans Leichnam wirkte der Sauerstoff auf ihn wie ein belebendes Elixier.
Der Motor des Chevrolets tuckerte bereits brummelnd im Leerlauf und Pacos Frau wartete breitbeinig auf der Ladefläche stehend, um den zwei Männern beim Hochhieven ihrer Herrin zu helfen.
Bevor sie den Wagen dicht vor die Türe rangiert hatte, musste sie noch schnell mehrere Arme voll Heu auf die hölzerne Pritsche geworfen haben, damit man die Verletzte für den Transport so schonend wie möglich betten konnte.
Gregory Delano nickte ihr anerkennend zu, als er es bemerkte. Carmen errötete vor Stolz.
Nachdem der Oberkörper von Sandra Freyman auf den Wagen gebettet war, schwang sich auch der Sheriff hinauf. Mit größter Vorsicht zog er, zusammen mit Carmen, die Bewusstlose so tief auf die Ladefläche hinein, dass Paco die hintere Bordwand schließen konnte.
Der schwarzgraue Dienstwagen des Sheriffs und die alte viertürige Ford Limousine, mit der Paco in die Stadt gefahren war, um Delano zu benachrichtigen, standen immer noch mitten auf dem Weg. Hastig und achtlos hatte man sie stehengelassen, zwischen dem Haupthaus, den Pferdeställen und dem weit offen stehenden Haupttor.
Ohne dass man ihn dazu auffordern musste, sprang Paco nach vorne, riss die Tür des Pickup auf und schwang sich auf den Fahrersitz. Noch bevor er das Kupplungspedal ganz durchgetreten hatte, stieß er den Ganghebel nach vorne. Krachend schoben sich die Zahnräder ins Getriebe.
Der Motor heulte auf, als Paco Mendez das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrückte und auf das große, offen stehende Portal zusteuerte.
Im scharfen Slalom, nur knapp zwischen den beiden anderen Wagen hindurch. Vorbei an den alten Eichenbäumen auf den schmalen, ungeteerten Weg hinaus, der entlang des Flusses zur Stadt führte.
Maria Vargas, die chilenische Köchin, saß - schon seit sie die niederschmetternde Nachricht vom Tod ihres Lieblings bekommen hatte - tief gebeugt neben dem Tor auf dem Brunnenrand und lamentierte unablässig vor sich hin.
Die zwei polnischen Stallknechte standen belämmert in ihrer Nähe herum und konnten kaum fassen, was sie ihnen gerade vorher erzählt hatte. Dem Hausmädchen hatte man bisher noch nichts gesagt.
„Yah, vamos, yah, ho, ho, ho…” Paco gebärdete sich, als säße er auf einem Kutschbock und müsse die vorgespannten Pferde zu höherem Tempo anfeuern. Als ginge es nicht um die schwer verletzte Frau hinten auf dem Wagen, sondern um sein eigenes Leben.
Gregory Delano hatte inzwischen Mrs. Freyman schützend in seinen rechten Arm genommen, um sie notdürftig festzuhalten; mit dem anderen klammerte er sich selber an der Seitenwand fest. Durch Pacos rasante Fahrt und das damit einhergehende heftige Schaukeln des Wagens rutschten die Beine der drei Mitfahrer auf der Ladefläche immer wieder von einer Seite zur anderen. Carmen hielt sich mit einer Hand an der Bordwand hinter der Fahrerkabine fest, während sie mit der anderen versuchte, wegdriftende Heubüschel wieder unter die Verletzte zu stopfen.
„Adónde vamos?“, schrie Paco mit einem schnellen Blick durch das Rückfenster, als sie in die Nähe der Abzweigung an der Brücke kamen, über die man von Hendersonville nach Charleston gelangte, der Hauptstadt des Staates West Virginia. Nur, um sich zu vergewissern - oder auch nur, um etwas gesagt zu haben.
„Zu Doktor Smirnow, in die Stadt - vor der Poststation!“, rief Gregory Delano kopfschüttelnd nach vorne ins Fahrerhaus hinein, „wohin denn sonst?“
„Bueno, esta claro“, erwiderte Paco, ohne nochmals den Kopf nach hinten zu wenden.
Er ärgerte sich, überhaupt gefragt zu haben. Aber es hätte ja auch sein können, dass der Sheriff mit der verletzten Frau in das weiter entfernte Bluefield wollte, wo es mehr als einen Arzt gab und sogar ein richtiges Krankenhaus.
Oder gleich weiter in die Hauptstadt des Countys, nach Charleston. Dort wäre die Versorgung seiner Herrin sicher die allerbeste gewesen. In diesem Fall hätte er dann an der alten Holzbrücke erst einmal nach links, Richtung Princeton, abbiegen müssen, statt nach rechts, wo die Straße nach Hendersonville hinein führte.
Und dann hätte er einmal auf dem neuen State Highway mal den Wagen so richtig laufen lassen können. Was schon immer sein Wunsch gewesen war, der sich auch heute nicht erfüllen sollte.
Na gut, in diesen anderen Fällen wäre der Weg schon erheblich weiter gewesen, vor allem nach Charleston. Der Sheriff wusste sicher genau, was das Beste für seine schwer verletzte Arbeitgeberin war.
Und wenn er die heftige Rumpelei auf seinem weich gepolsterten Sitz in Betracht zog, dann konnte er sich umso besser vorstellen, wie übel es hinten auf der harten Ladefläche für seine Mitfahrer zugehen mochte. Das war kaum zumutbar für eine längere Fahrt.
Ja, nach Hendersonville, zu dem russischen Arzt, das war wohl wirklich die vielversprechendste Adresse für das Überleben seiner Herrin. Der Sheriff hatte wohl Recht.
Es war Pacos Art, die Entscheidungen anderer auch zu seinen eigenen zu machen. Damit war er immer gut gefahren, es vereinfachte sein Leben immens. Klarer Widerspruch, oder sonst eine eigene Meinung zu haben, war ihm qua Geburt als Mexikaner in diesem Land der weißen Herren ohnehin verwehrt. Diese Erfahrung hatte er gemacht.
In diesem Land gemacht, das sich als ‚Erfinder der Menschenrechte‘ sieht, wie er es öfter bei Treffen unter Gleichgesinnten vorbrachte. ‚Sie sagen Menschen, meinen aber nur vermögende Gringos‘, warf er in solchen Diskussionen schon mal abschätzig ein.
Opportunismus mag für einen freien, unabhängigen Menschen eine abzulehnende Charaktereigenschaft sein. Einem in die Abhängigkeit hineingeborenen Menschen muss man sie aber als oft einzig mögliches Mittel zur Verbesserung seiner Lebensumstände zugestehen.
Die wilde Fahrt ging weiter.
Pacos rechter Fuß verharrte bleiern auf dem Gaspedal. Der Wagen schaukelte hin und her, schleuderte hin und wieder ganz leicht. Aber Paco hielt ihn mit beachtlichem Geschick in der Spur.
Gregory Delano war inzwischen hin und hergerissen zwischen dem Gedanken an die zügige Aufklärung des Falles, dem Gesetz zur Genüge, zur eigenen Ehre und zu Ehren des Freundes einerseits. Und andererseits dem Gedanken an eine Möglichkeit, die sich gerade vor ihm auftat. Ein Gedanke, der sich gerade verschämt in sein Gehirn einnistete.
Nämlich die durch den überraschenden Mord jetzt verwitwete Sandra Freyman zu ehelichen - nach einer gewissen Anstands- oder Schamfrist natürlich, und vorausgesetzt, sie würde ihre Verletzungen überleben.
Diese Dame war plötzlich von der vorher lediglich wunderschönen und jungen Frau jetzt noch zusätzlich um ein riesiges Vermögen aufgewertet worden. Und genau dieses Wesen lag jetzt hilflos und völlig unerwartet in seinem Arm, auf seine Fürsorge angewiesen.
Sogleich schämte der Sheriff sich über das Hochkommen solch unredlicher Gedanken und versuchte, sie gleich wieder aus seinem Kopf zu jagen. Was sein Freund John wohl zu solchem Ansinnen gesagt hätte? Oder die eigene Familie, oder die von John? Die Freymans waren ja immer noch fast vollzählig hier in Hendersonville. Außer dem jungen Dorian, der Prüfungstermine in der Schule hatte, und daher nicht zu der Hochzeit angereist war.
Eigentlich waren die Mitglieder der Familie Freyman, die er als gern gesehener Hausfreund alle bestens kannte, gekommen, um ausgelassen zu feiern und John heute zur Hochzeitsreise zu verabschieden.
Siedend heiß fiel ihm ein, dass er ihnen die niederschmetternde Botschaft von Johns Tod überbringen musste.
Er hätte viel dafür gegeben, wenn jemand dazu bereit gewesen wäre, ihm diese traurige Pflicht abzunehmen.
Um nicht an diese unangenehme Aufgabe denken zu müssen, konzentrierte Delano sich auf den Fall. Johns Mörder musste nun gefunden werden. Das war jetzt seine erste und dringlichste Aufgabe.
Gregory Delano forderte das angesichts seiner vorherigen gedanklichen Abschweifungen jetzt wieder selber von sich ein und erinnerte sich an seinen Schwur. Er beruhigte damit das aufkeimende schlechte Gewissen wegen seiner vorherigen Gedankenspiele - um dann doch gleich wieder Überlegungen anzustellen, wie hoch wohl das gesamte Vermögen sein könnte, welches Sandra nach dem Tod seines Freundes John zustehen mochte.
Letztendlich, ganz Detektiv, begann er sich jetzt aber doch vor allem zu fragen, wer denn Interesse an Johns Tod haben konnte. Das war immer der erste Ansatz seiner bisherigen Ermittlungen gewesen, der ihm schon in New York so oft zum Erfolg verholfen hatte.
Und jetzt musste es klarerweise primär um die Aufklärung dieser entsetzlichen Schandtat gehen. Alle anderen Überlegungen durften nur nachrangig sein. Sogar mit großem Abstand nachrangig.
Eines konnte der Sheriff den bisher bekannten Umständen nach und auch aus seiner Erfahrung heraus nahezu sicher schon jetzt ausschließen: Raubmord.
Die massiv silbernen Kerzenständer auf den Konsolen im Schlafzimmer waren noch dagestanden, die drei sehr bekannten und teuren Ölgemälde alter europäischer Meister, die vor allem, hingen unberührt an der Wand des Vestibüls. Die Kanadische Nationalgalerie in Ottawa hatte schon mehrmals eine beträchtliche Summe für dieses Konvolut geboten. Zweimal war ein Kurator des Museums angereist, um John Angebote zu machen. Alle Gazetten im Land hatten jedes Mal groß damit aufgemacht.
Eine professionelle Bande hätte das im Auge gehabt und sich diese fette Beute ganz sicher nicht entgehen lassen.
Die Hehler in sämtlichen Staaten der USA warteten nur darauf, diese auch von vielen weniger seriösen Sammlern begehrten Gemälde unter der Hand bei skrupellosen Kunstliebhabern an den Mann zu bringen.
Ein risikoloses Geschäft wäre das, denn der Käufer könnte die Bilder niemals öffentlich zeigen.
Nur am Besitz dürfte er sich erfreuen. Daher gäbe es auch nie eine Verbindung zwischen Hehler und Stehler.
„Nein, es wäre sicher verlorene Zeit, eine Bande zu verdächtigen und ihr auf die Spur kommen zu wollen, es muss in jedem Fall ein Einzeltäter gewesen sein. Vielleicht hatte er aber einen Helfer“, brummelte der Sheriff nach einiger Überlegung vor sich hin, während Carmen vergeblich versuchte, dieses Gemurmel zu entschlüsseln.
Einzeltäter mit Helfer? Oder Helferin? Schon möglich.
Da gab es ein Pärchen, das in Frage kam. Aber eigentlich auch wieder nicht. Noch viel weniger als mit dem Vorgehen einer Bande hatte die Tat irgendeine Ähnlichkeit mit der Handschrift von Clyde Barrow, der laut den aktuellen Meldungen der Tageszeitungen mit Bonnie Parker gerade weiter westlich im Land sein Unwesen trieb. Die zwei legten immer lange Strecken mit dem Automobil zurück, und hätten sich daher gut und gerne auch in diese Gegend verirrt haben können.
Allerdings: die beiden töteten nicht aus schierer Mordlust, wie es hier scheinbar der Fall war, sondern um sich nach einem Raub den Fluchtweg frei zu machen.
Das Pärchen hatte bis dato dazu auch ausschließlich Handfeuerwaffen benutzt, niemals Messer. Und der neue Ford V8, mit dem sie seit neuestem unterwegs waren, wäre im Ort sicher sofort aufgefallen, auch ihm selbst. Bonnie und Clyde? Nein, und nochmals nein.
Hieran einen weiteren Gedanken zu verschwenden, erübrigte sich also auch.
In diesen unsicheren Zeiten war aber nicht nur dieses landesweit bekannte, schon fast zu Helden stilisierte Kriminellen-Duo unterwegs.
Eine beunruhigend hohe Anzahl der vielen Arbeitslosen aufgrund der Großen Depression glaubte ebenfalls, sich nur durch Verbrechen über Wasser halten zu können.
Immerhin, hier in diesem Staat hielt sich die Kriminalität immer noch in Grenzen. Vielleicht weil West Virginia schon immer einer der ärmeren Staaten in der Föderation war und die Leute hier seit jeher an eine kargere Lebensweise gewöhnt waren.
Auch Hendersonville war alles andere als ein Eldorado, wenn auch einige erfolgreiche Züchter es zu größerem Vermögen gebracht hatten und ihre großzügigen Anwesen das auch deutlich sichtbar machten.
Aber in den Häusern der durchschnittlichen Einkommensbezieher gab es kaum Sachen von Wert zu holen. Und die wenigen Häuser der Wohlhabenden waren durch Sicherheitseinrichtungen bestens geschützt.
Eigentlich galt das auch für John Freymans Domizil.
Schon merkwürdig, dass der Täter so unbehelligt in das Haus kommen konnte.
Delano nahm sich jedenfalls vor, auch die Angestellten auf dem Anwesen genauestens unter die Lupe zu nehmen.
Paco Mendez war zwar nicht als gewalttätig bekannt, aber aus seinen Ansichten über die Ungerechtigkeit der ‚Gringos‘ machte er kein Geheimnis. Und die polnischen Stallburschen? Stille und fleißige Arbeiter. Aber wie man so sagt: stille Wasser gründen oft tief.
Ein heftiger, nicht beigelegter Streit also zwischen einem der Angestellten und dem Patron? Aufgestauter Hass?
Dann grausame Rache?
Diese Möglichkeit musste man jedenfalls in Betracht ziehen.
Kleinkriminelle Räuber kamen ja auch kaum in Frage: Johns goldener Ring mit zwei hochkarätigen Brillanten steckte noch an seinem Finger. Seine massiv goldene Armbanduhr lag immer noch auf dem Nachttischchen, wo er sie nachts immer abzulegen pflegte. Nur mit ein paar Blutspritzern befleckt hatte Delano sie vorgefunden. Für den Wert von edlen Uhren und Schmuck hatte auch die zweite Garnitur der Verbrecher ein sicheres Auge.
Mochten vielleicht auch bisher noch unbekannte Wertgegenstände fehlen, was noch zu ermitteln wäre; eines vor allem passte nie und nimmer zu einem Raubmord: die bestialische Art, in der John Freyman zu Tode gebracht wurde.
Hat das Schlachtermesser eine besondere Bedeutung, welches Gregory Delano in ähnlicher Form schon bei einem Pferdemetzger gesehen hatte?
War es überhaupt ein Schlachtermesser? Es konnte genauso gut ein großes Küchenmesser sein, wie sie auch in anderen herrschaftlichen Küchen Anwendung fanden. Dies musste erst geklärt werden.
John hatte ein Vermögen mit seinen schnellen Pferden gemacht. Nicht alle gönnten ihm den Erfolg. Wollte ihn also ein neidischer Konkurrent ausschalten?
John hatte sich nicht nur Freunde gemacht mit seiner prosperierenden Pferdezucht, mittlerweile nationübergreifend beachtet und mit vielen Preisen bedacht.
Vor einer Woche hatte es eine lautstarke Auseinandersetzung im Foyer des Grand Hotels mit Warren Harms gegeben. Der war einer von Johns langjährigen Konkurrenten - und als jähzornig bekannt.
Gregory Delano war dieser streitsüchtige Harms, ständig finster dreinblickend und bei jeder Gelegenheit lospolternd, noch nie sonderlich sympathisch gewesen. Aber so eine scheußliche Tat traute er ihm einfach nicht zu.
Nein, das konnte nicht sein.
Der Sheriff fand einfach keinen einzigen überzeugenden Anhaltspunkt, der ihn schnell auf eine erfolgversprechende Fährte geführt hätte. Also spannte er den Bogen weiter.
Zu Beginn seiner Aktivitäten als Züchter hatte John viel Geld auf seine eigenen, schnellen Pferde gesetzt. Die waren vor den ersten Rennen noch völlig unbekannt gewesen und liefen daher anfangs immer als krasse Außenseiter.
Nur John und seine engsten Vertrauten rund um das Gestüt wussten von ihrer außergewöhnlichen Schnelligkeit.
Seine hohen Summen auf den Sieg dieser Neulinge bei den Galoppern brach so manchem Betreiber von Wettbüros finanziell das Genick.
Manche von ihnen hatten nach ihrem Ruin sogar in aller Öffentlichkeit Rache dafür geschworen. Einige hatten sich in der ersten Erregung sogar dazu hinreißen lassen, damit zu drohen, ihn umzubringen.
Aber selbst finanzieller Ruin konnte einfach nicht der Grund dafür sein, John gleich in einer derartigen Raserei die Gedärme aus dem Leib zu reißen. Oder etwa doch?
Carmen Mendez riss Delano aus seinen Überlegungen, indem sie sich besorgt zu Wort meldete: „Mister Sheriff, wird Missi wieder gesund? Wird Missi weiterleben?“
Sie schaute dabei abwechselnd von der Verletzten zum Sheriff und wieder zu ihrer Herrin, deren Schenkel jetzt wieder anfing, leicht zu bluten.
Paco hatte ihr bereits, noch bevor er in höchster Eile in die Stadt gefahren war, um den Sheriff zu holen, die Angst um ihrer beider Jobs mit seinen schwarzmalerischen Bemerkungen in hoher Dosis eingeimpft.
Gregory Delano hatte Sandra Freyman inzwischen ebenso ausgiebig wie fachmännisch beschaut und Verletzungen und Blutverlust mit dem Blick seiner fast zehn Jahre andauernden Erfahrung abgeschätzt.
Leicht genervt wegen des rüden Fahrstils ihres Mannes antwortete er auf Carmens Frage.
„Wenn dein Mann uns mit seiner Fahrweise nicht alle umbringt, dann hat sie vielleicht Chancen.“
Carmen musste erst eine Weile überlegen, was er denn mit dieser Aussage meinte.
Der Unmut in Gregory Delanos Stimme war ihr nicht entgangen. Warum aber sollte der immer so gutmütige Paco sie alle umbringen wollen? Das verstand sie einfach nicht. Dafür hatte er doch keinerlei Grund?
Gut, öfter war er aufbrausend, manchmal gar gemein ihr gegenüber, aber richtig bösartig war Paco nie gewesen.
Nach einigem Grübeln dämmerte es ihr schließlich, was der knurrige Sheriff mit seiner Aussage gemeint hatte. Sie reagierte umgehend darauf.
„Paco, mach vorsichtig, fahr doch nicht so schnell“, rief sie nach vorne ins Fahrerhaus.
Auch sie war darauf konditioniert, jeden, der eine hellere Haut hatte, als sie selbst, als natürlichen Befehlsgeber zu sehen. Und der jetzt von ihr erkannte Sarkasmus zählte für sie zu einer Art Befehl, dem Folge zu leisten war.
„Keine Sorge, Carmencita! Hab‘ alles im Griff. Ich pass schon auf. Ich werde aber trotzdem das Gas etwas zurücknehmen“, beruhigte sie ihr Ehemann.
Paco dachte gar nicht daran, langsamer zu fahren.
Im Gegensatz zu Gregory Delano, der inzwischen überzeugt war, Sandra Freyman sei nicht ganz so schwer verletzt, dachte Paco immer noch, sie wäre dem Sterben näher als dem Leben und könne nur durch schnellsten Transport zum Arzt noch gerettet werden.
Außerdem hatte er doch die letzten zwei Jahre hintereinander das örtliche Geschicklichkeitsfahren der Chauffeure gewonnen; jeweils als schnellster und ohne einen einzigen Strafpunkt war er ins Ziel gekommen. Dieses Rennen fand immer beim neuerdings eingeführten jährlichen Autocorso zu Ehren des Stadtgründers Clark Henderson statt.
Einer der Söhne von Henderson, der ältere, Vincent Henderson, hielt dabei die erste von etlichen salbungsvollen Reden. Die Honoratioren der Stadt führten hinterher stolz ihre neuesten, auf Hochglanz polierten und mit Blumen geschmückten Automobile vor.
Ihre Angestellten und deren Freunde durften an diesem Tag mit den älteren Karren aus den Vorjahren ihre Geschicklichkeit auf einem mit zahlreichen bunten Wimpeln abgesteckten Terrain beweisen.
Von Pacos Siegen wusste natürlich auch Sheriff Delano, und so ließ er ihn in seiner Hatz gewähren, auch wenn er und Carmen alle Hände voll zu tun hatten, sich selbst, und vor allem auch die verletzte Sandra Freyman, in ihrer jeweiligen Position einigermaßen festzuhalten.
„Ist es so besser?“, schrie Paco seine Frage nach hinten, ohne dass er den Fuß auch nur um ein Jota vom Gaspedal genommen hätte.
„Ja, ist schon besser, nicht viel, aber wenigstens werden wir jetzt nicht mehr gar so arg durchgeschüttelt“, rief Carmen ihm über die Schulter zurück.
Paco grinste in sich hinein. Ihm war klar, dass sie der Suggestion erlegen war, bei der die nur scheinbare Veränderung einer Eigenschaft das gleiche Gefühl einer Auswirkung hervorruft wie eine tatsächliche Änderung. Ein Placebo-Effekt, den der sonst grundehrliche Paco bei vielen möglichen Gelegenheiten nutze, um anderen zu seinem eigenen kleinen Vorteil etwas vorzutäuschen.
Die scharfe Rechtskurve an der Brücke über den Beaver Creek war die letzte und auch die größte Herausforderung an Pacos Fahrkünste. Das rechte Hinterrad hob sich bedrohlich von der Straße ab, als er im Karacho in die Straße zur Stadt einbog.
Die zwei auf der Ladefläche hatten dabei alle Mühe, sich und die bewusstlose Frau festzuhalten.
Das Gewicht des Wagens schob die beinahe quer gestellten Vorderräder fast ganz hinüber an das Bankett der anderen Fahrbahnseite. Der Reifengummi des linken Vorderrades drückte, halb platt gepresst, gegen die innere Felgenschulter und war kurz davor, vom Rad zu rutschen.
Mit einem schnellen Schlenker am Steuer und sofortiger Korrektur wieder in die vorherige Richtung brachte Paco den Wagen im letzten Augenblick zurück in die Spur.
Hinter der Reihe von Büschen am linken Straßenrand konnte man jetzt sehen, wie sich Fetzen einer dunklen Rauchfahne zum Boden niedersenkte. Andere Teile dieser schwarzen Wolke führte ein leichter Wind mit in die Höhe hinauf und zog sie dort zu dünnen Schwaden auseinander.
Der gerade einfahrende Frühzug aus New York gab seine spezifischen Rauchzeichen ab.
Während der Lokführer damit begann, sein Tempo bei der Einfahrt nach Hendersonville langsam zu drosseln, hielt Paco den Druck aufs Gaspedal unverändert an.
Als sie die ersten Häuser von Hendersonville erreichten, schlug die Uhr am Giebel der City Hall gerade neun. Jetzt erst nahm Paco den Fuß etwas vom Gaspedal, schaltete hastig einen Gang herunter. Aber erst auf den letzten Meter vor dem Haus des Arztes bremste er den Wagen vollständig ab.
Doktor Igor Smirnow bewohnte eines der Häuser in der Main Street, zwei Blocks vom Hauptplatz entfernt. Genauer gesagt, das Eckhaus, vor dem die Derby Street rechts abging und im weiten, halbkreisförmigen Bogen um die neue Post-Station herumführte.
Er war etwas ungehalten, als er das ungestüme Klopfen an seiner Tür hörte. Für sein Empfinden eine unangenehme, viel zu frühe Störung, während er sich noch seinem Frühstück hingab. Und das war ihm heilig.
Er ließ sich jeden Morgen von seiner Haushälterin ein exquisites Gedeck kredenzen. Er verlangte es in einer Weise angerichtet, dass es auch eines Zaren würdig gewesen wäre.
Um diese unchristliche Zeit für Patientenbesuche pflegte er nach seinem mit Kaviar gefüllten Bliný noch in aller Ruhe eine zweite Tasse Schwarztee einzunehmen.
Und auf dem Schild an der Tür stand schließlich für jeden deutlich lesbar, dass seine Sprechstunde erst ab zehn Uhr begänne. Sein Gesicht drückte den Widerwillen über die Belästigung deutlich aus, als er vor die Tür trat.
Mit nur einem einzigen Blick erkannte er aber, dass es nicht um eine übliche Konsultation ging, sondern um einen dringenden Notfall.
In der blutüberströmten Verletzten glaubte er bei näherem Hinsehen überdies Sandra Brown zu erkennen, jetzt die Frau von John Freyman.
Sein Gesicht verdüsterte sich noch mehr.
Aber keineswegs wegen der Erkenntnis, dass sein Frühstück damit nicht nur unterbrochen, sondern nun definitiv vorbei sei. Das war ihm schon auf den ersten Blick klargeworden.
Nein, die Ursache war seine tiefe Betroffenheit und die große Besorgnis um den offenbar sehr schlechten Zustand der mit Blut verschmierten Patientin.
Dr. Smirnow war Arzt mit Leib und Seele.
„Dawai, dawai, bringt sie herein, legt sie im Nebenzimmer auf die Liege, macht schnell!“, ordnete er in einem reichlich forsch klingenden Ton an.
Dabei drückte seine rau fordernde Stimme nur die empfundene Anteilnahme aus. Man nahm sie nur deshalb als so resolut, fast unfreundlich, wahr, weil der härtere Klang seiner russischen Muttersprache seinem Englisch nach wie vor maßgeblich den Stempel aufdrückte.
Einige wenige Passanten, die um diese Zeit schon auf der Straße unterwegs waren, standen mittlerweile neugierig um den Lieferwagen postiert und wollten sehen, wer hier angekarrt wurde.
In dem jämmerlichen Zustand, in dem sich Sandra Freyman befand, konnte sie jedoch keiner der schaulustigen Gaffer erkennen. Ihr blutverschmiertes blondes Haar hing jetzt in Strähnen über ihr in der Stadt allgemein als ‚engelsgleich‘ bezeichnetem Gesicht und verdeckte es beinahe völlig.
„Kannst du uns nicht helfen, Igor?“, rief der Sheriff, als er sah, dass der Doktor zurück ins Haus gegangen war und sich anschickte, seinen Arztkoffer zu öffnen, um die benötigten Instrumente daraus hervorzuholen.
Der Sheriff und der Arzt kannten sich seit Jahren und sie waren auch bestens befreundet. Gregory hatte Doktor Smirnow immer mit den Worten seines Landsmannes Tolstoi aufgezogen.
Der nämlich hatte in einigen seiner Bücher die von ihm offensichtlich nicht so hoch geschätzte Kunst der Ärzteschaft immer wieder süffisant aufs Korn genommen. ‚Trotz aller Bemühungen der Ärzte wurde Iwan wieder gesund‘, flocht er zum Beispiel in beißendem Spott in den Text eines seiner Romane. In einigen anderen Schriften formulierte er es nicht ganz so bissig, der süffisante Tenor war aber stets der gleiche. Gregory Delano hatte diese Formulierung, wenn sich während ihrer häufigen Unterhaltungen oder einer der sporadischen Konsultationen die Gelegenheit ergab, dann immer umgemünzt in den frotzelnden Satz:
‚Trotz aller ärztlichen Bemühungen des Igor wurde Gregory schnell wieder gesund‘.
Dr. Igor Smirnow hatte ihm darauf regelmäßig mit einem gutmütigen Brummeln und einem mittelkräftigen Knuff an die Schulter geantwortet.
Zu Späßchen dieser Art war ihnen in der jetzigen Situation aber absolut nicht zumute.
„Ach ja, natürlich, warte kurz, ich komm schon“, rief Doktor Smirnow auf die Frage Gregory Delanos zurück, und schob seinen Koffer schnell wieder von sich weg.
Er knöpfte eilig seinen Kittel zu und eilte hinaus zu den Männern am Wagen vor der Tür.
„Jetzt geht doch mal zur Seite!“, fuhr der Sheriff die mehr als zehn Leute an, die sich mittlerweile am Wagen eingefunden hatten und sich den angespannten Akteuren in den Weg drängten. Widerwillig wichen sie zurück und machten dem Arzt und seinen beiden Helfern Platz.
„Wer ist die Frau denn, Sheriff?“, fragte einer der Umstehenden. Gregory Delano beachtete ihn gar nicht weiter, schüttelte nur verständnislos den Kopf.
Gemeinsam hoben die drei Männer Mrs. Freyman vom Wagen und verbrachten sie behutsam in das Behandlungszimmer. Dort legten sie die Verletzte, die jetzt wieder stark aus dem Oberschenkel blutete, auf die Patientenliege.
Carmen Mendez blieb auf der hinteren Kante der Ladepritsche sitzen und betete jetzt unablässig vor sich hin. Verschämt die Hände gefaltet, still - nur ihre Lippen bewegten sich im Takt der Strophen: ein Vaterunser für Sandra Brown, eines für Sandra Freyman, und zwei für den Erhalt ihrer Arbeitsstelle.
Und dann wieder von vorne.
Zu allererst kümmerte sich der Arzt um die blutende Wunde. Jeder weitere Blutverlust könnte Mrs. Freyman dem Tod ein Stück näher bringen.
Fachgerecht und in geübter Routine legte der Doktor Verbandszeug an.
„Sie kann es überleben - vielleicht“, sagte Dr. Smirnow zu Gregory gewendet, nachdem er Sandra an der Halsschlagader den Puls gefühlt, andere relevante Stellen am Körper abgetastet und eine Weile den frisch verbundenen Oberschenkel und den blutverkrusteten Arm taxiert hatte.
„Neben den Schnittwunden, die mir gar nicht gefallen, scheint sie keine anderen Verletzungen zu haben, vor allem keine inneren.
Aber der Blutverlust war erheblich - und wenn sich die Blutung nicht bald stoppen lässt…“
Er sprach nicht weiter, ließ das Ende des Satzes offen.
Der frische Verband hatte sich schon wieder leicht rot gefärbt. Der Doktor bedeutete Paco Mendez, den Behandlungsraum zu verlassen, bevor er Mrs. Freyman das leichte Nachthemd noch weiter nach oben schob, bis hinauf an die Hüfte, um sich der Wunde an ihrem Oberschenkel noch einmal gründlich annehmen zu können.
Indessen beauftragte der Sheriff den Verwalter, der sich schon zum Gehen gewandt hatte, den Leichenbestatter aufzusuchen und John Freyman so schnell wie nur irgend möglich aus dem Landhaus abholen zu lassen.
Paco drehte sich in der Tür nochmal um und bestätigte kurz seinen Auftrag, bevor er das Behandlungszimmer verließ. Kaum draußen auf der Straße, gab er die Anordnung umgehend und im gleichen Wortlaut an seine Frau weiter, die immer noch auf der Ladefläche des Pickups hockte.
Nachdem er Carmen noch schnell erklärt hatte, wo der Bestatter zu finden sei, steuerte er direkt und ohne Umschweife auf den Saloon zu, der nur zwei Häuser weiter auf der gleichen Straßenseite lag, um sich dort einen Drink zu genehmigen, oder auch zwei.
Er fand, den habe er sich nach all der Aufregung an diesem Morgen redlich verdient.
An der Theke angelangt bestellte er sich gleich einen doppelten Brandy. Als er den in sich hineingeschüttet hatte, fing er auch schon an, sich mit seinen brühwarmen Neuigkeiten beim Barkeeper und den noch wenigen anderen Gästen im Lokal wichtig zu machen. Jedem erzählte er, was er wusste, ob der es wollte oder nicht.
Georgios Asterion, in Personalunion Herausgeber, Chefredakteur und Bote des ‚Hendersonville Chronicle‘, der gerade dabei war, in der Bar sein Frühstück einzunehmen, hörte ihm aufmerksam zu. Als er vernahm, dass noch immer Lebensgefahr für Mrs. Freyman bestand, beschloss er, so lange zu warten, bis der Sheriff wieder im Büro war.
Erst dann wollte er ihn für ein Interview aufsuchen.
Asterion, von manchen scherzhaft ‚El Greco‘ genannt, erst in zweiter Generation in den USA, war zwar durch und durch Journalist, der mit dem virtuosen Umgang der Sprache seines neuen Heimatlandes die Bürger von Hendersonville begeisterte, aber in erster Linie war er Mensch.
Carmen rannte inzwischen eiligst die Hauptstraße hinunter. So wie es ihr aufgetragen war. Kurz vor den Koppeln hielt sie an. Dort, wo Carl Simpson, etwas abseitig vom Zentrum, seine Werkstatt und seinen Laden hatte.
Die selbst gezimmerten Särge mit den schön geschnitzten Applikationen waren im Verkaufsraum ausgestellt. Einige der prächtigsten Exemplare konnte man auch schon von außen durch das große Schaufenster bewundern.
Simpson war ein geachteter Bürger der Stadt - zu tun haben wollte man mit ihm allerdings so wenig wie nur irgend möglich. Das hatte nichts mit ihm persönlich zu tun. Ganz im Gegenteil. Man konnte seinen Särgen ansehen, mit welcher Hingabe und Respekt vor den Toten er sie fertigte.
Aber sein eigenes, ebenso natürliches wie unausweichliches Ende wollte man dann doch lieber verdrängen und gefälligst nicht daran erinnert werden. Da war man froh, dass er sein düsteres Geschäft etwas außerhalb betrieb.
Carmen riss die Tür zum Laden auf und stürmte hinein. Ungeduldig wartete sie darauf, bis Simpson auf das Scheppern der Türglocke hin nach einer Weile aus seiner Werkstatt herauskam.
Mit Holzhammer und Stemmeisen noch in der Hand ging er einige Schritte auf sie zu und sah sie fragend an. Als Interessentin für eines seiner Werkstücke schätzte er Carmen nicht ein.
Noch ganz außer Atem platzte die nun heraus:
„Mister, schnell, bitte schnell, holen Sie die Missis ab, sie ist ganz tot, im Casa draußen bei Señor Freyman - ach so, lo siento, nein, nicht die Missis, der Master ist tot, richtig tot. Draußen, im großen Haus, am Fluss, ganz tot. Por diós, madre ayúdanos, er ist tot, para siempre.“
Mr. Simpson reagierte so gelassen und ruhig, wie es sein der Pietät verpflichteter Beruf so mit sich bringt:
„Beruhige dich, Mädchen, ganz ruhig. Also, wer ist tot, und wer soll wo abgeholt werden?“
„Der Master, Master Freyman ist tot, soll von seinem Haus abgeholt werden, sagt Paco, draußen am Fluss.“
Carmen hatte sich wieder etwas gefangen, atmete tief durch, war jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Simpson mochte kaum glauben, was sie sagte.
„Mr. Freyman? Mr. John Freyman? Bist du ganz sicher?“
Carl Simpson hatte guten Grund für seine Nachfrage. John Freyman war gerade mal dreiunddreißig, sportlich und, soweit er wusste, bei allerbester Gesundheit.
Hatte er etwa einen Unfall mit dem Automobil gehabt? Zu schnell gefahren? Oder vielleicht einen Reitunfall? Das Genick gebrochen? John war ihm allerdings keineswegs als besonders unvorsichtig oder gar als Draufgänger bekannt. Ganz im Gegenteil.
Einmal hatte er John sogar auf offenem Gelände mit dem Pferd abgehängt.
Sie hatten sich zufällig draußen hinter den Weideplätzen beim Ausritt getroffen und ohne viele Worte, nur mit herausfordernden Blicken und beiderseitig zustimmendem Kopfnicken, ein kleines Rennen verabredet.
Am Tag zuvor hatte es stark geregnet, der Boden war tief. John hatte mehr als zwei Pferdelängen Rückstand gehabt am Ziel. Auf Simpsons schelmische Stichelei zu seinem kleinen Triumph hatte John nur gelacht und einen Satz gesagt, an dem er Johns generelle Vorsicht festmachen konnte: ‚Auf einem so schwierigen Boden werde ich lieber zweiter im Rennen als erster in deinem Sarg. Carl, da halte ich mich lieber zurück. Hals- und Beinbruch ist ein netter Spruch, an mir selbst will ich ihn nicht wahrmachen. Sorry, mein Lieber, aber mit mir wirst du so schnell kein Geschäft machen‘.
Carmen riss ihn aus seiner Erinnerung.
Der zweifelnden Nachfrage hatte sie entnommen, dass der Bestatter eventuell nicht so ganz ernst zu nehmen schien, was sie ihm gerade vorher berichtet hatte.
„Der Sheriff schickt mich, sagt Paco; der Sheriff sagt, Master Freyman ist tot. Der Sheriff hat es selber gesagt.“
„Wer bist du eigentlich? Wie heißt du denn?“, hakte Simpson ungeachtet ihrer Beteuerung noch einmal nach.
„Ich bin die Frau von Paco, wir sind Angestellte des Master Freyman und jetzt auch seiner neuen Esposa, der Missis. Der Sheriff hat gesagt, wir sollen ihnen Bescheid geben, dass der Master se murió.“
„Und wo ist der Sheriff jetzt?“
„Er ist im Haus des Doktors - bei der Missis. Die Missis ist auch krank; muy krank.“
„Gut, sag dem Sheriff, ich komme gleich vorbei.“
„Gracias, muchas gracias, danke Mr. Bestatter, ich sage es Paco, der sagt es dem Sheriff.“
Simpson hatte immer einen Sarg in Durchschnittsgröße auf seinem Bestattungswagen liegen, für den Fall der Fälle. Also könnte er losfahren, beim Doc vorbeischauen und sich vergewissern, dass dies alles auch kein makabrer Scherz oder nur ein bloßes Gerücht war.
Wenn doch, dann hätte er keinen großen Weg umsonst gemacht. Und wenn die Geschichte wahr sein sollte, dann konnte er gleich weiterfahren, hinaus zum Anwesen der Freymans. In den Sarg auf dem Wagen müsste John jedenfalls passen, fürs erste. Soviel Augenmaß für seine potenziellen Fahrgäste bekommt man als Bestatter mit der Zeit.
Und später könnte er seinen Angehörigen das teuerste Exemplar verkaufen, das er auf Lager hatte, oder für weiteres Aufgeld extra einen anfertigen. Die Freymans würden sich bestimmt nicht knausrig zeigen.
Dann könnte er jetzt, entgegen Johns damaliger Worte, doch schon jetzt sein Geschäft machen mit ihm. Früher als dieser gedacht hatte. Viel früher.
Während der pedantische Bestatter sich noch Gedanken darüber machte, ob sich seine Fuhre lohnen könnte oder nicht, rang Doktor Smirnow nach wie vor um das noch so junge Leben der verletzten Sandra Freyman.
Der Sheriff stand neben ihm, bereit, dem Arzt mit jeglicher Art von Handreichung behilflich zu sein.
Er wirkte etwas nervös, wollte etwas hinter sich bringen.
„Igor, kann ich dein Telefon benutzen, oder brauchst du mich hier noch unbedingt?“
„Die Gräfin, nicht wahr?“ Smirnow sah ihm ins Gesicht. „Bin froh, dass ich das nicht tun muss. Ich glaube aber, du solltest es ihr besser persönlich sagen, meinst du nicht auch? Geh‘ lieber rüber zu ihr ins Hotel.“
Der Sheriff nickte nur ein paarmal nachdenklich, während er die Lippen zusammenpresste. Er sollte Mrs. Freyman ins Gesicht sagen, dass ihr Sohn tot sei?
„Ich glaube nicht, dass ich es kann, Igor. Ich kann es nicht. Nur einen Tag nach der Hochzeit eine solche Nachricht überbringen? Mensch Igor, ich kann das einfach nicht. Ich ruf sie lieber an.“
„Dann mach nur zu Greg, hier kannst du mir ohnehin nicht mehr helfen. Du weiß ja, wo das Telefon steht.“
Der Sheriff hatte nun die bittere Pflicht, Johns Mutter und ihren beiden Töchtern im nahegelegenen Grand Hotel die Nachricht über den Tod ihres Sohnes zu überbringen.
Vergessen war in diesem Moment völlig, was zwischen ihm und Mrs. Freyman, der Gräfin, vor schon längerer Zeit in New York vorgefallen war.
Einer fremden Person den Tod eines Angehörigen von Angesicht zu Angesicht nahezubringen, das hatte er in New York oft genug gemacht. Das gehörte schließlich zu seinen Aufgaben. Es war jedes Mal unangenehm genug.
Aber die jetzige Situation, sein vertrauliches Verhältnis zu den Hinterbliebenen, machte es ihm völlig unmöglich.
Er suchte nach möglichen Formulierungen, um Mrs. Freyman die schreckliche Nachricht so schonend wie nur möglich beizubringen. Noch hatte er die Hoffnung, sie sei gerade nicht erreichbar. Dann wäre ihr die schlimme Neuigkeit vielleicht schon vor seinem nächsten Kontakt mit ihr bereits durch jemand anderen übermittelt worden.
Beklommen wählte er die Nummer der Vermittlung.
Seine Hoffnung auf ihre Abwesenheit erstarb in dem Moment, als nach einer kurzen Pause sich die Gräfin gut gelaunt aus ihrem Zimmer meldete.
Sie war erfreut über seinen Anruf - aber auch leicht verwundert über dieses ungewohnt frühe Telefonat.
Was mochte es so Wichtiges geben, dass Gregory sich um diese Uhrzeit schon bei ihr meldet?
„Guten Morgen, Gräfin, ich möchte – äh, nein - ich muss Sie darüber in Kenntnis setzen…“
Aus dem gedrückten Tonfall Gregorys und seiner förmlichen, fast gestelzten Ausdrucksweise hörte sie eines sofort heraus: Gregory Delano hatte ihr mit diesem so frühen Anruf alles andere als eine gute Nachricht zu bestellen.
Wie schrecklich aber die Unglücksbotschaft tatsächlich war, konnte sie sich nicht vorstellen.
Erst nachdem der Sheriff ihr mit stockender Stimme eröffnet hatte, was vorgefallen war, schien sie langsam zu begreifen. Im so knapp wie möglich gehaltenen Bericht des Sheriffs waren immerhin die grausamen Details über den Tod ihres Sohnes ausgelassen.
Nach einer kurzen Pause, in der sie wohl erst lernen musste, das Gehörte in seiner ganzen Tragweite zu erfassen, stammelte sie zuerst nur: „Grischa, sag mir bitte, dass das alles nicht wahr ist…“.
Sie verwendete den nur von ihr benutzten Kosenamen, als könne sie ihn dadurch eher dazu bewegen, das eben Gesagte wieder zurückzunehmen.
Gleichzeitig spürte sie jedoch, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllen werde. Es war einfach viel zu unwahrscheinlich, als dass Gregory sich ihr gegenüber mit solchen Aussagen eine Posse erlauben würde.
Der Sheriff war heilfroh, als er nach dem ersten Ausbruch ihres unsäglichen Schmerzes - und ein paar tröstenden Worten seinerseits - das Gespräch auf formalere Angelegenheiten bringen konnte.
Zum Beispiel auf die Zusicherung, für sie und ihre Töchter mit Anhang sofort Zimmer auf ‚Three Oaks‘ herrichten zu lassen und den Umzug der Familie vom Hotel in Johns Haus zu organisieren, da sie nun ja doch noch länger bleiben wollten. Oder sich auch sonst weiter um alle jetzt nötigen Maßnahmen zu kümmern.
Natürlich auch mit dem festen Versprechen, das er sich auch schon selber gegeben hatte, nämlich Johns Mörder gnadenlos zu verfolgen, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Und zwar umgehend, ohne Verzug, und ohne auch nur die geringste Zeit zu verlieren.
Noch bevor die Gräfin mit Anhang auf ‚Three Oaks‘ angekommen war, ließ der Sheriff sich selber wieder zum Ort des Geschehens hinausfahren.
Auch um seinen eigenen Wagen abzuholen, aber vor allem, um den Tatort noch einmal genauestens unter die Lupe zu nehmen. Noch bevor er diesen aus Rücksicht auf Johns Mutter und seine Schwestern in einen Zustand bringen ließ, der nichts mehr - oder so wenig wie möglich - von dem tragischen Vorgang in der Nacht zuvor preisgab.
Zwei seiner Beamten halfen ihm eifrig bei der Suche nach vielleicht aufschlussreichen Hinweisen.
Er selber forschte zuerst nach möglichen Fußspuren, untersuchte eingehend die Stelle unter dem Balkon des Schlafzimmers. Da es schon eine Weile her war, seit der letzte Regen niedergegangen war, fanden sich keine brauchbaren Abdrücke im trockenen Erdreich. Die Konturen einiger Fußabdrücke, offenbar allesamt schon älteren Datums, waren bereits bis zur Unkenntlichkeit zerbröselt.
Auf dem Rasen waren keinerlei frisch eingedrückten Gräser zu erkennen, die einen Schluss auf ein kürzlich erfolgtes Begehen zugelassen hätten. An dem Wilden Wein, der sich mit seinen kaum noch sichtbaren winzigen Knospen bis zum Geländer hinaufrankte, war kein einziger abgerissener oder verletzter Ast zu sehen.
Akribisch suchte der Sheriff im Haus nach halbwegs frischen Blutspuren, die der Mörder bei seiner Flucht doch irgendwo hinterlassen haben musste. Zu seinem Leidwesen waren nirgends welche zu finden.
Es gab mehr Rätsel als Hinweise.
Delano befragte ausführlich die beiden Stallburschen, noch eindringlicher Paco und seine Frau, die ja diese unheilvolle Nacht im Haus gewesen waren.
Er verbrachte Stunden mit seinen Nachforschungen.
So lange, bis die Familie ankam und er der Gräfin jetzt von Angesicht zu Angesicht sein erkennbar aufrichtiges Mitgefühl beteuerte. Stumm, mit steinerner Miene, als Ausdruck seiner eigenen Betroffenheit, schüttelte er Mary-Ann und Rose die Hand. Nicht die Spur eines Gedankens an diesem so fürchterlichen Tag an die fröhliche Ausgelassenheit und Frivolität auf früheren gemeinsamen Festen.
Der Tod ist ein echter Spielverderber.
Den von ihm unbehelligt gebliebenen in seinem aktuellen Wirkungskreis ist die Lust an einer Partie gründlich vergangen - mindestens vorübergehend; dem Betroffenen selbst fehlt die Möglichkeit der Teilnahme daran – für immer.
Der Abschied von der Familie Freyman erfolgte, wie auch anders, in tief bedrückter Stimmung. Der Sheriff versicherte der Familie noch einmal, sich weiterhin um sie und die nötigen Formalitäten zu kümmern. Die gegenseitigen Umarmungen waren heute intensiver und dauerten etwas länger als sonst üblich.
Gedankenverloren fuhr Gregory Delano bald darauf wieder zurück in die Stadt, wo er als erstes in das Haus des Arztes zurückkehrte. An dessen Eingangstür hing seit dem Morgen ein großer Zettel mit der Mitteilung, dass am heutigen Tage keine Sprechstunden stattfänden.
Drinnen lag immer noch Sandra Freyman. Jetzt in einem Bett direkt neben dem Behandlungszimmer.
Dr. Smirnows Befürchtungen hatten sich zum Glück nicht bestätigt. Sie lebte noch.
Sie war jetzt auch ansprechbar.
Es ging ihr nicht besonders gut, entsprechend der Verletzungen, die sie sich zugezogen hatte. Aber sie sagte dem Sheriff, sie wolle ihm auf alle seine Fragen antworten, so lange sie dazu imstande sei.
Eine geschlagene Stunde dauerte die Vernehmung.
Wer alles am betreffenden Tag auf dem Gestüt war; mit wem John die letzten Tage Kontakt gehabt hatte; ob er irgendwelche Andeutungen gemacht habe, die ihr unerklärlich waren; ob sie wüsste, dass er Feinde habe…
Vor allem wollte Delano wissen, an welche Vorgänge dieser tragischen letzten Stunden sie sich erinnern könne.
„Sandra, versuche dich an möglichst alles zu erinnern. Jede Einzelheit, auch die, die du selber vielleicht für unwichtig erachtest; sie könnte trotzdem wichtig sein. Und wenn es zu viel für dich wird, sag es mir bitte. Ich will dich in deinem Zustand nicht unnötig quälen.“
Geduldig beantwortete sie seine Fragen, in dem Umfang, in dem sie sich daran zu erinnern glaubte.
Es war nicht viel, was sie noch wusste.
Ihren Angaben zufolge musste der Täter sie auf irgendeine Weise narkotisiert haben, da sie vom Mord an John gar nichts mitbekommen hatte.
„Greg, ich weiß einfach nicht, was gestern Nacht geschehen ist. Erst dachte ich, der Täter hätte mich vor der Tat bewusstlos geschlagen. Dr. Smirnow aber sagt, ich habe nicht die Spur einer Verletzung am Kopf. Und, kein Wunder, ich spüre auch keinerlei Schmerz, außer an Arm und Bein.
Er kennt aber genug Mittelchen, wie er sagte, die durch Einatmen sehr schnell eine tiefe Ohnmacht herbeiführen können. Auch solche Präparate, die völlig geruchsfrei sind.“
Die Vernehmung, eigentlich war es nicht mehr als eine Unterredung unter guten Bekannten, half dem Sheriff keinen Schritt weiter. Auch nicht einen kleinen.
Er verabschiedete sich von der Frau, die er so lange und so gerne als seine eigene Frau gesehen hätte. Eigentlich schon vom ersten Moment an in seinem Leben, als er sie aus dem Zug steigen sah. Er versicherte auch ihr, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Mord an ihrem Mann so bald wie möglich aufzuklären.
„Sandra, ich finde Johns Mörder. Ich verspreche es dir.“
Am nächsten Tag suchte Delano nach und nach Johns härteste Konkurrenten auf. Verlangte nach Auskunft über ihr Verhältnis zu Mr. Freyman und erkundigte sich wie ganz nebenbei nach ihren Alibis für den Mordzeitpunkt, falls sie welche hätten.
Die Vernommenen waren alles andere als erfreut, sich im Kreis der Verdächtigen wiederzufinden.
‚Alles reine Routinefragen‘, versicherte er daher den Herren beflissen und beruhigte sie darüber hinaus mit den Worten: ‚Das ist selbstverständlich keine Vernehmung. Ich sammle lediglich Informationen. Ich muss für einen vollständigen Bericht einfach nur jeden Einzelnen von Ihnen auf meiner Liste abhaken können‘.
Von besonderem Interesse für den Sheriff waren auch Beobachtungen über ungewöhnliche Vorgänge, welche die Befragten in letzter Zeit, vor allem aber die letzten Tage, gemacht haben könnten.
Von den Züchtern konnte er die Adressen von den drei Buchmachern erfahren, die damals aufgrund von Johns gezielten Einsätzen Bankrott gegangen waren. Er überprüfte selber das Alibi des einen, der ortsansässig war. Das der anderen beiden ließ er von den für sie zuständigen Dienststellen an deren Wohnort abklären.
Keiner von den Dreien kam in Frage.
Der im Ort lebende befand sich seit drei Wochen in Ascot, wo er auf Einladung seines Freundes aus England neue Zuchtmethoden studierte. Er wollte erst in zwei Wochen wieder aus Europa zurückkehren.
Der andere war zur entsprechenden Zeit in einer Geschäftsbesprechung in Seattle, was die örtlichen Behörden sowohl durch seinen Geschäftspartner als auch durch die Angestellten des von ihm gebuchten Hotels bestätigen ließen.
Der Dritte hatte das überzeugendste Alibi. Es war noch mehr als wasserdicht: er saß bereits seit über einem Jahr wegen wiederholter Manipulation der Ergebnisse von Pferderennen im Gefängnis von Tucson, Arizona.
Am dritten Tag nach dem abscheulichen Mord an John Freyman kam Gregory Delano erst nach dem Mittagessen in sein Büro. Er schloss die Tür hinter sich, bereitete sich eine große Kanne starken Kaffee zu und stellte sie zusammen mit einer Tasse auf das Beistelltischchen neben seinem Stuhl. Dann ließ er sich in den bequemen Sessel mit dem etwas abgeschabten Büffelleder fallen und streckte die Beine auf dem Schreibtisch aus.
Er ließ die letzten Tage Revue passieren, sortierte die Aussagen, die gemacht wurden, zog dies in Erwähnung und das; wägte eines ab und ein anderes, spann sich ein Netz aus Gedanken, in dem der Mörder sich verfangen sollte.
Er zählte eins und eins zusammen. Um das so offenbar eindeutige Ergebnis gleich wieder auseinanderzunehmen. Immer wieder setzte er die Puzzleteile der Antworten, die er erhalten hatte, anders zusammen.
Mal schien schon alles stimmig zu sein, dann entdeckte er in seiner Gedankenkette enttäuscht einen Widerspruch.
Also alles wieder ganz von vorne.
Stunden saß er so.
Als sein Magen so drängend knurrte, dass ihm zwischendurch immer wieder die Vorstellung von deftigen Braten und schmackhaft gesottenem Gemüse in die Gedanken einfloss, ging er in den Saloon neben der Station hinüber und ließ sich dort schnell ein paar Spiegeleier und Speck in der Pfanne braten.
Ablenkung konnte er jetzt nicht gebrauchen.
Elisa, die Bedienung, wunderte sich, dass der Sheriff heute so kurz angebunden war. Sie kannte ihn etwas umgänglicher, immer auch zu einem Scherz aufgelegt. Heute schaute er nur mürrisch vor sich hin und beachtete sie kaum.
Sie ahnte schließlich nicht, dass der gedankenverlorene Sheriff gerade in einer ganz anderen Welt lebte, die er sich selber im Kopf zusammengebastelt hatte, und in der er verzweifelt nach einem kaltblütigen Mörder suchte.
Hastig schlang Gregory Delano das Mahl hinunter.
Er glaubte fest, dass er der Lösung nahe war. Es gab wiederum noch einige Details, von denen er noch nicht genau wusste, ob und wie sie zusammenpassten.
Nachdem er sich wegen seines trocken gewordenen Mundes noch ein Glas Root Beer gegönnt hatte, ging er zurück ins Büro und nahm exakt die gleiche Stellung ein, die er vor dem Gang in die Kneipe innegehabt hatte.
Vor seinen Augen lief nun immer wieder ab, was sich im Landhaus John Freymans abgespielt haben könnte.
Noch hatte der erdachte Ablauf immer wieder verschiedene Fassungen, wenngleich jetzt schon um ein paar weniger.
Wieder vergingen die Stunden.
Warren Harms stand mit seinem Zuchtbetrieb kurz vor dem Zusammenbruch. Munkelte man. Genau wusste das aber keiner, man redete nur darüber.
Harms betrieb zusammen mit seinem Bruder auch eine Pferdemetzgerei, was übrigens bei seinen Kunden nicht so besonders gut ankam. War jetzt auch nicht wichtig, bedeutsam war nur, dass dort ebenfalls große Messer im Gebrauch waren. Die gleichen, oder sehr ähnliche, wie jenes, das auch in der Mordnacht benutzt wurde.
Seine Geschäfte dürften jetzt zweifellos wieder besser laufen, weil das Charisma und die Reputation Johns nicht mehr den ausschlaggebenden Einfluss auf zukünftigen Auktionen ausüben konnte, so wie das vor Johns Tod häufig der Fall gewesen war. Gerade in letzter Zeit hatte Harms gegen ihn sehr oft den kürzeren gezogen.
Harms ist bestens befreundet mit den Hendersons; schon Harmsens Vater hatte in Hendersonville gelebt. Ein Vorgehen gegen ihn wäre nicht einfach. Die Honoratioren der Stadt würden sich gegen ihn wenden.
Gegen ihn, den Sheriff, gegen den Mann aus dem Osten, der zwar sehr geachtet war, aber eben hier nur zugezogen.
Wenn es aber doch so war, wie Paco es gesagt hatte? Konnte man dem überhaupt glauben? Immerhin gefährdete er mit seiner delikaten Aussage seine Arbeitsstelle.
Der Sheriff starrte an die Decke des Büros.
Eine wichtige Tatsache ging ihm nicht aus dem Kopf. Er glich jedes Für und Wider zum wiederholten Male ab. Und noch einmal, und noch einmal.
Endlich nahm Gregory Delano die Füße vom Tisch, beugte sich etwas vor, setzte den Ellbogen der linken Hand auf die Tischplatte auf und stütze sein Kinn in die halb geöffnete Hand. Mit dem Daumen rieb er die Stoppeln an seinem Unterkiefer. Sein Blick wanderte langsam zum Fenster.
Er wusste jetzt, wie es war - und wer es war.
Er war sich jedenfalls ganz sicher.
Jetzt passte alles zusammen. Die vielen einzelnen Teile ergaben jetzt ein perfektes Bild. Kein schönes Bild, ganz im Gegenteil, ein schauriges. Aber anders, wie es sich darauf darstellte, konnte es gar nicht gewesen sein. Für ihn war die Sachlage jetzt völlig klar.
Er war alles andere als glücklich über seine Erkenntnis.
„Ja, so und nicht anders war es“, sagte er halblaut vor sich hin und schüttelte dann den Kopf.
„Wer hätte gedacht, dass dieser Mensch zu so etwas überhaupt fähig ist.“
Er ballte die rechte Hand zur Faust, sein Gemurmel wurde zu einem hinausgepressten Ehrenwort: „John, ich werde dir Genugtuung verschaffen.“
Gegen vier Uhr morgens, als die Morgendämmerung den heraufziehenden Tag ankündigte, da erlosch das Licht, das aus dem Büro des Sheriffs nach außen gedrungen war.
Als letztes in der Stadt.
Außer dem Tathergang, den er bald mit stichhaltigen Indizien dem Gericht zur Beurteilung vorzulegen gedachte, war dem Sheriff noch etwas anderes klar geworden:
Der nächste Tag würde einer der unangenehmsten in seinem ganzen Leben werden.