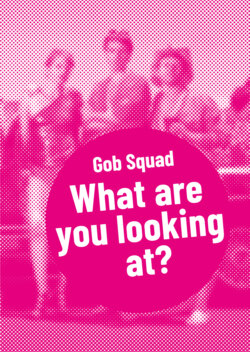Читать книгу Gob Squad – What are you looking at? - Gob Squad - Страница 14
Оглавление»WIR SIND ALLE GLEICHZEITIG SUBJEKT UND OBJEKT UNSERER KUNST«
Schon in den ersten professionellen Arbeiten zeigte sich eine für Gob Squad typische Herangehensweise, die das Alltägliche und das Besondere in unnachahmlicher Weise verknüpft. Die eigene Alltagserfahrung ins Zentrum zu rücken und durch poetische Überschreibungen zu thematisieren und zu verfremden, wurde seitdem kennzeichnend für ihre Arbeiten.
Eine der ersten gemeinsamen Performances hieß House. Die ortsspezifische Aufführung in einem Wohnhaus wurde erstmals 1994 bei der Expo in Nottingham gezeigt und im gleichen Jahr beim Diskurs-Festival in Gießen. Das Publikum bewegte sich von Raum zu Raum. Alltägliche Vorgänge, kombiniert mit außergewöhnlichen Aktionen in bizarren Szenerien, wirkten plötzlich befremdlich und ließen die vermeintliche Normalität in einem anderen Licht erscheinen.
Oder Work, präsentiert 1995 beim NOW Festival in Nottingham, das während der üblichen Arbeitszeiten in einem Büro im Rahmen einer 40-Stunden-Woche stattfand. Einige Gruppenmitglieder waren damals schon mit dem Studium fertig und zunächst arbeitslos gemeldet. Der Traumjob, früher Ballerina oder Astronaut, heute Künstler*in, war das etwa nur eine Illusion?
Nottingham, 1995
Kassel, 1997
Und so wurden auf der Suche nach einer eigenen kollektiven Arbeitsform die gesellschaftlichen Klischees vom Arbeitsleben mit den eigenen Realitäten und Erwartungen abgeglichen.
»Das, was ich lebe, ist das Einzige, worüber ich sprechen kann«, so Johanna Freiburg über das radikal subjektive Credo der künstlerischen Arbeit. Schon in der Aufzählung einiger Projekttitel wird dieser Leitgedanke deutlich: Close Enough To Kiss (1997), Say It Like You Mean It – The Making Of A Memory (2000), Where Do You Want To Go To Die? (2000) oder Room Service (Help Me Make It Through The Night) (2003). Dabei geht es nicht um Selbstdarstellung oder eine Behauptung von Authentizität, sondern vor allem um Kommunikation und die Suche nach anderen Formen des Zusammenseins. »Selbst wenn jede Arbeit ihren Beginn in unseren eigenen Leben findet, geht es dabei nie um mich und nur um mich oder andere einzelne Individuen«, sagt Johanna Freiburg. »Es geht immer um eine Gruppe von Menschen und ihre Beziehungen zueinander.«
»GOB SQUAD – EIN ZWITTERWESEN AUS SIEBEN KONTROLLFREAKS, EINE BORG, EINE PATCHWORKFAMILIE, EINE SOZIALE UTOPIE«
Die eigene kollektive Arbeitspraxis auszubauen und gegen all die Widerstände zu behaupten, die ein neoliberaler gesellschaftlicher Rahmen mit sich bringt, war für Gob Squad von Anfang an Programm. »Von Zeit zu Zeit produzieren wir Performances, aber immer produzieren wir Gob Squad. Gob Squad ist das permanente Projekt«, betont Sarah Thom.
Die kollektive Herangehensweise führte anfangs in der öffentlichen Wahrnehmung mitunter zu Missverständnissen. War es doch in den 1990er Jahren wenig verbreitet, zumindest in der deutschen Theaterszene, das klassische Muster zwischen Autor*in, Regisseur*in und Schauspieler*innen einfach aufzubrechen und zu unterlaufen.
So wurde einer der ersten internationalen Erfolge der Gruppe, 15 Minutes to Comply (1997) bei der documenta X in Kassel, in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Stefan Pucher, zunächst dem einzig lesbaren Beteiligten, nämlich dem Regisseur, zugeordnet.
Dies war befremdlich, insbesondere für die englischen Gruppenmitglieder, denen die Mechanismen des deutschen Stadttheaters bis dahin so gut wie unbekannt waren. Theater als hierarchische Unternehmung, das war einfach viel zu weit weg von der eigenen Praxis.
Letztlich bedeutete dieses Missverständnis für Gob Squad nur eine Bestätigung dafür, den eigenen Arbeitszusammenhang weiter zu vertiefen. Dazu gehört es auch, die Verantwortung jedes/jeder Einzelnen für ein gemeinsames Ganzes als unverzichtbaren Teil des Konzepts zu verstehen. Das Konstrukt, dass jeder ersetzbar sein kann, bestimmt die Praxis. Die Ideen und Konzepte sind nicht einer Person, einem Genie, zuzuordnen – wie das nach wie vor gern gedacht wird – nein, Gob Squad stellen sich bewusst gegen Einzelpositionen und favorisieren die kollektive Autorschaft der Gruppe. Bastian Trost beschreibt diesen Prozess so: »Meistens entwickeln und proben wir mit bis zu zehn Leuten, die Vorstellung spielen allerdings nur vier oder fünf. Die wiederum wechseln in der Besetzung. Nie spielt eine oder einer die Rolle einzig und allein. Das verhilft uns zu einmaligen Konstellationen, auf die die Zuschauer*innen nur an diesem einen Abend treffen. Das ist die Kraft, die wir haben wollen, auch im Vergleich zu anderen Medien. Performance hat, gerade wenn man vom Theater kommt, die größere Kraft des Augenblicks.«
Podewil, Berlin, 1997