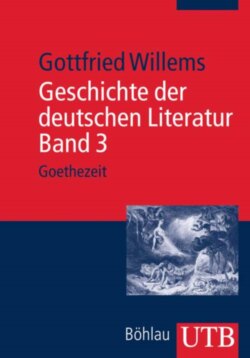Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 3 - Gottfried Willems - Страница 11
2.3 Geschichtlich-gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen der literarischen Entwicklung
ОглавлениеDas „Ancien régime“
Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts herrschen in Deutschland noch immer jene Verhältnisse, die man in Frankreich, von der Französischen Revolution aus zurückblickend, das „Ancien régime“ genannt hat.17 Die Gesellschaft ist nach wie vor eine Ständegesellschaft, eine hierarchisch gegliederte, in Form einer Ständepyramide aufgebaute Gesellschaft. In ihr sind keineswegs alle Menschen vor dem Gesetz gleich; vielmehr sind die verschiedenen Stände – Fürsten, hoher und niederer Adel, hohe und niedere Geistlichkeit, Bürger, Handwerker, Bauern – mit je anderen „Privilegien“ ausgestattet, denen gemäß ihnen ein rechtlich abgestufter Anteil am politischen und gesellschaftlichen
[<< 33]
Leben zukommt. Die führende Rolle hat nach wie vor der Adel inne, auch wenn das Bürgertum als wichtigster Träger und Nutznießer der Modernisierung immer energischer nach vorne drängt. Die politische Macht liegt in der Hand monarchisch regierender Fürsten, konzentriert sich an ihren Höfen; sie unterliegt im allgemeinen keiner Kontrolle, etwa einer Kontrolle durch Parlamente, allenfalls der durch eine Ständeversammlung, die „Landstände“. Denn es gibt noch keine allgemeinen, freien und gleichen Wahlen wie heute; die Monarchen herrschen weithin uneingeschränkt, „absolut“. Deshalb spricht man hier auch von „Absolutismus“.
Die Literatur zwischen Fürstenhof und Buchmarkt
Die Fürstenhöfe sind nach wie vor die wichtigsten Förderer von Kunst und Literatur, wenn sich inzwischen auch ein Kunst-, Buch- und Zeitschriftenmarkt herangebildet hat, der den Künstlern und Literaten eine Alternative zum Leben bei Hofe oder in einer anderen Institution der Ständegesellschaft eröffnet.18 Aber von diesem Markt können die meisten von ihnen noch nicht leben. Selbst Goethe, der im Lauf seines Lebens mit seinen Büchern schon viel Geld verdient hat, geht deshalb 1775 an den Weimarer Hof und bleibt ihm sein Leben lang als fürstlicher Rat und Minister verbunden. Das Amt bei Hofe sichert ihm die Existenz, und außerdem kann er von ihm aus manches für „Kunst und Wissenschaft“ tun, nicht nur für die eigene, auch für die anderer Autoren. Kunst und Literatur sind hier also noch nicht autark; sie sind noch von Institutionen wie den Fürstenhöfen abhängig.
Doch diese Verhältnisse beginnen sich gerade in der Zeit um 1800 zu ändern. Wenn sich Goethe und Schiller noch immer einem Fürstenhof wie dem Weimarer „Musenhof“ zuordnen lassen, so kann man sich Autoren wie Jean Paul und Kleist hier kaum mehr vorstellen. Wohl hat auch ein Romantiker wie Friedrich Schlegel zunächst noch eine derartige Anbindung gesucht und sich bald in Weimar, bald bei Napoleon und bald bei dessen wichtigstem Gegner, dem Wiener Hof, um eine Anstellung bemüht – ein Zeichen der vielberufenen
[<< 34]
ideologischen Flexibilität des modernen Intellektuellen. Und selbst einen Hölderlin hat man eine zeitlang noch als Bibliothekar an dem kleinen Fürstenhof zu Homburg untergebracht.
Doch schon eine Generation später beherrschen Männer wie Heine die Szene, Autoren, die man sich eben durchaus nicht mehr an einem Hof vorstellen kann. Freilich, selbst Heine hat sich zeitweilig mit dem Gedanken getragen, bei Hofe zu reüssieren, und sich in München bei dem bayrischen König Ludwig I. um ein Amt beworben. Sein Versuch blieb aber ohne Erfolg, und man darf wohl davon ausgehen, daß er selbst dann zu einem Fehlschlag geworden wäre, wenn er gelungen wäre. Die Generation Heines, die Generation der „Jungdeutschen“ ist die erste Generation von Autoren, die sich bewußt und konsequent von den Fürstenhöfen löst. Sie braucht die Distanz zum Hof für ihre Arbeit und sucht ihr Auskommen eher im Journalismus, bei einer mehr oder weniger kritischen Presse; sie setzt mithin statt auf den Fürstenhof auf den Buch- und Zeitschriftenmarkt. Freilich finden sich selbst in dieser Generation noch Gegenbeispiele, doch wird deren Weg zum Hof nun zum öffentlichen Ärgernis und von den anderen Literaten als Verrat angeprangert. Die entscheidenden Schritte hin zur institutionellen Autonomie der Kunst sind getan.
Das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“
Das politische Leben bewegt sich in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts noch immer in den Bahnen, die ihm durch die Verfassung des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“ vorgezeichnet sind. An der Spitze des Reichs steht der Kaiser in Wien, ein Österreicher aus der Dynastie der Habsburger. Er ist das Oberhaupt eines komplexen Gebildes, das sich aus zahllosen größeren und kleineren Fürstenstaaten wie dem Staat des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach zusammensetzt. Insgesamt umfaßt das Reich an die 300 Fürstentümer und souveräne Herrschaften; diese suchen sich politisch in einem Spannungsfeld zu verorten, das durch den Kaiser zu Wien, den König von Preußen, den einflußreichsten deutschen Fürsten neben dem Kaiser, und den König von Frankreich bezeichnet wird, dem mächtigsten Nachbarn des Deutschen Reichs, einem aufdringlich interessierten Nachbarn.
Aufgeklärter Absolutismus
Viele dieser deutschen Fürsten verfolgen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine aufgeklärte Reformpolitik, suchen sich mit mancherlei Reformen zu Herren jener Modernisierungsdynamik zu
[<< 35]
machen, die von der Aufklärung ausgeht. Das gilt wie für die Höfe Friedrichs II. (1712–1786) in Berlin und Josephs II. (1741–1790) in Wien, so auch für den „Musenhof“ zu Weimar, und es gilt für ihn in besonderem Maße. Der junge Herzog Carl August (1757–1828) war von einem führenden Kopf der deutschen Aufklärung, von Christoph Martin Wieland (1733–1813), erzogen und mit aufklärerischen Ideen vollgestopft worden, so daß er bei Antritt seiner Regierung 1775 nichts Eiligeres zu tun hatte, als Goethe und Herder, die Exponenten der allerneuesten Entwicklungen im Reich der „Kunst und Wissenschaft“, nach Weimar zu ziehen, um mit ihrer Hilfe eine moderne Politik zu gestalten. Das hatte übrigens zur Folge, daß der alte Adel in gewissem Maße durch Leute bürgerlicher Abkunft wie Goethe aus dem Zentrum der Macht verdrängt wurde, was in Weimar wie anderswo immer wieder böses Blut gab – der im 18. Jahrhundert allgegenwärtige Konflikt zwischen „noblesse d’épée“ und „noblesse de robe“, zwischen erblichem Blut- oder Schwertadel und neuem Amtsadel. Aber die Fäden laufen letztlich auch hier in der Hand des Fürsten, des „Souveräns“ zusammen; auch ein aufgeklärter Absolutismus ist noch immer ein Absolutismus.19
Französische Revolution
Eben gegen solche Verhältnisse sind die Männer der Französischen Revolution 20 seit 1788/89 angetreten, um dem Prinzip der „Volkssouveränität“ Geltung zu verschaffen. Nicht der Fürst, sondern das Volk sollte nun als Souverän fungieren; alle Macht sollte vom Volke ausgehen. Dieser Grundsatz sollte mit Hilfe von Verfassungen durchgesetzt werden, die die Macht an Wahlämter knüpften; sie sollte sich in Volkswahlen legitimieren müssen. Damit zog die Französische Revolution auf ihre Weise die Konsequenzen aus dem Denken der Aufklärung und den Erfordernissen der Modernisierung, aus dem aufklärerischen Prinzip der Emanzipation von der Autorität der Tradition, wie er aller Modernisierung zugrunde liegt, und dem aufklärerischen
[<< 36]
Gedanken der allgemeinen Menschennatur, der natürlichen Gleichheit aller Menschen.
„Terreur“ und Revolutionskriege
Mit solchen Neuerungen verwickelte sich der Französische Staat – vor allem nachdem er sich 1792/93 seines Königs Ludwigs XVI. entledigt und in eine Republik verwandelt hatte – in Konflikte mit den alten Monarchien um Frankreich herum. Hinzu kam, daß die revolutionären Kräfte mehr und mehr aus dem Ruder liefen und bürgerkriegsähnliche Zustände heraufführten, die schließlich in die „Terreur“, das Schreckensregime der Jakobiner einmündeten, mit Massenhinrichtungen in Paris und in der französischen Provinz. Die alten Mächte schlossen sich in Koalitionen gegen Frankreich zusammen, um die Revolution einzudämmen, wo nicht vollends aus der Welt zu schaffen. So wurden die Jahre von 1792 bis 1815 zu einer Zeit immer wieder neu aufflammender Kriege, mit einer Militärmaschinerie, wie sie die Menschheit bis dahin noch nicht gesehen hatte. Denn auch das Militär hat sich damals modernisiert. So wurde nun durch einen Revolutionär namens Barras in Frankreich die allgemeine Wehrpflicht eingeführt; deshalb geht man noch heute „zum Barras“, wenn man Soldat wird. Riesige Heere zogen kreuz und quer durch Europa, von Holland bis Italien und von Spanien bis Rußland, und das hieß naturgemäß zunächst einmal: sie zogen kreuz und quer durch Deutschland.
Das erste große Treffen in diesen Kriegen war die Schlacht bei Valmy (1792), in der sich das revolutionäre Frankreich ein erstes Mal gegen die Koalition der alten Mächte behaupten konnte. Goethe hat diese Schlacht aus nächster Nähe miterlebt; sein Herzog Carl August, der im Nebenamt auch ein preußischer General war, hatte ihn auf den Feldzug mitgeschleppt. Goethe will dabei den Anbruch eines neuen Zeitalters gespürt haben, wie wir aus einer seiner autobiographischen Schriften, der „Campagne in Frankreich“ (1822) wissen, einer ausführlichen Schilderung jener ersten kriegerischen Verwicklung der Revolutionszeit.
Deutsche Jakobiner
Nichts hat seinerzeit die Gemüter so sehr beschäftigt wie die Französische Revolution.21 Das gilt natürlich auch für die Schriftsteller, und
[<< 37]
es gilt ausnahmslos für einen jeden von ihnen. Über der permanenten Auseinandersetzung mit den Vorgängen in Frankreich vollzieht sich – vereinfacht gesprochen – eine Spaltung des intellektuellen Deutschland in drei Parteien. Eine erste Gruppe umfaßt alle die, die von Verfechtern der Aufklärung zu Anhängern der Revolution werden und die deutschen Verhältnisse nach dem französischen Vorbild umgestalten wollen, die deutschen Jakobiner.22 Jakobiner nannte man zunächst die Mitglieder eines bestimmten politischen Clubs im revolutionären Paris, einer Art politischer Partei, zu der sich die Radikalen unter den Revolutionären zusammenschlossen; ihr Wortführer war der berühmt-berüchtigte Maximilien de Robespierre (1758–1794). Später bedachte man auch alle anderen Anhänger einer radikalen Revolution mit dem Namen „Jakobiner“.
Politische Romantik
Seht euch das revolutionäre Frankreich nur genau an!, hält eine zweite Gruppe von Intellektuellen dagegen; da kann man studieren, was bei all der Aufklärerei letztlich herauskommt, wohin es führt, wenn man wie die Aufklärer mit der Autorität der Tradition bricht, altehrwürdige Institutionen, Dogmen und Normen verwirft, sogar die Religion und die Kirche in Frage stellt und nur noch auf die Natur und das Naturrecht setzt – das Ergebnis sind Chaos, Terror und Krieg. Deshalb weg mit der Aufklärung, zurück zu den alten Ordnungsstrukturen, zu Monarchie, Adelsherrschaft, Ständegesellschaft, Religion und Kirche! Dieses Denken entfaltet sich vor allem im Raum der Romantik, genauer: im Raum einer politisierten Romantik, also noch nicht so sehr in der Jenaer Frühromantik, erst in der Hoch- und Spätromantik, soweit sie über poetische Konzepte hinaus zu politischer Programmatik übergeht.23 Die romantische Verherrlichung des Mittelalters, der mittelalterlichen Frömmigkeit und der alten Ritterherrlichkeit ist mithin keineswegs eine Ausgeburt allein des poetischen Sinnes; sie hat einen politischen Unterton, den man nicht überhören darf.
Das antirevolutionäre und gegenaufklärerische Denken dieser zweiten Gruppe von Intellektuellen geht bald schon eine eigentümliche Verbindung mit dem neuen Nationalismus ein, der doch eigentlich zum
[<< 38]
ideologischen Repertoire der Jakobiner gehört. Es entsteht die Vorstellung, das Gedankengut der Aufklärung sei den Deutschen eigentlich immer wesensfremd geblieben, die deutsche Aufklärung sei im Grunde das Ergebnis einer Überfremdung der deutschen Verhältnisse durch den französischen Geist gewesen – und so viel ist daran immerhin richtig, daß die Impulse der Aufklärung, nachdem sie zunächst vor allem von England und Schottland ausgegangen waren, zuletzt mehr aus Frankreich nach Deutschland gelangt waren. Die Aufklärung, so heißt es nun, sei das Werk einer oberflächlichen Vernünftelei gewesen, eines oberflächlichen Rationalismus, der den Deutschen nie wirklich etwas hätte bedeuten können, denn der Deutsche sei seinem Wesen nach auf Tiefe hin angelegt, er neige zu metaphysischem und religiösem Tiefsinn; der Deutsche sei nicht aufgeklärt, sondern tiefsinnig. Hier der deutsche Tiefsinn – da der oberflächliche Rationalismus, die „instrumentelle Vernunft“ des aufgeklärten Frankreich.
Aufklärung „trotz alledem“
Zwischen diesen beiden Gruppen, den radikalen Anhängern und den radikalen Gegnern von Aufklärung und Revolution, hält sich eine dritte Gruppe, für die Aufklärung und Französische Revolution keineswegs ein- und dasselbe sind, auch wenn sich die Revolutionäre natürlich immerzu auf die Aufklärung berufen haben, insbesondere auf den großen Aufklärer Rousseau. Hier bekennt man sich zu einer Aufklärung „trotz alledem“, will man an den Prinzipien der Aufklärung auch und gerade angesichts dessen festhalten, was während der Revolution an Schrecklichem geschehen ist.
Zu dieser Gruppe gehören die meisten der namhaften deutschen Autoren, allen voran die Weimarer Größen: Wieland, Goethe, Herder, Schiller. Sie wollen in der Französischen Revolution nicht so sehr die logische Folge und Vollendung der Aufklärung sehen denn vielmehr einen überstürzten Versuch zur Umsetzung ihrer Ziele, einen Versuch, der wegen der Ungeduld und Radikalität der Revolutionäre drauf und dran sei, alles zu verderben, was die Aufklärung auf den Weg gebracht hatte. Die Französische Revolution gilt hier nicht als Vollendung, sondern als Desavouierung der Aufklärung, als eine Blamage, die man um so heftiger empfindet, je mehr man sich mit den Zielen der Aufklärung identifiziert.
Hier heißt Aufklärung mithin Reform und nicht Revolution; hier glaubt man, daß der aufgeklärte Kopf, gerade weil er sich am Vorbild
[<< 39]
der Natur orientiere, nicht auf den radikalen Bruch mit dem Alten setzen könne, sondern das Neue, Bessere immer nur im Zuge einer „organischen Entwicklung“ anstreben werde; daß er nicht in spektakulären geschichtlichen Aktionen die Erlösung der Menschheit von allem Übel suche, sondern in der geduldigen Arbeit an vielen kleinen Entwicklungsschritten auf pragmatische Lösungen ausgehe. Der Aufklärer, so denkt man hier, sucht immer den Mittelweg und meidet Extremismus und Radikalismus; er wirft das Alte nicht einfach über Bord, sondern weiß es differenziert zu würdigen, verwirft nur, was er als unfruchtbar erkennt, und sucht die produktiven Momente der Tradition weiterhin zu nutzen. Und in der Tat: mit dieser Sicht der Dinge ist diese dritte Gruppe von Intellektuellen näher bei der Aufklärung des 18. Jahrhunderts als die Radikalen unter den Revolutionären in Frankreich.
So bereitet es den Angehörigen dieser dritten Gruppe auch größtes Unbehagen, mit ansehen zu müssen, welche tiefen Gräben die Jakobiner und die Gegenaufklärer mit ihrem Nationalismus zwischen den Völkern aufreißen. Der aufklärerische Glaube an die natürliche Gleichheit aller Menschen verbietet es ihnen ebensowohl, eine Überzeugung wie die der Jakobiner zu teilen, daß die französische Nation mit ihrem revolutionären Modernismus allen anderen Nationen überlegen sei, wie sich auf den Gedanken der deutschen Romantiker einzulassen, daß die Franzosen von Natur aus zu einer oberflächlichen Vernünftelei geneigt seien, die Deutschen hingegen zu einem Tiefsinn, der tiefer reiche als alle französische Vernunft.
In diesem Sinne haben sich Männer wie Goethe in den Jahren nach 1789 darum bemüht, mit ihren aufklärerischen Überzeugungen Kurs zu halten, haben sie alles versucht, um die Fahne der Aufklärung weiterhin hochzuhalten. Für sie galt es, all das, was sie an der Französischen Revolution als Blamage des aufklärerischen Denkens empfanden, zu verwinden, ohne in das Fahrwasser der romantischen Gegenaufklärung zu geraten.24
[<< 40]
Napoleon
Das revolutionäre Frankreich hat sich bekanntlich bald wieder aus dem Chaos der Terreur herausgearbeitet und zu neuen Ordnungsstrukturen gefunden, vor allem dank des Revolutionsgenerals Napoleon Bonaparte, der 1799 Erster Konsul der Republik wurde und diese Republik 1804 in ein Kaiserreich verwandelte, um sich selbst zu dessen Kaiser zu krönen. Das politische System Napoleons war eine außerordentlich effiziente Mischung zwischen Errungenschaften der Revolution und dem alten Prinzip der Monarchie. So ist es Napoleon zeitweise gelungen, den größten Teil Europas zu unterwerfen; einzig bei England und Rußland blieb ihm der Erfolg verwehrt. Was Deutschland anbelangt, hat Napoleon nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt (1806) die beiden wichtigsten Mächte, Österreich und Preußen, niederwerfen und das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“ zerschlagen können. Der Wiener Kaiser legte die deutsche Kaiserkrone nieder und nannte sich nur noch Kaiser von Österreich, weite Teile Deutschlands wurden in einem sogenannten Rheinbund an Frankreich angeschlossen, erhielten eine französische Besatzung und mußten Kontributionen und die Aushebung von Soldaten für die Kriege Napoleons über sich ergehen lassen.
Nationalromantik
Das sind nun eben die Jahre, in denen ein Großteil der Deutschen und ihrer Literatur zugleich romantisch und nationalistisch wurden, in denen sich romantische und nationalistische Vorstellungen zur „Nationalromantik“ verbanden und in den Mittelpunkt der kulturellen Bestrebungen traten. Da die politisch Interessierten unter der französischen Fremdherrschaft zur Untätigkeit verdammt waren, konzentrierten sie sich darauf, den Haß gegen die Franzosen zu schüren, und in einem Atemzug damit einen Haß auf die Revolution und die Kultur der Aufklärung, aus der sie hervorgegangen war; und sie scheuten keine theoretischen Mühen, um dem allem einen tiefen weltgeschichtlichen Sinn zu unterlegen. Zugleich widmete man sich der Besinnung auf die wahre „Deutschheit“, auf die deutsche Eigenart und die große deutsche Vergangenheit. Ein nationales Wir-Gefühl machte sich breit, wie man es bis dahin in Deutschland noch nicht gekannt hatte. Die Zerschlagung des deutschen Reichs führte dazu, daß man sich auf des alten Reiches Herrlichkeit besann, auf das Mittelalter mit seinen römisch-deutschen Kaisern und seiner Ritterherrlichkeit, seiner tiefen Frömmigkeit, seinen Kreuzzügen und
[<< 41]
vielem anderem mehr, in dem man die reine „Deutschheit“ am Werk sehen wollte. Die romantische Bewegung richtete ihren Blick nun immer fester auf die Vergangenheit, wurde immer nationaler, frömmer und konservativer.
„Befreiungskriege“ und Restauration
Dieser Geist der Nationalromantik entlud sich dann in den sogenannten „Befreiungskriegen“ von 1813/15. Napoleon wurde nach dem gescheiterten Versuch zur Eroberung Rußlands und dem Verlust der „Völkerschlacht“ bei Leipzig aus Deutschland herausgeworfen, bis nach Paris verfolgt und abgesetzt. Auf dem Wiener Kongreß (1814/15) wurde dann die europäische Staatenwelt neu geordnet. In Deutschland machte sich das „System Metternich“ breit, benannt nach dem leitenden Minister Österreichs Clemens von Metternich (1773–1858) und basierend auf der „Restauration von Thron und Altar“, der Erneuerung der alten Monarchien und Kirchen.25
Aber diese gegen die Revolution gerichtete Restauration der alten Mächte hatte denn doch einige Schönheitsfehler. Das Deutsche Reich wurde nicht wirklich wiederhergestellt, es gab keinen deutschen Kaiser mehr, nur noch einen Bund deutscher Fürsten, den „Deutschen Bund“. Die Herren der größeren deutschen Fürstenstaaten wie Bayern und Württemberg rückten die kleineren Fürstentümer und das Kirchengut nicht wieder heraus, die sie ihren Ländereien als Satrapen Napoleons hatten einverleiben können. Und die Ideen der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Volkssouveränität, Verfassungsstaat mit gewähltem Parlament, Gleichheit vor dem Gesetz – ließen sich in den Köpfen der Menschen nicht einfach wieder ausknipsen; es blieb eine Grundunruhe in der Gesellschaft, ganz besonders aber unter den Intellektuellen und Literaten.
Viele Fürstenstaaten gaben sich nun immerhin eine Verfassung und wurden zu konstitutionellen Monarchien, als erster in Deutschland das Herzogtum Sachsen-Weimar, übrigens auf Betreiben des Herzogs Carl August selbst und gegen den Willen seines Rats Goethe. Erst später
[<< 42]
hat Goethe dafür ein Verständnis entwickelt und die Entscheidung gut geheißen, nachzulesen etwa in den „Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan“ (1819). Und das „System Metternich“ überdauerte am Ende weniger durch die heilige Allianz von „Thron und Altar“ als vielmehr durch die Zensur und das Spitzelwesen, mit dem es die aufmüpfigen Intellektuellen in Schach hielt, durch die sogenannte „Demagogenverfolgung“.
Restauration und Romantik
Die Romantik hat spätestens 1815 eben jene Unschuld verloren, an deren Wiederherstellung ihr so viel gelegen war. Denn ihre Begeisterung für die Ritterwelt und die schlichte Frömmigkeit des Mittelalters konnte nun kaum mehr anders verstanden werden denn als das schöngeistige Unterfutter der „Restauration von Thron und Altar“, als ideologische Stütze des „Systems Metternich“; in den Jahren vor 1815 hatte sie immerhin noch als Protest, als Widerstand gegen das Regime Napoleons durchgehen können. In einem Punkt allerdings blieb die Romantik auch weiterhin auf Konfrontationskurs mit den Machthabern. Als „Nationalromantik“ stand sie für die Idee der deutschen Einheit ein, kämpfte sie für einen deutschen Nationalstaat, und das konnte weder Metternich angenehm sein, der in Wien dem Vielvölkerstaat Österreich mit allerlei Territorien in Tschechien, Ungarn, Oberitalien und auf dem Balkan vorstand, noch den deutschen Fürsten, denn es stellte ihre Souveränität in Frage.
Biedermeier und Vormärz
In dieser Situation wurden die Autoren des „Vormärz“,26 die „Jungdeutschen“ 27 groß, die sich einerseits der Welt der romantischen Poesie verbunden fühlten und andererseits durch die Ideen der Französischen Revolution und die antifranzösische Agitation der „Befreiungskriege“ politisiert waren. Heinrich Heine (1797–1856) hat seit 1822 Gedichte veröffentlicht, mit großem Erfolg; seine Anfänge als Autor fallen wie die der meisten Jungdeutschen also noch in die Goethezeit. Neben den Jungdeutschen machte sich in der Literatur dann auch das sogenannte Biedermeier breit, halb der Klassik und halb der Romantik
[<< 43]
verbunden, dabei aber mehr oder weniger unpolitisch, jedenfalls auf den ersten Blick.28
Die erste große Erschütterung des „Systems Metternich“ ging wiederum von Frankreich aus, mit der Juli-Revolution von 1830, die hier die „Restauration von Thron und Altar“ beendete. Der „Bürgerkönig“ Louis Philippe kam an die Macht, Frankreich wurde zum Paradies einer Bourgeoisie, die sich ganz dem wissenschaftlichen Fortschritt und dem Kapitalismus verschrieben hatte, und zugleich zu einem relativ liberalen Land mit einer lebhaften Presse. Als solches wurde es zum Exil vieler politischer Emigranten, die vor dem „System Metternich“ aus Deutschland flohen. So wich etwa Heine 1831 nach Paris aus, um dort bis zum Ende seines Lebens zu bleiben. Der deutsche Vormärz blickte nach Paris, das nun erneut zu einer Brutstätte moderner Ideen wurde.
Und damit zurück zu dem Schema literarischer Epochen, wie es von der nationalen Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ausgearbeitet worden ist, zu der Vorstellung vom Stufengang der deutschen Literatur von der Aufklärung über den Sturm und Drang und die Weimarer Frühklassik hin zum Gipfelpunkt des „klassischen Jahrzehnts“, und von da über Hoch- und Spätromantik wieder hinab zu den Epigonen von Klassik und Romantik, zu den „Biedermeiern“ und „Tendenzdichtern“ des Vormärz, und zurück zu der Frage, wo die Probleme dieses Epochenschemas liegen.