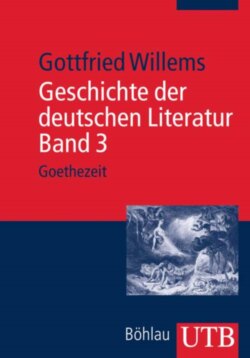Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 3 - Gottfried Willems - Страница 14
2.4.2 Das „klassische Jahrzehnt“
ОглавлениеVon der „Frühklassik“ zur „Hochklassik“
Die nächste epochale Stufe in der Entwicklung der deutschen Literatur soll nun mit dem Übergang von der „Weimarer Frühklassik“ zur „Hochklassik“, zum „klassischen Jahrzehnt“ der Jahre 1794 bis 1805 erreicht sein. In diesem Jahrzehnt soll der Scheitelpunkt des Entwicklungsbogens zu sehen sein, der Gipfel der deutschen
[<< 51]
Literaturgeschichte. Hier soll sich die Epiphanie des deutschen Wesens vollendet haben, in einer Literatur, die den Deutschen ein- für allemal ihre Identität offenbart, sie auf unüberbietbare, eben klassische Weise mit sich selbst bekannt gemacht und zum Bewußtsein ihrer selbst gebracht hätte. Drei Ereignisse sollen den Aufstieg zu dieser höchsten Stufe markieren: 1. Goethes italienische Reise von 1786 bis 1788, seine erste authentische Begegnung mit dem „klassischen Boden“ Italiens, wie sie ihm eine vertiefte Annäherung an den Geist und die Formkultur der Antike ermöglicht habe, 2. die Französische Revolution seit 1788/89, und 3. der Anschluß Schillers an Goethe im Jahr 1794.42
Werke des „klassischen Jahrzehnts“
Als Kernbereich der Hochklassik wird das „klassische Jahrzehnt“ angesehen; das soll die Zeit gewesen sein, in der die „göttlichen Dioskuren“ Goethe und Schiller in enger Zusammenarbeit den Deutschen die klassischsten ihrer klassischen Werke geschenkt hätten. Im Gespräch mit Schiller schließt Goethe 1795/96 seinen Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ ab, das Muster des deutschen Entwicklungs- und Bildungsromans, und fördert seinen „Faust“, die „Bibel der Deutschen“ (Heine), bis dahin, daß er 1808 „der Tragödie ersten Teil“ veröffentlichen kann. Schiller schreibt seine großen philosophisch-ästhetischen Abhandlungen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ (1795) und „Über naive und sentimentalische Dichtung“ (1795/96) und entwickelt anschließend von ihnen aus das Modell seiner klassischen Dramen, von „Wallenstein“ (1800) über „Maria Stuart“ (1801), „Die Jungfrau von Orleans“ (1802) und „Die Braut von Messina“ (1803) bis zu „Wilhelm Tell“ (1804). Gemeinsam arbeiten Goethe und Schiller an ihren Balladen, an theoretischen Entwürfen wie dem Aufsatz „Über epische und dramatische Dichtung“ (1797), an den satirisch-kulturkritischen Epigrammen der „Xenien“ (1797) und an literarischen Zeitschriften, mit denen sie den Deutschen ihr klassisches Kunstprogramm nahebringen.
[<< 52]
Das Konstrukt einer „Deutschen Klassik“
Die Konstruktion des „klassischen Jahrzehnts“ ist wahrhaft abenteuerlich und geht in einer Weise an den historischen Realitäten vorbei, die sich an Verdrehtheit kaum überbieten läßt. In einer doppelten Konfrontation also soll der deutsche Volksgeist hier zu sich selbst gekommen sein: in der authentischen Begegnung mit der altgriechischen Kunst und Kultur und in der kritischen Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution. Und das Ergebnis soll nun eben eine durch und durch deutsche Literatur gewesen sein, eine Literatur, die in der Gegenwendung gegen die oberflächlich aufgeklärte, rationalistische Kultur der Franzosen und den politischen Aktionismus ihrer Revolutionäre den deutschen Tiefsinn, den Sinn für das Irrationale zur Geltung brächte, um neuerlich zu den ewigen Fragen der Menschheit vorzudringen und die Prinzipien der Humanität in einer Vollendung der Formen zu gestalten, wie sie zuvor allenfalls den Griechen gegeben gewesen wäre. Die Deutschen sollen so als einzige unter den modernen Nationen dahin gelangt sein, den Geist des Griechentums, seine Humanitäts- und Formkultur nicht nur nachzuahmen, sondern bis in ihre tiefsten Regungen hinein zu erfassen und unter den Bedingungen der Moderne neuerlich produktiv zu machen, sie in die moderne Welt hinein wiederaufleben zu lassen – die Deutschen allein, weil der deutsche Geist, wie man hier glaubt, dem der Griechen wesensverwandt sei.
Die Rezeption der griechischen Kultur
So viel ist an diesem Bild immerhin richtig, daß sich die Autoren der „Goethezeit“ in jeder erdenklichen Form mit der Kultur der Griechen und der Französischen Revolution auseinandergesetzt haben und daß diese Auseinandersetzung für ihre Arbeit konstitutiv war. Freilich hatte man die Kultur der Griechen während des gesamten 18. Jahrhunderts schon immer mit im Blick, dafür mußte nicht erst ein Goethe nach Italien fahren. Seit den Zeiten des frühneuzeitlichen Humanismus war das Erbe der griechisch-römischen Antike allgegenwärtig, und gerade im Zeitalter der Aufklärung hatte sich das Interesse mehr und mehr von der römischen auf die griechische Antike verlagert, als auf die ursprünglich-natürlichere Schicht der antiken Kultur. So finden sich auch unter den Aufklärern schon zahllose Gräkomanen – man denke nur an Wieland, oder an den für Wieland und Goethe so wichtigen Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) – und dies nicht nur in Deutschland, sondern überall im aufgeklärten Europa.
[<< 53]
Die Wirkung der Französischen Revolution
Neu war nun freilich die Französische Revolution, war die Art und Weise, wie Kunst und Literatur bis in die innersten Bezirke der künstlerischen Produktivität hinein von aktuellen politischen Ereignissen in den Bann geschlagen wurden. Denn die Revolution hat alle namhaften Autoren der Zeit bewegt, unausgesetzt und in der persönlich aufwühlendsten Weise. Das gilt für einen altgedienten Aufklärer wie Wieland genauso wie für den alten Klopstock, den Abgott des Sturm und Drang. Wieland begleitete die Ereignisse in Frankreich mit einer Serie von Artikeln in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Teutscher Merkur“, und Klopstock dichtete eine Reihe von Revolutionsoden, mit denen die moderne politische Lyrik in Deutschland beginnt. Die Revolution beschäftigte Goethe und Schiller, sie beschäftigte die Frühromantiker, die Brüder Schlegel und Novalis, und ihren philosophischen Mentor Fichte, und sie beschäftigte einen Jean Paul nicht weniger als einen Kleist oder Hölderlin.
Bei Goethe hatte der Ausbruch der Revolution zur Folge – und das kommt in dem alten Epochenschema und seinem Bild von der Hochklassik durchaus nicht zur Geltung – daß das Erlebnis Italiens und die Begeisterung für die Antike, wie er sie 1788 aus Italien mitgebracht hatte, in ihm zunächst wie ausgelöscht waren; sein ganzes Denken und Schaffen kreiste um das beunruhigend-faszinierende Ereignis der Revolution. Er mochte seine klassische „Iphigenie“ von 1787 nicht mehr sehen, Versuche, antike Autoren wie Sophokles wiederzulesen, empfand er nun geradezu als einen „höheren Grad von Folter“ (HA 10, 310–311), und die literarische Aufarbeitung der Italienreise, der Plan einer Reisebeschreibung, aus dem dann die berühmte „Italienische Reise“ hervorgegangen ist, blieb bis 1816 liegen, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Phase der kriegerischen Unruhe durch den Wiener Kongreß zum Abschluß gekommen war.
Goethe war nie weniger klassisch als im Übergang zum „klassischen Jahrzehnt“, hat sich nie weniger am Geist und an der Kunst der alten Griechen orientiert als in eben den Jahren, die von der älteren Literaturgeschichtsschreibung als Übergang zur Hochklassik verbucht worden sind. Er schreibt Werke wie die politisch-satirischen Komödien „Der Groß-Cophta“ (1792), „Der Bürgergeneral“ (1793), „Die Aufgeregten“ (1794), wie die aufklärerisch radikalen, schneidend kritischen „Venetianischen Epigramme“ (1791) und die „Xenien“ (1796), wie den epischen
[<< 54]
Zyklus „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ (1794/95), in dem er die verschiedensten Gattungen und Formen des Erzählens durchprobiert und den man auch wie einen berühmten Text von Brecht „Flüchtlingsgespräche“ nennen könnte, wie die eigentümlich zwischen Epos, Idylle und Zeitgeschichte angesiedelte Verserzählung „Hermann und Dorothea“ (1796). Und da geht es überall ausdrücklich um die Revolution und ihre Folgen; auf die Antike und ihre Kunst hingegen verweist an diesen Werken nur wenig. Ähnliches gilt von den Hauptwerken dieser Zeit, von „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ (1795/96) und „Faust I“ (1808); denn auch bei ihnen finden sich kaum Spuren der Antike.
Goethe ist offensichtlich durch die Französische Revolution und ihre Folgen zutiefst verunsichert. Es beginnt für ihn eine Phase des Suchens und Herumtastens, in der er es mit allen möglichen Themen und Formen versucht, insbesondere mit solchen, von denen er hofft, daß sie es ihm erlauben würden, „dieses schrecklichste aller Ereignisse in seinen Ursachen und Folgen dichterisch zu gewältigen“ (HA 13, 39). Er erprobt die verschiedensten Gattungen, modelt sie um und mischt sie mit anderen – fast möchte man von einem Experimentieren sprechen – und entfernt sich so besonders weit von dem, was der Kunst der Antike an reinen, vollendet schönen, in sich ruhenden Formen, an „edler Einfalt“ und „stiller Größe“ (Winckelmann)43 zugeschrieben worden ist. Schon allein deshalb ist das Epochenetikett „Hochklassik“ für diese Jahre mehr als problematisch.
Autonomie der Kunst als Distanz zur Zeitgeschichte?
Ein weiteres problematisches Moment der Doktrin von der „Hochklassik“ liegt in der Vorstellung, Goethe und Schiller hätten sich hier, um die Autonomie der Kunst, die geistige Unabhängigkeit des Künstlers von institutionellen und ideologischen Bindungen weiter voranzutreiben, zu dem Grundsatz bekannt, die Kunst solle sich von Zeitgeist und Zeitgeschehen fernhalten; große, klassische Kunst, Kunst von bleibender Bedeutung könne nur dort entstehen, wo der Künstler aktuelle politische Fragen meide und sich ausschließlich auf Formprobleme, auf die ordnende Arbeit der Formgebung konzentriere.
[<< 55]
Zweifellos bezeichnet das Ringen um Autonomie, um eine Kunst, die der freien Entfaltung des Denkens Raum gäbe und sich nur an die Gesetze gebunden fühlte, die sie sich selbst gäbe, eine grundlegende Tendenz in der Arbeit von Goethe und Schiller.44 Doch zeigt die große Zahl von Werken, die sich der Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution verdanken und die diese Auseinandersetzung bald mit großer Direktheit und bald auf eine mehr indirekte Weise bezeugen, daß dies für sie keineswegs bedeutet, jederzeit gegenüber dem aktuellen Zeitgeschehen Distanz wahren zu müssen. Autonomie heißt hier nach Ausweis von Goethes und Schillers eigener literarischer Praxis, daß der Künstler, wenn ihm danach ist, durchaus politisch werden kann, daß er es aber nicht muß, wenn ihm nicht danach ist; daß er weder einer moralischen Verpflichtung noch einem geschichtlichen Zwang unterliegt, mit politischen Leitartikeln in poetischer Form auf das Zeitgeschehen einzugehen.
Goethe ist wie Schiller noch weit von dem Prinzip „l’art pour l’art“ entfernt, von dem Gedanken, Kunst nur um der Kunst willen zu schaffen. Die Position des „l’art pour l’art“ hat sich ebenso wie die Gegenposition einer engagierten Kunst, einer „art engagée“, erst nach Goethe und ohne sein Zutun herangebildet; als ein Mann der Aufklärung hätte er mit ihr nicht viel anfangen, ja sie womöglich gar nicht verstehen können. Man hat sie aber, nachdem sie einmal da war, im Rückblick gerade ihm als einem Klassiker zugeschrieben. Zu den ersten, die damit begannen, gehört Heine (s. Kap. 4.5); aber hier irrte Heine. Die Idee des „l´art pour l´art“ kommt ebenso wie die einer „art engagée“ erst in der Generation Heines auf; was Goethe und Schiller sich unter autonomer Kunst vorstellen, hat damit noch kaum etwas zu tun.
Nationalismus vor 1806?
Ein weiterer Schwachpunkt im überlieferten Bild der Epoche der „Hochklassik“ ist, daß die Stellungnahmen zur Französischen Revolution hier zwar immer kritischer werden, vor allem im Blick auf die „Terreur“ der Jahre 1793 und 1794, daß diese Kritik an der Revolution zunächst aber noch kaum unter nationalem Vorzeichen steht. Man
[<< 56]
beklagt, daß die Ziele der Aufklärung im revolutionären Taumel mehr und mehr verrutschen und verlorengehen, aber man sucht die Ursachen dafür noch nicht primär in einem typisch französischen Unwesen, um dem typisch deutsche Werte entgegenzuhalten. Diese Sicht der Dinge gewinnt erst nach dem Ende des „klassischen Jahrzehnts“ 1805 die Oberhand, genauer gesagt: nach 1806, nach dem Sieg Napoleons über Preußen und Österreich, in der „Franzosenzeit“, der Zeit der französischen Vorherrschaft in Deutschland; sie ist im Kreis um Goethe und Schiller noch kaum wahrzunehmen.
Es waren vor allem die Verhältnisse in der Zeit der französischen Besatzung, die dem nationalistischen Denken zum Durchbruch verhalfen; erst die französische Fremdherrschaft hat den modernen deutschen Nationalismus ausgebrütet. Und zwar wurde er zunächst, in den Jahren 1806 bis 1813, besonders in den Kreisen der Gebildeten kultiviert, von den Intellektuellen, denen nun plötzlich etwas Tiefsinniges zum Begriff der „Deutschheit“ einfiel. Erst in den sogenannten Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 konnte er schließlich auch von der in kriegerische Aktion versetzten breiten Masse der Bevölkerung Besitz ergreifen.
Die Zentren dieses neuen Denkens waren in erster Linie Universitätsstädte, Städte wie Heidelberg, wo Joseph Görres in nationalromantischem Sinne auf die junge Generation einwirkte und 1808 die „deutschen Volksbücher“ herausgab, und Berlin, wo Johann Gottlieb Fichte – ebenfalls 1808 – „Reden an die deutsche Nation“ hielt und wo eine „christlich-deutsche Tischgesellschaft“ den nationalen Gedanken pflegte. Hinzu kamen Epizentren wie Dresden, wo der Kleist-Freund Adam Müller im Winter 1806/07 „Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur“ hielt; übrigens hat sich auch Kleist selbst zeitweise von der nationalistischen Propaganda in die Pflicht nehmen lassen. Aber das alles geschah eben erst nach 1806. Der Revolutionsdiskurs wird also gerade nicht im „klassischen Jahrzehnt“, sondern erst danach, in der Zeit der Heidelberger und Berliner Romantik, zu einer Plattform für Spekulationen über das französische und deutsche Wesen und für die Verpflichtung der deutschen Literatur auf dieses deutsche Wesen.
Aufbrechen des Gegensatzes von Klassik und Romantik
Vollends schwierig wird es mit der Vorstellung von einer Epoche namens „Hochklassik“, wenn man sich klarmacht, daß sich die deutsche Kultur, Kunst und Literatur im „klassischen Jahrzehnt“ gerade
[<< 57]
nicht auf jenes Ziel zu bewegt, in jene Verfassung hinein entwickelt haben, die sie laut Klassik-Doktrin eben hier erreicht haben sollen: daß nämlich alle, die an dieser Kultur produktiv teilhaben, nun endlich von ein und demselben Geist ergriffen, durchdrungen und zusammengebracht worden wären; daß die Vielfalt und Gegenwendigkeit der Bestrebungen, die „Zersplitterung des geistigen Deutschland“ im kollektiven Innewerden nationaler Eigenart an ihr Ende gekommen wäre. Daß die Deutschen nun zum vollen Bewußtsein ihrer selbst als Deutsche gelangt sein sollen, müßte doch eigentlich heißen: alle Unsicherheit in Identitätsfragen hört auf, überall kann sich ein ähnlich gerichtetes Denken, Fühlen, Wollen und Handeln breitmachen. Aber das Gegenteil ist richtig; die „Zersplitterung des geistigen Deutschland“ geht in eine neue Runde. Denn gerade damals tut sich in der deutschen Kultur, Kunst und Literatur ein neuer Gegensatz auf, eine ganze neue Welt von Widerspruch und Streit, nämlich der Gegensatz von Aufklärern und Gegenaufklärern, zugespitzt im Gegensatz von Klassik und Romantik.