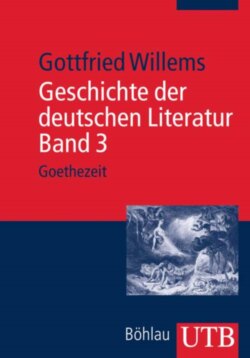Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 3 - Gottfried Willems - Страница 15
2.4.3 Jenaer Frühromantik und Weimarer Klassik
ОглавлениеDie Frühromantiker
In eben den Jahren, in denen Goethe und Schiller ihre Zusammenarbeit begründen, beginnt mit der Jenaer Frühromantik zugleich auch die romantische Bewegung.45 Seit 1795 treffen die jungen Leute, die die Romantik auf den Weg bringen sollten, in Jena ein. Sie kommen, um den Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) zu hören, aber auch um die Nähe von Goethe zu suchen. Als erster kommt August Wilhelm Schlegel (1767–1845), dann sein jüngerer Bruder Friedrich Schlegel (1772–1829), dann Ludwig Tieck (1773–1853), und sie kommen mitsamt ihren Damen; gelegentlich stößt Friedrich von Hardenberg (1772–1801) zu ihnen, der sich als Dichter den Namen Novalis gibt und der schon vor den anderen in Jena studiert hat. Um 1800 fliegt
[<< 58]
das Grüppchen dann schon wieder auseinander, aber bis dahin ist viel geschehen. Die Bewegung ist konsolidiert und kann sich kreuz und quer durch Deutschland ausbreiten.
Klassik und Romantik
In dem Jenaer Kreis ist nun etwas entstanden, das durchaus in eine andere Richtung zielte als das, was Goethe, Schiller und ihre Mitstreiter wollten und unternahmen, etwas, das sich mit deren Bestrebungen kaum vereinbaren ließ, und doch sollen beide Gruppen gemeinsam für die Blütezeit der deutschen Nationalliteratur einstehen. Was ihr Verhältnis so kompliziert macht, ist, daß die Ideen, von denen aus Goethe und Schiller zu klassischen Nationalautoren der Deutschen stilisiert wurden, im Rahmen der literarisch-ästhetischen Programmatik der Frühromantik entwickelt worden sind, daß dies allerdings Ideen sind, die von Goethe und Schiller nicht geteilt wurden. Das Konzept einer deutschen Klassik ist im Grunde das Resultat eines großen Mißverständnisses.
Das Programm der Frühromantik
Die Anfänge der romantischen Bewegung 46 sehen zunächst noch nach einem engen Anschluß an Goethe aus. Friedrich Schlegel hat die Konstellation, in der die Romantik entstanden ist, einmal in das Bonmot gefaßt: „Die Französische Revoluzion, Fichte’s Wissenschaftslehre, und Goethe’s Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters“.47 Das ist wie bei so vielen Aphorismen von Schlegel zunächst nicht mehr als eine kühne Behauptung, doch gibt sich darin zu erkennen, was für die Romantiker selbst die wichtigsten Ansatz- und Orientierungspunkte ihres Programms waren. Und dazu gehören nun eben auch Goethe und sein Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“; und zwar werden sie hier auf eine Weise beschworen, durch die ihnen eine geschichtliche Bedeutung zugesprochen wird, die mit der der Französischen Revolution vergleichbar sein soll. Bei näherem Zusehen kann man
[<< 59]
freilich entdecken, daß in Schlegels Aphorismus schon der Bruch mit Goethe lauert.
Zunächst macht er allerdings deutlich, daß die Frühromantiker wie Goethe, Schiller und all die anderen zeitgenössischen Autoren auf die Französische Revolution starren, daß sie das, was sie als Literaten treiben, im Blick auf die Revolution definieren. Auch sie wollen eine Revolution ins Werk setzen, als Gegenentwurf zu dem, was in Frankreich geschieht, eine durchaus anders geartete, nämlich eine geistige Revolution, eine Kulturrevolution. Als deren Leitsterne erwählen sie sich eben Goethe und Fichte.
Freiheit tiefer denken
Die Maxime der Französischen Revolution lautet bekanntlich: „Liberté, Egalité, Fraternité“, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. An der ersten Stelle steht die Forderung nach Freiheit, und das heißt hier: nach der Freiheit des Individuums. Diese Freiheit soll nun durch das Rechtssystem eines Rechtsstaats garantiert und bis hin zu verfassungsmäßigen Rechten der Mitwirkung am politischen Geschehen weiterentwickelt werden. Freiheit bedeutet hier mithin zunächst und vor allem die rechtliche Absicherung und Förderung der Individualisierung, wie sie sich im Zuge der Modernisierung eingestellt hat und ohne solche Modernisierung nicht zu denken ist.
Die Frühromantiker greifen nun den von der Revolution herausgestellten Begriff der Freiheit des Individuums auf, um ihn noch einmal neu und „tiefer“ zu denken als die zeitgenössische französische Politik. „Tiefer“ zu denken heißt für sie aber vor allem, den Begriff der Freiheit mit dem der Phantasie zu verknüpfen. Die Romantiker ziehen den Freiheitsbegriff aus dem Bereich der Politik und des Rechts in den der Kunst, der Ästhetik, wo die Phantasie zu Hause ist. Ich will frei sein, um mir selbst leben und ganz ich sein zu können, und ganz ich zu sein heißt hier zunächst und vor allem, seiner Phantasie leben zu können, in seinem ureigensten Phantasieleben ganz bei sich selbst anzukommen, den innersten Quellen der „Ichheit“, der Subjektität nahekommen und sie ausleben zu können.
Dieser Ansatz führt die Romantiker zu Fichte und zu Goethe. Fichte ist der Philosoph des Ichs, der die Welt in der Nachfolge Kants vom Ich her denkt, von einer Subjektivität her, die der materiellen Welt, der Natur, der Gesellschaft, dem Erfahrbaren überhaupt immer schon vorausliegen soll; so haben ihn jedenfalls die Romantiker gelesen. Und
[<< 60]
was die Phantasie ist und kann, also wie man ich und frei sein kann, zeigen ihnen Goethe und sein Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. In ihm erblicken sie die bedeutendste Manifestation des phantasierenden Individuums in der modernen Kunst, jedenfalls zu Anfang, bei seinem Erscheinen; später werden sie das anders sehen. Da wird es dann heißen, Goethe habe im Wilhelm Meister die Phantasie an die „Ökonomie“ – die Landwirtschaft – verraten; so ist es zum Beispiel bei Novalis zu lesen (NS 3, 638–639). Wilhelm Meister beendet seine Lehrjahre ja in einem Kreis von Gutsherren, die ihre Güter im Geist aufklärerischer Reformen bewirtschaften.
„Progressive Universalpoesie“
Demgemäß bedeutet für die Romantiker von Freiheit zu reden zunächst und vor allem, von dem zu reden, was Friedrich Schlegel „progressive Universalpoesie“ nennt.48 Jede Erfahrung, jede Erkenntnis und Handlung des Menschen, jede menschliche Wirklichkeit kann von der Phantasie überstiegen und überboten werden, und jedes Phantasiegebilde von weiteren, neuen Phantasien. In dieser unendlichen Progression des Phantasierens, die alles, was schon einmal Gestalt angenommen hat, alles Endliche hinter sich läßt, komme ich aber allererst recht bei mir selbst an, erfahre ich mich allererst ganz in meiner Freiheit als Subjekt. Die eigentliche Revolution, der entscheidende Schritt in die Moderne ist deshalb für die Romantiker, die Phantasie zu entfesseln und damit der Subjektivität jede Fessel zu nehmen, das Ich seiner vollen, uneingeschränkten und durch nichts zu begrenzenden Freiheit innewerden zu lassen. Eben dies nennen die Romantiker das „Poetisieren“. Und in diesem Sinne fordern sie eine romantische Poesie als eine Welt von poetischen Erfindungen, von Phantasieexperimenten, in denen erkundet wird, wie weit die Phantasie des Menschen und damit die Freiheit des Individuums zu gehen vermag.
Hier zeigt sich nun auch, was es bedeutet, wenn der Begriff der Freiheit aus dem politischen in den ästhetischen Raum gezogen wird. Er verliert dabei seine konkrete politisch-gesellschaftliche Bedeutung – daß es mit ihm um bestimmte klar definierte Rechte des Individuums geht – und wird zu einer Kategorie der Innerlichkeit, der seelisch-geistigen Befindlichkeit. „Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg“,
[<< 61]
heißt es bei Novalis; „(i)n uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft“ (NS 2, 419). Vor allem um innere Freiheit soll es nun gehen. Eben dies nennen die Romantiker tief, verstehen sie als einen tieferen Begriff von Freiheit. Solchen Tiefsinn werden sie bald schon typisch deutsch nennen und dem entgegenstellen, was sie an den Franzosen als oberflächlich politisch begreifen. Und das wiederum werden sie mit dem Namen Goethes verknüpfen und auf sein Werk als das Werk des ersten Klassikers der Deutschen projizieren – die Keimzelle der Klassik-Doktrin.
Vom Vorbild der Antike zum Vorbild des Mittelalters
In diesem Zusammenhang ist schließlich auch zu sehen, daß die Romantiker auf die präromantischen Tendenzen der Aufklärung und des Sturm und Drang zurückgreifen, um die Kunst vom Vorbild der Antike, an dem sie sich seit der Renaissance und noch durch das gesamte 18. Jahrhundert hindurch orientiert hat, zum Vorbild des Mittelalters umzudirigieren. Was die Kunst der alten Griechen zu bieten hat, ist den Romantikern nicht tief genug; will sagen: was die griechische Kunst an Individualität und Subjektivität und insbesondere an jenem subjektiv-individuellen Phantasieren zu bieten hat, durch das sich das Ich allererst in den Vollbesitz seiner inneren Freiheit setzen können soll, geht ihnen nicht weit genug. Den Griechen fehlt in ihren Augen die reiche, tiefe, geheimnisvolle Innerlichkeit. Ihre Kunst ist für sie nur sinnlich und nicht übersinnlich, sie bleibt an den festen, klaren Formen der Natur haften, bleibt im Natürlichen, im Wirklichen stecken und bekommt das Übernatürliche nie wirklich zu Gesicht.
Da hat das Mittelalter den Romantikern mehr zu bieten. Erst im Mittelalter soll sich dem Menschen das Reich der Innerlichkeit voll und ganz erschlossen haben, in jener religiösen Kultur der Weltverachtung, in der der Christ sich auf Gott und das Jenseits zu leben weiß. Hier erst, in der mittelalterlichen Welt des Glaubens und der Glaubenswunder, soll die menschliche Phantasie ihre ganze Macht entfaltet haben, in all den Wundergeschichten, den Sagen, Märchen und Heiligenlegenden, in denen sie die materielle, sinnlich erfahrbare Welt hinter und unter sich läßt, um in ihr eigenes Reich heimzukehren. Hier vor allem wollen die Romantiker die Vorbilder für ihr „Poetisieren“ finden. Natürlich wissen sie, daß auch die Griechen ihre Mythen, ihre wunderbaren Geschichten von Göttern, Halbgöttern und allerlei phantastischen Fabelwesen hatten. Aber an diesen Mythen fehlt ihnen
[<< 62]
das persönliche, subjektive, innerliche, ichhafte Moment; sie sind für sie bloß kollektive Phantasieprodukte, Produkte einer gleichsam objektiven Phantasie, und auf das Subjektiv-Individuelle des Phantasierens kommt es ihnen ja vor allem an.
Soweit das Programm der Jenaer Frühromantik, wie es in den Schriften von Friedrich und August Wilhelm Schlegel und von Novalis niedergelegt ist. Inwieweit bedeutet dieses Programm nun, daß sich die Frühromantik von der Weimarer Klassik, von Goethe und seinem Kreis entfernt? Wo liegen in ihm vielleicht noch Momente der Nähe, wie sie die anfängliche Berufung auf Goethe plausibel machen können, und womit führt es von der Weimarer Klassik fort, gestaltet es sich zu einer Gegenposition, um nicht zu sagen: zum Programm einer Gegenklassik?
Die Aufwertung der Einbildungskraft durch die Aufklärung
Um hierauf eine Antwort finden zu können, muß man sich zunächst klarmachen, wie hier wie dort mit dem Erbe der Aufklärung verfahren wird. Wenn die Frühromantiker die Phantasie in den Mittelpunkt ihrer Poetik und ihres Menschenbilds rücken, dann knüpfen sie damit an eine Entwicklung an, die das gesamte 18. Jahrhundert durchzogen hat, an die Aufwertung der „Einbildungskraft“, wie sie von der Kunst- und Literaturtheorie der Aufklärung auf den Weg gebracht worden ist.49 Diese Aufwertung beginnt spätestens mit einer Abhandlung über „The Pleasures of the Imagination“, die Joseph Addison (1672–1719) 1712 in einer der wichtigsten Zeitschriften der Frühaufklärung in England, dem „Spectator“, veröffentlicht hat, ein Beitrag, der von den Schweizern Johann Jakob Bodmer (1698–1783) und Johann Jakob Breitinger (1701–1776) in ihrer eigenen Zeitschrift „Discourse der Mahlern“ (1721–1723) ins Deutsche übersetzt und damit im deutschen Sprachraum bekannt gemacht worden ist.
In diesem verstärkten Setzen auf die „Einbildungskraft“ läuft alles zusammen, was die Aufklärer an der Literatur-Konzeption des frühneuzeitlichen Humanismus zu kritisieren haben und wodurch sie der Literatur neue Ziele setzen. Anders als dort soll der Dichter nun nicht mehr so sehr belehren, eine gelehrte Bildung, insbesondere ein
[<< 63]
gelehrtes Wissen über den Menschen und über die Tugend vermitteln, als vielmehr sein Publikum unterhalten; und dem soll er vor allem dadurch genügen können, daß er die Phantasie in Bewegung setzt, die „Pleasures of the Imagination“ kultiviert.
Über solcher unterhaltlichen Aktivierung der Phantasie sollen sich die Gemütskräfte des Menschen – sinnliche Wahrnehmung, Gefühl, Witz, Scharfsinn – auf eine Weise entfalten können, zu der sie im wirklichen Leben kaum je Gelegenheit erhalten. So soll die Literatur den Menschen dahin führen, daß er alle diese Gemütskräfte in sich arbeiten spürt und sich darüber in seinen menschlichen Potentialen besser kennen lernt; daß er das, was den Menschen zum Menschen macht, unmittelbar an sich selbst erfahren, der „allgemeinen Menschennatur“, des „Allgemein-Menschlichen“ in der Selbsterfahrung unmittelbar innewerden kann. Kunst und Literatur sollen also nun nicht mehr so sehr auf die Vermittlung eines Wissens über den Menschen ausgehen, das von der Vernunft eingesehen werden will, denn vielmehr das Innewerden des „Allgemein-Menschlichen“ in der imaginären Selbsterfahrung ins Werk setzen.
Dieses aufklärerische Konzept von Literatur ist in Deutschland zuletzt vor allem von Lessing und Wieland ausgearbeitet und umgesetzt worden. Nach ihrer Vorstellung kommt nun alles darauf an, eine Geschichte so in die Phantasie des Lesers „hineinzumalen“, daß er sich in die dargestellten Figuren einfühlen, sich mit ihnen identifizieren und von daher in der Phantasie all die Regungen der Gemütskräfte miterleben kann, die an ihnen vorgeführt werden; daß er also selbst in Wallung gerät und so an sich selbst erfahren und sich bewußt machen kann, was der Mensch an Bewegungspotentialen in sich hat.
Der neue Geist des Aufs-Ganze-Gehens
An diese Vorstellung von den Aufgaben und Möglichkeiten der Poesie knüpft die Frühromantik an, aber sie tut dies auf eine Weise, die den Aufklärern selbst niemals in den Sinn gekommen wäre. Sie treibt sie nämlich auf die Spitze, sie radikalisiert sie, indem sie den Menschen nun ganz und gar von der Phantasie her denkt und die Phantasie absolut setzt. Damit ist ein entscheidender Punkt berührt, ein Moment, von dem her die Aufklärung des 18. Jahrhunderts allmählich an ihr Ende kommt und durch etwas Neues verdrängt wird. Dieses Neue können und wollen sich freilich zunächst noch nicht alle zueigen machen; zumal die Weimarer Klassik hat sich ihm mit
[<< 64]
Entschiedenheit verweigert, so daß sich die Literatur nun mehr und mehr gespalten hat und in allerlei Widersprüchen und Kontroversen auseinandergelaufen ist. Man könnte dieses Neue den Geist der Radikalisierung nennen, den Geist des Aufs-Ganze-Gehens, oder, in kritischer Wendung, „Totalitätsobsession“ – ein Zug, der der Aufklärung fremd war, ja den sie gerade als Aufklärung meinte bekämpfen zu müssen. So daß an der Aufklärung festhalten wollen nun vor allem heißt, die Menschen vor dem neuen Geist der Radikalisierung, des Aufs-Ganze-Gehens, vor Extremismus und Totalitarismus bewahren wollen.
Die Vorstellungen und Anliegen der Aufklärung werden in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts zunehmend auf die Spitze getrieben, ins Extrem geführt und verabsolutiert, so wie der Phantasiebegriff in der frühromantischen Ästhetik. Es geht nun immerzu ums große Ganze, so daß der Begriff der „Totalität“ 50 zu einem Schlüsselbegriff für das Denken der Epoche wird, für ihre Vorstellungen von Politik, ihre Philosophie, Wissenschaft, Ästhetik und Literaturtheorie. Nicht alle haben daran teil, vor allem die nicht, die an der Aufklärung festhalten wollen. Goethe partizipiert daran nur kurze Zeit, in der Phase des Sturm und Drang, was ihn vorübergehend in einen Konflikt mit Wieland hineintreibt, aber das ist für beide bald schon vorbei. Was im Sturm und Drang zunächst nur als Möglichkeit aufblitzt, kann sich seit der Frühromantik dann auf Dauer in der Literatur etablieren. Hier liegt die Wurzel der meisten Konflikte und Kontroversen im literarischen Leben der Epoche.
Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat Radikalismus und Extremismus verabscheut und statt dessen einem skeptischen Pragmatismus gehuldigt. Der Mensch ist für sie ein unvollkommenes, schwaches, zu Irrtümern und Fehlern neigendes Wesen; es bekommt ihm nicht, ja bringt ihn in höchste Gefahr, wenn er in seiner Fehlbarkeit aufs Ganze geht und nach dem Absoluten greift; er hat allen Grund, bescheiden zu sein, im Denken wie im Handeln, und natürlich auch in seinem Phantasieren. „The pride of aiming at more knowledge, and pretending
[<< 65]
to more perfection, (is) the cause of man’s error and misery“, heißt es im „Essay on Man“ von Alexander Pope,51 einem der meistübersetzten und meistgelesenen Werke des 18. Jahrhunderts: der Stolz, mit dem der Mensch auf mehr Wissen und auf Perfektion ausgeht, ist die Ursache seiner Irrtümer und seines Elends.
Nie wird der Mensch „erkenne(n), was die Welt im Innersten zusammenhält“, wie es in der Eingangsszene von Goethes „Faust“ heißt (HA 3, 20) – „Faust“ ist, wie wir noch sehen werden, zunächst und vor allem das Drama des Menschen, der aufs Ganze geht, die Gestalt Fausts ist die Inkarnation der neuen „Totalitätsobsession“ – und ebensowenig wird er die Entwicklungsprozesse der Gesellschaft jemals als ganze in den Griff bekommen. Deshalb soll er die Extreme meiden und nach dem „goldenen Mittelweg“ suchen, nach dem rechten Maß, das ihn in einem ihm gemäßen Rahmen irgendwo zwischen Himmel und Hölle trotz allem erfolgreich sein und sein Glück finden läßt. „Anstatt mit einander zu hadern, wo die Wahrheit sey? (…) lasset uns in Frieden zusammen gehen (…)“ (Wieland).52
Dieser skeptische Pragmatismus der Aufklärung wird nun in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts zunehmend in Frage gestellt, beginnend mit der Französischen Revolution, mit den Radikalen und Extremisten unter den Revolutionären. Natürlich wenden sich nicht alle gleichzeitig von ihm ab, viele wollen weiterhin an ihm festhalten, ja fühlen sich gerade angesichts der neuen Sehnsucht nach der Totalität, dem neuen Geist des Aufs-Ganze-Gehens und dessen praktischen Folgen in ihm bestärkt. Aber aus dieser Haltung wird nun eben eine Verteidigungsstellung, weil so viele und immer mehr von ihr abgehen.
Die Forderung nach dem „Großen und Ganzen“ im Sturm und Drang
In der deutschen Literatur hat sich der Geist des Aufs-Ganze-Gehens zum ersten Mal im Sturm und Drang zu Wort gemeldet. Wenn sich denn so etwas wie eine zentrale, alle Stürmer und Dränger verbindende Vorstellung benennen läßt, dann ist es der Gedanke, der in der Formel „ganz und groß“ (HA 12, 225) niedergelegt ist,
[<< 66]
wie sie Goethes Rede „Zum Shakespeares-Tag“ (1771) durchzieht. Der Stürmer und Dränger sucht das „Große und Ganze“, ja er möchte selbst „groß und ganz“ sein. Er will nicht mehr im Gedanken an die Unvollkommenheit des Menschen, an die Grenzen seiner Vernunft und die Schwachheit und Fehlbarkeit seines Handelns „bescheiden“ sein müssen, will sich nicht mehr auf das verpflichten lassen, was andere das rechte Maß und den goldenen Mittelweg nennen. Ihn interessiert allein das Extrem der Größe; insofern sucht er nach einer Sprache des Enthusiasmus, die es seiner Dichtung erlauben würde, wahrhaft aufs Ganze zu gehen.
Ein neues Interesse an Helden
In diesem Sinne entwickelt der Sturm und Drang auch ein neues Interesse an Heldenfiguren. Die Aufklärung hat sich durchweg kritisch gegenüber einer Literatur verhalten, die wie die des Humanismus und des Barock Helden verherrlicht. Lessing hat „mittlere Helden“ gefordert und auf die Bühne gestellt. Ein Held ist bekanntlich einer, der ohne Rücksicht auf Verluste aufs Ganze geht, der dabei auch das Scheitern riskiert, der keine Kompromisse macht und seinen Prinzipien treu bleibt bis in den Tod. Im Sturm und Drang sind solche Heldenfiguren wieder zu literarischen Ehren gekommen.
Allerdings – und insofern bleibt der Sturm und Drang dann doch der Position der Aufklärung verpflichtet – lassen die Dichter des Sturm und Drang ihre Helden, ihre großen Männer allesamt scheitern, von Goethes „Götz von Berlichingen“ (1773) bis zu den Helden von Schillers „Die Räuber“ (1781), „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ (1783) und „Kabale und Liebe“ (1784). Und zwar lassen sie sie nicht nur an einer modernen Umwelt scheitern, in der kein Platz mehr für ein Heldentum nach dem Maß der heroischen Antike ist, sondern sie lassen sie auch an sich selbst scheitern, an der Heldenrolle, die sie – sei es aus Begeisterung für eine große Sache oder um des Ruhms und der Ehre willen – auf sich nehmen. Sie erleben alle ein Ende mit Schrecken, sind am Ende physisch oder moralisch ruiniert. Und dennoch, trotz eines Scheiterns, das aus der Verblendung durch die Idee des Groß-und-ganz-sein-Wollens erwächst, umgibt die Helden des Sturm und Drang eine Aura der Faszination.
Ein neues Interesse an großen Gefühlen
Mit dem neuen Interesse am Heldentum geht ein nicht weniger neues Interesse an der großen Leidenschaft einher. Der Sentimentalismus, die Empfindsamkeit der Literatur der Aufklärung wächst sich
[<< 67]
im Sturm und Drang zum Kult des großen, existentiellen Gefühls aus, eines Gefühls, das „groß und ganz“ sein will. Die kleinen Freuden und zärtlichen Regungen, die sanften Tränen, das Getändel und Gezärtel, das die Empfindsamkeit in ihren Idyllen und Romanen, bürgerlichen Trauerspielen und rührenden Lustspielen kultiviert hat, gelten dem Sturm und Drang nichts mehr; er vermag in ihnen nurmehr noch eine Kinderei zu erblicken. Für ihn muß es immer gleich die große Leidenschaft und die extreme Begeisterung sein. Selbst wenn der Stürmer und Dränger sich bloß aufmacht zu einem nächtlichen Besuch bei seiner Liebsten, führt er sich „wild“ auf „wie ein Held“, der in die „Schlacht“ zieht; so Goethe in dem Gedicht „Es schlug mein Herz“ (1771), dem er später den Titel „Willkomm und Abschied“ gegeben hat (HA 1, 27). Wie um das Groß-und-Ganz-Sein kreist die Dichtung des Sturm und Drang unausgesetzt um den Absolutheitsanspruch des Gefühls.
Allerdings wird dieser Anspruch des Gefühls auf absolute Geltung hier ebenso wie das Heldentum als etwas Ambivalentes dargestellt; mag es auch noch so faszinierend sein, so erweist es sich zugleich doch auch als problematisch. Dafür ist gerade Schillers „Kabale und Liebe“ ein gutes Beispiel. Der Art und Weise, wie der Held Ferdinand mit seiner Liebe aufs Ganze geht (SW 1, 766–767, 774, 792–793, 807–808), überspringt den geliebten Menschen, wie er wirklich ist, und entpuppt sich am Ende als zerstörerische Obsession eines egomanen Gutmenschen. Auch hier wird der Standpunkt der Aufklärung mithin nicht wirklich verlassen.
Sturm und Drang und Aufklärung
Der Sturm und Drang testet die Grenzen des aufklärerischen Denkens aus, doch er überschreitet sie nicht. Und auch wenn man dem alten Epochenschema folgen und anerkennen wollte, daß der Sturm und Drang diese Grenzen gesprengt und die Aufklärung hinter sich gelassen hätte, bliebe immer noch zu fragen, wie man wissenschaftlich begründen wollte, daß es sich dabei um ein Verhältnis der „Überwindung“ gehandelt hätte, also um einen Fortschritt, ein Bessermachen, einen Schritt zu mehr Wahrem-Gutem-Schönem. Wie wollte man wohl wissenschaftlich entscheiden, was von beidem als die größere Kinderei zu gelten hätte, das Gezärtel und Getändel der empfindsamen Idylle oder der Kult des Heldischen und der großen Leidenschaft im Sturm und Drang. Wie wollte man entscheiden,
[<< 68]
wo mehr Wahrheit zu finden sei, im skeptischen Pragmatismus der Aufklärung oder in den Totalitätsbegriffen ihrer Gegner? Hier von Verhältnissen der „Überwindung“ zu sprechen, hat wenig mit Wissenschaft, aber viel mit Ideologie zu tun, mit Vorurteilen und unausgewiesenen Wertungen.
Modernisierung und Individualisierung
Damit stellt sich nun die Frage, was dafür verantwortlich sein mag, daß so viele am Ende des 18. Jahrhunderts der Aufklärung und ihrem skeptischen Pragmatismus den Rücken gekehrt haben und zu einer Haltung des Aufs-Ganze-Gehens übergelaufen sind, daß sie das Ausgehen auf Totalitäten nun für „tiefer“ halten wollten als eine Kultur der Selbstkritik und Selbstbescheidung der Vernunft. Da es sich dabei um einen Prozeß handelt, den letztlich nichts von dem hat aufhalten können, was ihm diskursiv an Argumenten entgegengehalten worden ist, sind die Ursachen in fundamentalen Tendenzen der geschichtlichen Entwicklung zu suchen.
Sie liegen wohl vor allem in der fortschreitenden Modernisierung und Individualisierung der Gesellschaft. Das wachsende Bewußtsein, in einem Prozeß der Modernisierung begriffen zu sein, ließ den Wunsch immer dringlicher werden, die Gesellschaft als ganze in den Griff zu bekommen, um den Modernisierungsprozeß rational steuern zu können – Französische Revolution. Und die Individualisierung, die Aufwertung des Persönlichen, Subjektiv-Individuellen brachte sich eben in dem Wunsch des Einzelnen zur Geltung, sich als „ganz und groß“ begreifen zu können. Klassische Formulierungen für diesen Wunsch finden sich in der schon erwähnten Rede Goethes „Zum Shakespeares-Tag“. Da meldet sich ein Ich zu Wort, das von sich sagt: „Ich! Der ich mir alles bin, weil ich alles nur durch mich kenne“ (HA 12, 224), und das auf den Spuren Shakespeares und seiner Dichtung in die Dimension eines genialischen Groß-und-Ganz-Seins hineinwachsen will; alles andere ist ihm zu wenig, empfindet es als kümmerlich und kleinmütig.
Schiller als Kritiker des Aufs-Ganze-Gehens
Zum Schluß dieser Überlegungen zum Umsichgreifen von „Totalitätsobsessionen“ in der „Goethezeit“ nun noch ein Beispiel dafür, wie Goethe und Schiller der Neigung ihrer Zeitgenossen zu Radikalismus und Extremismus entgegengetreten sind, ein Beispiel aus der Feder Schillers, in dem mit dem Geist des Aufs-Ganze-Gehens sowohl in seinen theoretischen als auch in seinen praktischen Ansprüchen abgerechnet wird, ein Gedicht aus dem Jahr 1800.
[<< 69]
Die Worte des Wahns
Drei Worte hört man, bedeutungsschwer,
Im Munde der Guten und Besten.
Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer,
Sie können nicht helfen und trösten.
Verscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht,
Solang er die Schatten zu haschen sucht.
Solang er glaubt an die Goldene Zeit,
Wo das Rechte, das Gute wird siegen, –
Das Rechte, das Gute führt ewig Streit,
Nie wird der Feind ihm erliegen,
Und erstickst du ihn nicht in den Lüften frei,
Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu.
Solang er glaubt, daß das buhlende Glück
Sich dem Edeln vereinigen werde –
Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick,
Nicht dem Guten gehöret die Erde.
Er ist ein Fremdling, er wandert aus
Und suchet ein unvergänglich Haus.
Solang er glaubt, daß dem irdschen Verstand
Die Wahrheit je wird erscheinen,
Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand,
Wir können nur raten und meinen.
Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort,
Doch der freie wandelt im Sturme fort.
Drum, edle Seele, entreiß dich dem Wahn
Und den himmlischen Glauben bewahre!
Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn,
Es ist dennoch, das Schöne, das Wahre!
Es ist nicht draußen, da sucht es der Tor,
Es ist in dir, du bringst es ewig hervor. (SW 1, 215–216)
[<< 70]
Es ist unschwer zu sehen, wie hier der skeptische Pragmatismus der Aufklärung noch einmal gegen den neuen Geist des Aufs-Ganze-Gehens in Stellung gebracht wird, der sich auf je eigene Weise in der Französischen Revolution und der Frühromantik Bahn gebrochen hat.
Der Phantasiebegriff der Frühromantik
Und damit zurück zur Frühromantik und zu ihren Versuchen, der Phantasie in Poetik und Anthropologie eine absolute Geltung zu verschaffen. Es hat sich gezeigt, daß die Frühromantik mit solcher Aufwertung des Subjektiv-Phantastischen und Phantastisch-Subjektiven an die Poetik der Aufklärung anknüpft, wie sie das Stimulieren der Einbildungskraft zur zentralen Aufgabe des Poeten erklärt hat, und daß bei ihr insofern nur die Radikalisierung neu ist, die sie diesem poetologischen Postulat zuteil werden läßt. Es ist ferner deutlich geworden, daß sich die Frühromantik zu solcher Radikalisierung durch das Freiheitspathos der Französischen Revolution animieren läßt. Das darf man wohl als einen Beleg dafür werten, daß die neue Sympathie der Intellektuellen für die Extreme etwas mit der Logik der Modernisierung zu tun hat, ist die Französische Revolution doch das erste historische Großereignis in der Geschichte der Modernisierung, zumindest eine frühe Manifestation von besonderer Massivität und Auffälligkeit.
Die Frühromantik zieht den Freiheitsbegriff der Revolution – um die Hauptpunkte ihres Programms noch einmal zu benennen – in dem Bestreben, ihn noch radikaler, prinzipieller, „tiefer“ zu denken als deren politische Protagonisten, aus dem Politischen ins Ästhetische. Frei sein wollen, so ihre Überlegung, heißt, als Ich, Person, Individuum, Subjekt frei sein wollen. Worin aber bin ich Ich, was bildet das Zentrum dessen, daß ich Person, Individuum, Subjekt bin? Die Phantasie, wie sie dem sinnlich Gegebenen, der Erfahrung, dem Faktischen, der Realität, der Wirklichkeit, den natürlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, in die das Ich eingebunden ist und die es insofern begrenzen, immer schon voraus ist. Deshalb muß die Befreiung des Ichs, des Individuum-Subjekts bei der Befreiung seiner Phantasie ansetzen.
Das eigentliche Werk der Befreiung ist eine „progressive Universalpoesie“, in der die Phantasie aufs Ganze geht, und zwar dadurch aufs Ganze geht, daß sie alles Gegebene, einmal Erkannte, Getane und Gemachte sogleich wieder übersteigt, jeden Halt in der Realität als eine Fessel von sich abstreift und hinter sich läßt. Freiheit wird so aus
[<< 71]
einem politisch-rechtlichen Begriff zu einer Kategorie der Innerlichkeit, denn die Phantasie zu entfesseln ist nun einmal ein innerer Vorgang. Die Außenwelt – die Natur, die Wirklichkeit – behält hier lediglich die Bedeutung eines Sprungbretts für das „Poetisieren“, eines Gegebenen, das sogleich wieder ins Phantastische entgrenzt wird. Genau darin und nur darin, nur in solchem Phantasieren, soll ich wirklich frei sein können.
Deshalb will die Frühromantik auch die Kunst vom Vorbild der Griechen auf das des Mittelalters umdirigieren. Nach ihrer Auffassung klebt die griechische Kunst mit ihrer Natürlichkeit und ihrem Realitätssinn am Sinnlichen, während das Mittelalter die Fesseln der sinnlichen Welt, der Natur, der Wirklichkeit dank seiner Religiosität und seines Wunderglaubens immer schon hinter sich gelassen hat, immer schon übersinnlich, übernatürlich, wunderbar, phantastisch und innerlich ist.
Abrechnung mit der Aufklärung
Mit eben diesen Gesichtspunkten versucht sich die Frühromantik an einer Generalabrechnung mit der Aufklärung. Die Grundforderung der Aufklärung zielt ja eben auf Natur, auf das Natürliche; Dichtung soll für sie vor allem natürlich sein, soll den Menschen auf die natürlichste Weise zur Natur zurückführen und ebensowohl mit seiner Triebnatur wie mit seiner Vernunftnatur bekannt machen. Das ist den Romantikern zu wenig. Nur im Übersteigen der Natur, im Übernatürlichen, Übersinnlichen, in der Hinwendung zum „Wunderbaren“ kann sich die menschliche Phantasie wahrhaft entfalten und damit das Ich „groß und ganz“ werden lassen. Die „Rehabilitation der Sinnlichkeit“, wie sie der gesamten Aufklärung und zuletzt vor allem Wieland ein zentrales Anliegen war, wird von der Romantik als schlüpfrig und frivol denunziert, und Wieland als loser Vogel und erotischer Schmutzfink. An der Lösung von der Sinnlichkeit, am Übersinnlichen, Wunderbaren soll nun alles gelegen sein.
Die Entdeckung des „Wunderbaren“ durch die Poetik der Aufklärung
Freilich, wie den Begriff der Phantasie, der „Einbildungskraft“, so verdankt die Romantik auch den Begriff des „Wunderbaren“ der Aufklärung. Denn schon hier ist er zu einem zentralen Begriff der Poetik geworden.53 Die Romantiker übersehen, daß die von ihnen als
[<< 72]
Spitzenprodukte der menschlichen Phantasie bestaunten Wundergeschichten des Mittelalters – daß edle Ritter mit Drachen, Riesen und Zauberern kämpfen, daß in verfallenen Gemäuern des Nachts Geister ihr Unwesen treiben, daß Heilige mit ihren Glaubenstaten die Naturgesetze außer Kraft setzen – im Verständnis des Mittelalters selbst nicht als Phantasieprodukte gegolten haben, sondern als Geschichten von wahren Begebenheiten. Erst im Horizont der Aufklärung werden sie zu Produkten der menschlichen Phantasie.
Als solche können sie nämlich erst begriffen werden, nachdem sie von der aufklärerischen Frage nach der Natur und den Naturgesetzen aus als Ausgeburten des Aberglaubens entlarvt worden sind. So etwas kann doch nicht wirklich geschehen – so der aufgeklärte Kopf – daß ein Heiliger seinen Pilgerhut an einem Sonnenstrahl aufhängt; es widerspricht den Naturgesetzen. Es kann sich dabei also nur um einen Fall von Aberglauben handeln, um eine vom Menschen erfundene Geschichte, will sagen: um eine Ausgeburt der menschlichen Phantasie. Erst die aufklärerische Kritik am Wunderglauben als Aberglauben macht aus der Wundergeschichte ein Produkt der Phantasie und damit etwas Poetisches; vorher gilt die Wundergeschichte als Sachgeschichte. Erst durch die Aufklärung wird das Wunderbare zu einer Sache der menschlichen Phantasie und damit zu einer Kategorie der Poetik.
Und in diesem Sinne hat die Poetik der Aufklärung seit Bodmer und Breitinger 54 sogar ausdrücklich gefordert, ein Werk der Poesie müsse wunderbar sein, allerdings mit einer Einschränkung, die die Romantiker dann nicht mehr gelten lassen, mit dem Beding, daß es nicht ausschließlich wunderbar, daß es zugleich auch „wahrscheinlich“ sei. Der Begriff des Wunderbaren wird an den des Wahrscheinlichen gekoppelt. Wunderbar soll eine Dichtung sein und allerlei „Neues“, Ungewöhnliches, Überraschendes, Staunenswertes zu bieten haben, damit sie der Leser interessant finden und sich von ihr fesseln lassen kann. Und wahrscheinlich soll sie sein, damit er sich überhaupt etwas vorstellen kann, damit sich seine Einbildungskraft dann auch wirklich in Bewegung setzt. Denn nur von realen Erfahrungen her soll man sich etwas vorstellen können, nur dadurch, daß die Phantasie Erfahrenes aus der
[<< 73]
Erinnerung abruft, um es nach ihren eigenen Bedürfnissen umzugestalten. Wenn eine Geschichte zu unwahrscheinlich, zu hanebüchen werde, dann werde die Einbildungskraft des Lesers überfordert, werde er über sie den Kopf schütteln und das Buch zuschlagen.
Man mag mit diesem Postulat der aufklärerischen Poetik selbst einmal die Probe aufs Exempel machen, indem man sich das Klingsohr-Märchen aus Novalis großem Roman „Heinrich von Ofterdingen“ (1802) zu Gemüte führt (NS 1, 290–315). Kann man sich all das, was da erzählt wird, noch vorstellen, ja will man es sich überhaupt vorstellen? Denn bei diesem Märchen handelt es sich um einen Versuch, die Forderungen der Wahrscheinlichkeit so weit wie möglich außer Kraft zu setzen; was da erzählt wird, soll so unwahrscheinlich sein wie nur irgend möglich, soll die Phantasie aufs äußerste herausfordern. Kann meine Phantasie, will sie dem noch folgen?
Die Lösung des „Wunderbaren“ vom „Wahrscheinlichen“
Was immer bei einer derartigen Lektüre herauskommen mag – jedenfalls hat die Romantik die Koppelung des Wunderbaren an das Wahrscheinliche als poetischen Kleinmut verworfen. Wenn den Leser bei der Lektüre einer Erzählung irgendwann das Gefühl ereilt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn er nicht mehr recht weiß, was Wirklichkeit ist und was Traum, wie ihm das zum Beispiel bei der Lektüre der Werke von Ludwig Tieck und E. T. A. Hoffmann immer wieder widerfahren wird, dann ist er eben dort angekommen, wo ihn der Romantiker hat hinführen wollen. In solchen Momenten soll er spüren, daß es noch mehr gebe als das Wirkliche, Natürliche, Sinnliche, Endliche, daß er innerlich für das Unendliche offen sei. Man mag sich das an Hoffmanns berühmter Erzählung „Der Sandmann“ (1816) vergegenwärtigen, wo dank einer raffinierten Erzählregie immer wieder die Grenzen zwischen der Realität und der Phantasiewelt des Helden Nathanael verschwimmen.
Die Aufklärung wiederum hat ein solches Abheben der Phantasie vom Boden der Natur als „Schwärmerei“ gegeißelt, als eine Art Krankheit, zu der sich ein ungutes Zuviel an Innerlichkeit auswachsen könne, als eine Gefahr für das, was man heute Selbstverwirklichung nennt. Über dem Schwärmen soll dem Ich drohen, sich immer tiefer in sich selbst einzuschließen, um sich am Ende im Labyrinth des eigenen Inneren zu verlieren und brütend in sich selbst zu verglühen. Deshalb gilt es hier als Aufgabe der Poesie und gerade der Poesie als der höchsten
[<< 74]
Form der Phantasietätigkeit, das moderne Ich durch „Schwärmerkuren“ vor dem Absturz nach innen zu bewahren und auf den Boden der Natur zurückzubringen. Ganz anders die Romantik; für sie ist der Mensch nur da ganz Mensch, wo er schwärmt. Wer nicht schwärmen kann, ist für sie nur ein trüber Gast auf Erden, ein „Philister“, ein „Spießer“, und als ein solcher Routinier der Alltäglichkeit mehr ein Tier, mehr eine Maschine, ein „Automat“ als ein Mensch.55
Mit dieser Auffassung von Poesie sind die Romantiker zu Entdeckern im Reich des Unbewußten und der Psyche überhaupt geworden. Kaum ein Autor vor ihnen hat die „Nachtseiten“ der menschlichen Natur schon so intensiv auszuleuchten vermocht wie sie. Wenn man so will, hat die Romantik das Pathologische poetisiert; das ist ihre große Stärke. Ein besonders überzeugendes Beispiel dafür ist E. T. A. Hoffmann. Wie er sich bei der zeitgenössischen Medizin und „Erfahrungsseelenkunde“ über Phänomene der Psychopathologie informiert hat, so sind seine Erzählungen später zu einer Inspiration für den Begründer der modernen Psychologie Sigmund Freud geworden.
Klassik und Romantik
Wie bereits dargelegt, haben die Frühromantiker dieses ihr philosophisch-poetologisches Programm – Entfesselung der Subjektivität, Verabsolutierung der Phantasie, Abkoppelung des Wunderbaren vom Wahrscheinlichen, „Poetisierung“ der Wirklichkeit, „progressive Universalpoesie“ als Weg des Ichs zu sich selbst, Kult der Innerlichkeit – zunächst im Blick auf Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ entwickelt. Aber – und damit soll nun der Gegensatz zwischen Klassik und Romantik näher ins Auge gefaßt werden, wie er gerade im „klassischen Jahrzehnt“ aufbricht 56 – Goethe selbst hat diese Vorstellungen durchaus nicht geteilt.
[<< 75]
Zwar sah sich auch Goethe als ein „Befreier des Individuums“, ja wollte er in seinem Beitrag zur Individualisierung geradezu den Kern seiner literarischen Lebensleistung erkennen (HA 12, 360), doch war und blieb ihm der Kult der Innerlichkeit letztlich ein Greuel. Und das kommt im „Wilhelm Meister“ auch überall mit großer Deutlichkeit zum Ausdruck; man denke nur an das 6. Buch, die „Bekenntnisse einer schönen Seele“, die ganz von der kritischen Distanz zur Feier des „geheimnisvollen Wegs nach innen“ leben. Auch Goethe ging es wesentlich um die Entfaltung von Individualität, Subjektivität und Phantasie, aber er verstand darunter etwas anderes als die Romantiker.
Goethe hat gelegentlich einmal bemerkt, die Maxime „Erkenne dich selbst“, jenes Wort, das als Inschrift am Tempel von Delphi angebracht war und seit den Zeiten der alten Griechen als das große Schibboleth der Theologie und Philosophie allgegenwärtig war, sei ihm „von jeher (…) immer verdächtig (vorgekommen)“ (HA 13, 38). Er empfand es als problematisch, weil es den Menschen dazu verleiten kann, über der Beschäftigung mit sich selbst die Fühlung mit der „Außenwelt“ und mit den anderen Menschen zu verlieren. In und um sich selbst zu kreisen, um seiner ureigensten Phantasie zu leben, macht nach Goethe keineswegs frei, macht vielmehr unfrei, nämlich handlungsunfähig.
Phantasie ist für Goethe – um hier eine Formulierung aufzugreifen, die er im Alter im Gespräch mit Eckermann gebraucht hat – zunächst und vor allem „Phantasie für die Wahrheit des Realen“.57 Die Bedeutung der Phantasie liegt für ihn nicht so sehr darin, daß sie in der Lage ist, die Welt der Erfahrung, die endliche Welt zu überspringen, denn vielmehr darin, daß sie allererst wahrhaft dazu befähigt, Erfahrungen zu machen und in der Welt anzukommen. Denn es bedarf der Phantasie, um die Welt und den Menschen, die Natur und die gesellschaftlichen Realitäten überhaupt erfassen zu können. Eben hierin soll die Literatur nach Goethe die vornehmste Aufgabe der Phantasie erkennen. Das ist nun freilich eine Auffassung, die sich deutlich von der frühromantischen Programmatik des „Poetisierens“ und der „progressiven Universalpoesie“ unterscheidet, nämlich das genaue Gegenteil davon.
[<< 76]
Der menschliche Geist erweist seine Stärke für Goethe nicht darin, daß er in der Lage ist, die Wirklichkeit, die Natur, das sinnlich Gegebene nach Belieben zu überspringen und hinter sich zu lassen. Darin will er eher eine Schwäche erkennen, nämlich das, was die Aufklärer als Gefahr der Schwärmerei verhandeln. Die Stärke des Geistes liegt für Goethe darin, daß er den Menschen in die Lage versetzt, sich der wirklichen Welt, der Natur, dem Leben zu stellen und zu öffnen. Demgemäß heißt es in seinem lyrischen „Vermächtnis“ (1829):
Den Sinnen hast du dann zu trauen,
Kein Falsches lassen sie dich schauen,
Wenn dein Verstand dich wach erhält. (HA 1, 370)
Will sagen: wenn der Verstand dich vor Schwärmerei bewahrt. Goethe hält also bis zuletzt an jener „Rehabilitation der Sinnlichkeit“ (P. Kondylis) fest, um die sich die Aufklärung des 18. Jahrhunderts vor allem bemüht hat. Sich an der Sinnlichkeit vorbei in übersinnliche Dimensionen hineinzuschwärmen, gilt auch Goethe noch als etwas Gefährliches, ja Krankes. Eben hier verläuft die Grenze zwischen Goethe und der Romantik, und damit zugleich die Grenze zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung. Wie für die Aufklärer Wieland und Lessing ist auch für Goethe „die Wahrheit des Realen“, das „offenbare Geheimnis“ der „Natur“ (HA 12, 467) das eigentlich Wunderbare, schön und schauerlich, bedrückend und faszinierend in einem, und so der Gegenstand, an dem sich die dichterische Phantasie vor allem abzuarbeiten hat.
Die „Lehrjahre“ als empfindsamer Roman
In diesem Sinne sind nun auch „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ zu lesen, also keineswegs so, wie ihn die Frühromantik interpretiert hat.58 Es handelt sich bei ihnen um einen Roman in der Tradition des empfindsamen Romans der Aufklärung. Ein zentrales Anliegen der Aufklärung ist, wie bereits mehrfach erwähnt, die Darstellung des empfindsamen Individuums, die darstellende Erkundung einer Individualität, die sich in ihrem Ich-Sein wesentlich über „Sinne“, „Herz“
[<< 77]
und „Einbildungskraft“ definiert. In diesem Sinne bringt der empfindsame Roman seit Samuel Richardson (1689–1761), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) und Laurence Sterne (1713–1768) zugleich das Glück einer individuellen Selbstverwirklichung, die im Ausleben von Sinnlichkeit, Gefühl und Phantasie gründet, und die Gefahren zur Darstellung, die von der „Schwärmerei“ für eine solche Selbstverwirklichung ausgehen, nämlich davon, daß „Herz und Einbildungskraft“ mit einem Individuum durchgehen, so daß es im Gefühlsüberschwang seine Phantasieprodukte mit der Wirklichkeit verwechselt.
Nichts anderes führt Goethe im „Wilhelm Meister“ vor, wie zuvor schon auf andere Weise im „Werther“. Die Figuren der schwärmerischen Innerlichkeit, Mignon, den Harfner, die „schöne Seele“ – und das sind eben die Figuren, die die Frühromantiker vor allem fasziniert haben – läßt Goethe allesamt scheitern; das 6. Buch, die „Bekenntnisse einer schönen Seele“, liest sich fast schon wie eine Parodie auf die „deutsche Innerlichkeit“. Der Held Wilhelm Meister kommt nur davon, weil seine entsprechenden Neigungen von der „Gesellschaft vom Turm“ einer subtilen „Schwärmerkur“ unterzogen werden. Das haben die Frühromantiker zunächst übersehen oder nicht wahrhaben wollen.
Goethe geht also den Weg nicht mit, den die Frühromantiker angesichts der Französischen Revolution und ihrer turbulent-chaotischen Folgen erkunden, den Weg nach innen, und innen nach oben. Statt dessen sucht er sich in Werken wie den „Lehrjahren“ und dem „Faust“ neuerlich der Prinzipien des aufklärerischen Denkens zu vergewissern, trotz oder vielmehr gerade wegen ihrer Desavouierung durch die Revolution, deren Verlauf von ihm zunächst ja als katastrophal erlebt worden ist. Insofern rücken für Goethe Revolution und Romantik eng zusammen; es sind für ihn beides gleichermaßen Formen eines schwärmerischen Aufs-Ganze-Gehens.
Goethe und die Antike
Hier liegen nun auch die Gründe dafür, daß Goethe anders als die Romantiker am Vorbild der Antike festgehalten hat,59 so sauer ihm dies in Zeiten der Revolution zunächst geworden ist. Natürlich hat
[<< 78]
er nicht mehr geglaubt, daß man die Kunst der Antike unter modernen Bedingungen einfach nachahmen und durch bloße Nachahmung wiederaufleben lassen könne; die Zeiten des frühmodernen Humanismus waren auch für ihn vorbei. Aber er war der festen Überzeugung, daß die Beschäftigung mit der Kunst der Griechen, wie er sie durch einen klaren Wirklichkeitssinn, durch Natürlichkeit und durch eine verfeinerte Sinnlichkeit ausgezeichnet sah, für das zu schwärmender Innerlichkeit neigende moderne Individuum eine Art Medizin sein könnte, ein Heilmittel, das es von seiner Neigung kurieren könnte, sich in Subjektivitäten zu ergehen und in sich selbst zu verlieren, das seinen Realitätssinn schärfen könnte. Die Beschäftigung mit der Kunst der Antike ist für Goethe zunächst und vor allem eine „Schwärmerkur“ für das moderne Individuum.
Dabei geht es ihm keineswegs darum, die Individualisierung, den modernen Drang zu individueller „Selbstverwirklichung“ generell zu begrenzen. Im Gegenteil – gerade solche „Selbstverwirklichung“, solche „Bildung“ des Individuums ist ihm von seinen Anfängen bis zu seinen letzten Arbeiten ein zentrales Anliegen gewesen; als ein „Befreier des Individuums“ und nicht als ein Klassiker wollte er den Deutschen in Erinnerung bleiben. Nicht um der Individualisierung und dem Drang zur „Selbstverwirklichung“ einen Riegel vorzuschieben, fordert er die Orientierung an der Kunst der Antike, sondern um sie zu fördern, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß sie in der Tat gelingen könne. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn er nach 1815 in Werken wie der „Italienischen Reise“ (1817) und dem „Zweiten Römischen Aufenthalt“ (1829) oder auch in dem Zeitschriftenprojekt „Über Kunst und Altertum“ (1816–1832) die Antike verstärkt gegen die romantischen Tendenzen der Zeit in Stellung bringt.
Der Bruch zwischen Romantik und Klassik
Das alles haben die Frühromantiker bei der Lektüre des „Wilhelm Meister“ zunächst überlesen, aber schließlich haben sie es doch gemerkt, und die Enttäuschung war groß. Es kam zum Bruch mit den Weimarer Größen, zunächst mit Wieland, dann mit Schiller und schließlich auch mit Goethe. Die Romantiker verließen Jena, verließen den Dunstkreis Goethes. Friedrich Schlegel denunzierte Goethe vor dem mehr und mehr auf nationalromantische Vorstellungen gestimmten Publikum als einen „deutschen Voltaire“ (GU 1, 295), als einen irgendwie doch ein wenig platten und insofern undeutschen Aufklärer, und bald hat
[<< 79]
man sich trotz des einen oder anderen Wiederannäherungsversuchs nur noch bekämpft.
Die Schimäre der „Hochklassik“
Und damit ein letztes Mal zurück zum alten Epochenschema. Es dürfte deutlich geworden sein, daß die Zeit der sogenannten Hochklassik, daß insbesondere jenes „klassische Jahrzehnt“, das der Höhepunkt der Geschichte der deutschen Nationalliteratur gewesen sein soll, zwar eine äußerst bewegte, an literarischen Aktivitäten reiche, produktive Zeit gewesen ist, daß hier aber keineswegs das eingetreten ist, was man als Durchbruch zu einem kraftvollen und durch nichts zu irritierenden Selbstbewußtsein der deutschen Kultur im Zeichen des einen, alle verbindenden deutschen Volksgeists und zu einer Literatur von unüberbietbarer ästhetischer Vollendung hat begreifen wollen. Goethe ist durch die Französische Revolution verunsichert und erprobt die verschiedensten literarischen Modelle, und neben ihm und seinen Weimarer Mitstreitern Wieland, Herder und Schiller wächst die romantische Bewegung heran, die letztlich ganz andere Ziele verfolgt als die Weimarer Klassik. Der Epochenbegriff Hochklassik faßt, insofern er eine einzige durchgreifende Tendenz, einen einheitlichen Geist der Jahre 1794 bis 1805 behauptet, kaum etwas von dem, was die Literatur damals wirklich beschäftigte. Es sind Jahre eines Auseinanderlaufens der Bestrebungen, eines sich immer mehr verschärfenden Konflikts zwischen Klassik und Romantik, zwischen Aufklärern „trotz alledem“ und Gegenaufklärern.
Jenseits der literarischen Fronten
Vollends unhaltbar wird die Vorstellung vom „klassischen Jahrzehnt“, wenn man sich vor Augen führt, daß in diesen Jahren neben den Weimarer Klassikern und den Romantikern eine ganze Reihe von Autoren aktiv waren, die sich weder der einen noch der anderen Seite zuschlagen lassen und die doch das Bild der Epoche wesentlich mit prägen. Zu diesen Einzelgängern jenseits der literarischen Fronten sind vor allem zu zählen: der alte Klopstock, der in der Goethezeit eine letzte produktive Phase durchlebte und nach wie vor sein Publikum hatte, Karl Philipp Moritz, ein Autor, der lange Zeit vergessen war, dessen Werk jedoch in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance erlebte und in der Germanistik besonders große Beachtung fand, Jean Paul, der meistgelesene Autor der Epoche neben Goethe, und schließlich Hölderlin und Kleist, letztere seinerzeit sehr viel weniger erfolgreich als Goethe, Schiller oder Jean Paul, aber gerade aus heutiger Sicht aus
[<< 80]
dem Bild der Epoche nicht wegzudenken; denn von allen Autoren der Goethezeit sind sie von denen, die die Moderne des 20. Jahrhunderts gemacht haben, am meisten geschätzt und am intensivsten studiert worden.
Im folgenden sollen zunächst diese fünf Einzelgänger näher ins Auge gefaßt werden. Denn so läßt sich eine Perspektive auf die Epoche entwickeln, die besonders weit von dem alten Epochenschema wegführt und die insofern in besonderem Maße dabei helfen kann, sich von all dem zu lösen, was es der Auseinandersetzung mit der Literatur der Goethezeit an Hindernissen in den Weg legt.
[<< 81]
2 Reinhold Grimm, Jost Hermand (Hrsg.): Die Klassik-Legende. Frankfurt 1971.
3 Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. München 1989. – Jürgen Fohrmann, Wilhelm Voßkamp (Hrsg.): Wissenschaft und Nation. Studien zur Entstehungsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft. München 1991. – Dies. (Hrsg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart Weimar 1994. – Jost Hermand: Geschichte der Germanistik. Reinbek 1994.
4 Eric J. Hobsbawm: Nationen und Nationalismus seit 1780. Frankfurt 1992.
5 Michel Vovelle: Die Französische Revolution. Soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten. Frankfurt 1985.
6 Hagen Schulze: Der Weg zum Nationalstaat. Die deutsche Nationalbewegung vom 18. Jahrhundert bis zur Reichsgründung. 3. Aufl. München 1992. – Hans Mommsen: Nation und Nationalismus in sozialgeschichtlicher Perspektive. In: Wolfgang Schieder, Volker Sellin (Hrsg.): Sozialgeschichte in Deutschland. Bd. 2. Göttingen 1986, S. 162–184.
7 Michael Zaremba: Johann Gottfried Herder – Prediger der Humanität. Köln 2002. – Jens Heise: Johann Gottfried Herder zur Einführung. 2. Aufl. Hamburg 2006.
8 Michael Zaremba: Johann Gottfried Herders humanitäres Nations- und Volksverständnis. Berlin 1985.
9 Esther-Beate Körber: Görres und die Revolution. Husum 1986. – Armin Schlechter: Die Romantik in Heidelberg. Brentano, Arnim und Görres am Neckar. Heidelberg 2007. – Uwe Daher: Die Staats- und Gesellschaftsauffassung von Joseph Görres im Kontext von Revolution und Restauration. München 2007.
10 Andrea Albrecht: Kosmopolitismus. Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und Publizistik um 1800. Berlin New York 2005.
11 Gottfried Willems: „Ihr habt jetzt eigentlich keine Norm, die müßt ihr euch selbst geben“. Zur Geschichte der Kanonisierung Goethes als „klassischer deutscher Nationalautor“. In: Gerhard Kaiser, Heinrich Macher (Hrsg.): Schönheit, welche nach Wahrheit dürstet. Heidelberg 2003, S. 103–134.
12 Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe. Hrsg. v. Otto Schönberger. Stuttgart 1994, S. 238.
13 Manfred Koch: Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff „Weltliteratur“. Tübingen 2002.
14 Jörg-Jochen Müller (Hrsg.): Germanistik und deutsche Nation 1806–1848. Stuttgart 1974. – Rainer Rosenberg: Zehn Kapitel zur Geschichte der Germanistik: Literaturgeschichtsschreibung. Berlin 1981. – Jürgen Fohrmann: Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart 1989.
15 Rolf-Peter Carl: Prinzipien der Literaturbetrachtung bei Georg Gottfried Gervinus. Bonn 1969.
16 Wolfgang Leppmann: Goethe und die Deutschen. 2. Aufl. Frankfurt 1982. – Goethe im Urteil seiner Kritiker. Hrsg. v. Karl Robert Mandelkow. 4 Bde. München 1975–1984. – Karl Robert Mandelkow: Goethe in Deutschland. 2 Bde. München 1980–1989.
17 Hans Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1: Vom Feudalismus des Alten Reichs bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära. 1700–1815. München 1987. – Lothar Gall: Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. München 1993. – Georg Schmidt: Wandel durch Vernunft. Deutschland 1715–1806. München 2009.
18 Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. Tübingen 1982. – Jost Schneider: Sozialgeschichte des Lesens. Zur historischen Entwicklung und sozialen Differenzierung der literarischen Kommunikation in Deutschland. Berlin New York 2004.
19 Karl Otmar v. Aretin (Hrsg.): Der aufgeklärte Absolutismus. Köln 1974. – Harm Klueting, Helmut Reinalter (Hrsg.): Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich. Wien u. a. 2002.
20 Ernst Schulin: Die Französische Revolution. 4. Aufl. München 2004. – Hans-Ulrich Thamer: Die Französische Revolution. 3. Aufl. München 2009.
21 Theo Stammen, Friedrich Eberle (Hrsg.): Deutschland und die Französische Revolution. Darmstadt 1988.
22 Inge Stephan: Literarischer Jakobinismus in Deutschland. Stuttgart 1976.
23 Carl Schmitt: Politische Romantik. 6. Aufl. Berlin 1998.
24 Hans-Dietrich Dahnke: Französische Revolution. In: Bernd Witte u. a. (Hrsg.): Goethe-Handbuch. 6 Bde. Stuttgart Weimar 2004. Bd. 4/1, S. 313–319.
25 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800–1866. München 1998. – Elisabeth Fehrenbach: Vom Ancien Régime zum Wiener Kongreß. München 2001. – Dieter Langewiesche: Europa zwischen Restauration und Revolution. 1815–1849. München 2007.
26 Walter Jaeschke (Hrsg.): Philosophie und Literatur im Vormärz. 2 Bde. Hamburg 1995. – Martina Lauster u. a. (Hrsg.): Vormärzliteratur in europäischer Perspektive. 3 Bde. Bielefeld 1996–2000.
27 Helmut Koopmann: Das junge Deutschland. Darmstadt 1993.
28 Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. 3 Bde. Stuttgart 1971–1980. – Manfred Engel: Vormärz, Frührealismus, Biedermeierzeit, Restaurationszeit? Komparatistische Konturierungsversuche für eine konturlose Epoche. In: Oxford German Studies 40 (2011), S. 210–220.
29 Lessing: Das Theater des Herrn Diderot. In: ders.: Werke. Hrsg. v. Herbert G. Göpfert. 8 Bde. München 1970–1978. Bd. 4, S. 148–151, hier S. 148.
30 Matthias Luserke: Sturm und Drang. Autoren – Texte – Themen. Stuttgart 1997. – Ulrich Karthaus: Sturm und Drang. Epoche – Werke – Wirkung. 2. Aufl. München 2007.
31 Klaus Peter: Stadien der Aufklärung. Wiesbaden 1980. – Wolfgang Albrecht: Deutsche Spätaufklärung. Halle 1987.
32 Alexander Pope: An Essay on Man. Hrsg. v. Frank Brady. New York London 1965, S. 42.
33 Gerhard Sauder: Empfindsamkeit. Bd. 1. Stuttgart 1974. – Lothar Pikulik: Leistungsethik kontra Gefühlskult. Göttingen 1984. – Frank Baasner: Der Begriff „sensibilité“ im 18. Jahrhundert. Heidelberg 1988. – Nikolaus Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit. Stuttgart 1988.
34 Karl S. Guthke: Englische Vorromantik und deutscher Sturm und Drang. Göttingen 1958. – Paul van Tieghem: Le sentiment de la nature dans le Préromantisme européen. Paris 1960.
35 Herder: Journal meiner Reise im Jahr 1769. In: ders.: Werke. Hrsg. v. Wolfgang Pross. 2 Bde. München Wien 1984–1987. Bd. 1, S. 355–473, hier S. 411.
36 Georg Jäger: Empfindsamkeit und Roman. Stuttgart 1969. – Peter Uwe Hohendahl: Der europäische Roman der Empfindsamkeit. Wiesbaden 1977.
37 Lothar Pikulik: „Bürgerliches Trauerspiel“ und Empfindsamkeit. Köln Graz 1966.
38 Heiko Buhr: „Sprich, soll denn die Natur der Tugend Eintrag tun?“ Studien zum Freitod im 17. und 18. Jahrhundert. Würzburg 1998. – Roger Paulin: Der Fall Wilhelm Jerusalem. Zum Selbstmordproblem zwischen Aufklärung und Empfindsamkeit. Göttingen 1999. – Andreas Bähr: Der Richter im Ich. Die Semantik der Selbsttötung in der Aufklärung. Göttingen 2002.
39 Kirsten Peters: Der Kindsmord als schöne Kunst betrachtet. Eine motivgeschichtliche Untersuchung zur Literatur des 18. Jahrhunderts. Würzburg 2001.
40 Rolf Selbmann: Deutsche Klassik. Epoche – Autoren – Werke. Darmstadt 2005.
41 Terence James Reed: Mehr Licht in Deutschland. Eine kleine Geschichte der Aufklärung. München 2009.
42 So z. B. noch: Wilhelm Voßkamp: Klassik als Epoche. In: Reinhart Herzog, Reinhart Koselleck (Hrsg.): Epochenschwelle und Epochenbewußtsein. München 1987, S. 493–514. – Wilfried Barner: Altertum, Überlieferung, Natur. Über Klassizität und autobiographische Konstruktion in Goethes „Italienischer Reise“. In: Goethe-Jb 105 (1988), S. 64–92. – Conrad Wiedemann: Deutsche Klassik und nationale Identität. In: Wilhelm Voßkamp (Hrsg.): Klassik im Vergleich. Stuttgart Weimar 1992, S. 541–569.
43 Johann Joachim Winckelmann: Gedancken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst. Dresden 1755. ND Baden-Baden Straßburg 1962, S. 19.
44 Gerhard Sauder: Ästhetische Autonomie als Norm der Weimarer Klassik. In: Friedrich Hiller (Hrsg.): Normen und Werte. Heidelberg 1982, S. 130–150.
45 Gerhard Schulz: Romantik. 2. Aufl. München 1996. – Helmut Schanze (Hrsg.): Romantik-Handbuch. 2. Aufl. Stuttgart 2003. – Monika Schmitz-Emans: Einführung in die Literatur der Romantik. 2. Aufl. 2007. – Detlef Kremer: Romantik. 3. Aufl. Stuttgart Weimar 2007. – Helmut Schanze: Literarische Romantik. Stuttgart 2008.
46 Lothar Pikulik: Frühromantik. Epoche – Werke – Wirkung. 2. Aufl. München 2000. – Armand Nivelle: Frühromantische Dichtungstheorie. Berlin 1970. – Manfred Frank: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt 1989.
47 Friedrich Schlegel: Fragmente. In: ders., August Wilhelm Schlegel (Hrsg.): Athenaeum. Eine Zeitschrift. 3 Bde. 1798–1800. ND Darmstadt 1973. Bd. 1, S. 179–322, hier S. 232.
48 Ebenda, S. 204–206.
49 Hans Peter Herrmann: Naturnachahmung und Einbildungskraft. Zur Entwicklung der deutschen Poetik von 1670–1740. Bad Homburg 1970.
50 Orrin F. Summerell: Totalität. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. v. Joachim Ritter u. a. Bd. 10. Basel 1998, Sp. 1303–1307.
51 Pope: Essay on Man (Anm. 32), S. 5.
52 Wieland: Was ist Wahrheit? In: ders.: Sämmtliche Werke. 39 Bde. u. 5 Supplementbände in 14 Bänden. ND Hamburg 1984. Bd. VIII/24, S. 39–54, hier S. 50. – Vgl. Gottfried Willems: Von der ewigen Wahrheit zum ewigen Frieden. In: Wieland-Studien 3 (1996), S. 10–46.
53 Karl-Heinz Stahl: Das Wunderbare als Problem und Gegenstand der deutschen Poetik des 17. und 18. Jahrhunderts. Frankfurt 1975.
54 Wolfgang Bender: J. J. Bodmer und J. J. Breitinger. Stuttgart 1973.
55 Manfred Engel: Die Rehabilitation des Schwärmers. Theorie und Darstellung des Schwärmens in Spätaufklärung und früher Goethezeit. In: Hans-Jürgen Schings (Hrsg.): Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1994, S. 469–498. – Ders.: Das „Wahre“, das „Gute“ und die „Zauberlaterne der begeisterten Phantasie“. Legitimationsprobleme der Vernunft in der spätaufklärerischen Schwärmerdebatte. In: GLL 62 (2009), 53–66.
56 Albert Meier: Klassik – Romantik. Stuttgart 2008.
57 Eckermann: Gespräche mit Goethe (Anm. 12), S. 174.
58 Klaus F. Gille: Goethes Wilhelm Meister. Zur Rezeptionsgeschichte der Lehr- und Wanderjahre. Königstein 1979.
59 Goethe und die Antike. Eine Sammlung. Hrsg. v. Ernst Grumach. 2 Bde. Berlin 1949. – Willems: Kanonisierung Goethes (Anm. 11), S. 126–129.