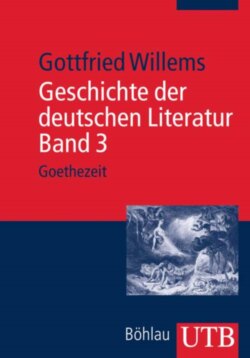Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 3 - Gottfried Willems - Страница 13
2.4.1 Sturm und Drang und Aufklärung
ОглавлениеSpätaufklärung
Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Vorstellung vom Sturm und Drang 30 als einer besonderen Epoche, als der Epoche, in der die Aufklärung ein- für allemal „überwunden“ und durch etwas typisch Deutsches abgelöst worden sei. Als die große Zeit des Sturm und Drang werden vor allem die Jahre 1770 bis 1775 genannt. Nun sind aber viele Hauptwerke der Aufklärung erst später entstanden, Lessings berühmtestes Schauspiel „Nathan der Weise“ zum Beispiel erst 1781. Auch die meisten Arbeiten des Aufklärers Wieland, der zu seiner Zeit einer der meistgelesenen zeitgenössischen Autoren in Deutschland war, sind erst nach 1770 geschrieben worden. Die siebziger, achtziger Jahre sind eigentlich die Jahre der großen Wirkung von Wieland und Lessing, und mit dieser verglichen war und blieb die Resonanz
[<< 45]
dessen, was die Stürmer und Dränger – der Straßburger Kreis um Herder, der „Göttinger Hain“ – schufen, deutlich begrenzt, mit den beiden Ausnahmen von Goethes „Götz“ und „Werther“. Um dem Rechnung zu tragen, ist inzwischen für die siebziger und achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts der Begriff der Spätaufklärung 31 eingeführt worden. Von ihm aus erscheint der Sturm und Drang als eine literarische Bewegung, der es keineswegs gelungen ist, einer ganzen Epoche ihren Stempel aufzudrücken; den Grundcharakter der Epoche hat weiterhin die Aufklärung bestimmt.
Empfindsamkeit
Im übrigen ist zu fragen, inwieweit der Sturm und Drang überhaupt im Gegensatz zur Aufklärung des 18. Jahrhunderts steht, ob in ihm nicht bloß eine Sonderentwicklung, eine Unterströmung der Aufklärung zu sehen ist. Der Schlachtruf des Sturm und Drang, wie er etwa in der Rede Goethes zum Shakespeare-Tag niedergelegt ist, der Ruf nach Natur (HA 12, 226), war ja die Losung der gesamten Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Aufgeklärt zu sein, hieß hier vor allem, „vivere secundum naturam“, hieß „take Nature’s path, and mad Opinion’s leave“ (Alexander Pope);32 es hieß, auf die Natur zu setzen, insbesondere auf das, was am Menschen Natur ist und wodurch er Teil der Natur ist, auf seine Triebnatur, seine Instinkte, seine Sinne, sein Herz und seine Einbildungskraft. Der Mensch sollte nicht mehr in einen vernünftigen und einen triebhaften, einen rationalen und einen sinnlich-emotionalen Teil aufgeteilt werden, wie das der frühmoderne Humanismus im Zeichen des christlichen Menschenbilds und des Neustoizismus getan hatte, sondern es sollte deren ständigem Ineinandergreifen nachgegangen, sollte auf das Vernünftige an Sinnlichkeit und Gefühl und auf die Offenheit der Vernunft für das Natürliche gesetzt werden. Man nennt diese grundlegenden Tendenzen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts auch Sensualismus und Sentimentalismus.
Als der Literaturgeschichtsschreibung die Bedeutung von Sensualismus und Sentimentalismus für die Literatur der Aufklärung endlich
[<< 46]
aufgegangen war, hat sie dem zunächst dadurch Rechnung zu tragen versucht, daß sie diese in eine rationalistische und eine sensualistisch-sentimentalistische Richtung aufteilte und für letztere den Begriff der Empfindsamkeit einführte.33 Aber auch das war noch immer schief, denn die gesamte Literatur der Aufklärung ist durch sensualistische und sentimentalistische Impulse geprägt, ja gewinnt allein von ihnen her ihre epochale Eigenart. Immerhin konnte der Sturm und Drang so der Aufklärung zugeordnet werden, ließ er sich nun doch als eine Bewegung begreifen, die aus der Empfindsamkeit, aus dem aufklärerischen Sensualismus und Sentimentalismus hervorgegangen war. Es zeigte sich, daß er sein spezifisches Profil eben dadurch gewann, daß er diesen Sensualismus und Sentimentalismus auf die Spitze trieb, daß er ihnen durch die bevorzugte Darstellung großer Gefühle, großer Leidenschaften, durch die Formulierung eines Absolutheitsanspruchs des Gefühls und besonders enthusiastische Formen des Redens eine radikale Wendung gab. Damit wurde der Weg von den früheren Formen der Aufklärung zum Sturm und Drang aber aus einem quasi revolutionären Umsturz zu einem fließenden Übergang.
Irrationalismus vs. Rationalismus?
Die alte Vorstellung von der „Überwindung“ der Aufklärung durch den Sturm und Drang beruhte ja auf der Opposition Rationalismus – Irrationalismus. Der Sturm und Drang sollte eine erste Stufe auf dem Weg zur Epiphanie des deutschen Wesens darstellen, insofern er den angeblichen Rationalismus der Aufklärung als etwas Undeutsches überwunden und mit der Exponierung großer, leidenschaftlicher Gefühle den deutschen Sinn für das Irrationale, für die Tiefe, den Tiefsinn freigesetzt hätte. Aber die gesamte Aufklärung des 18. Jahrhunderts lebte von der Kritik des Rationalismus, wie er ihr durch die christliche Theologie scholastischer Prägung und den frühneuzeitlichen Humanismus, insbesondere durch dessen Neustoizismus, überliefert war; sie hat sich unausgesetzt an einer „Kritik der Vernunft“ (Kant) abgearbeitet und um die Darstellung des Menschen als empfindsames
[<< 47]
Individuum bemüht. Hat man sich dies erst einmal klargemacht – die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat keineswegs einem wie auch immer zu definierenden Rationalismus gehuldigt, ihr Schlachtruf war „Natur!“, ihr ging es um den Menschen als ganzen, insbesondere um seine sinnlich-empfindsame Seite – dann wird es vollends unmöglich, den Sturm und Drang als eine Gegenbewegung zur Aufklärung zu begreifen.
Präromantik
Ein weiteres Moment kommt hinzu. Die ältere Literaturgeschichtsschreibung wollte eine besonders gewichtige Neuerung des Sturm und Drangs darin erblicken, daß die Literatur von der neuen Begeisterung für die Natur her erstmals ein Interesse an ursprünglich-natürlichen Formen von Kultur entwickelt habe, insbesondere am Altertum der nordeuropäischen Völker, ein Interesse, das hier nun an die Stelle der humanistischen Orientierung am Altertum des Südens, an der griechisch-römischen Antike getreten sei. Überhaupt sei der Literatur hier in der Gestalt Herders erstmals der Sinn für Geschichte, für das Volksleben der nordischen Nationen und für ihre besonderen Überlieferungen aufgegangen, habe sie hier erstmals die poetischen Qualitäten des Volkslieds, der Volksballade und der Volkssage für sich entdeckt.
Aber das Interesse am Altertum des Nordens ist älter als der deutsche Sturm und Drang; es hat die Aufklärung im Grunde durch ihre gesamte Geschichte begleitet. Markante Beispiele dafür finden sich vor allem in England, sehr früh schon bei den englischen Aufklärern John Dryden (1631–1700) und Alexander Pope (1688–1744), und dann vor allem in den sechziger Jahren bei Männern wie Thomas Percy (1729–1811), der „Reliques of Ancient English Poetry“ (1765) sammelte, und James Macpherson (1736–1796), der in „The Works of Ossian“ (1765) altschottische Sagen bearbeitete. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Präromantik“,34 weil sich hier schon die Interessen bemerklich machen, die später vor allem von der Romantik gepflegt worden sind. Wer über den Tellerrand der deutschen Literaturgeschichte hinausblickt, der weiß, daß sich das präromantische Interesse an Geschichte, nordischem Altertum und
[<< 48]
nordischem Volksleben nicht im deutschen Sturm und Drang, sondern in der englisch-schottischen Aufklärung Bahn gebrochen hat.
Montesquieu und Rousseau
Und nicht nur in der englischen Aufklärung, auch in der französischen fand der deutsche Sturm und Drang entscheidende Anknüpfungspunkte. So hat Herder das Programm, mit dem er zu einem der großen Mentoren des Sturm und Drang werden sollte, zu einem frühen Zeitpunkt, im „Journal meiner Reise im Jahr 1769“, einmal in die Formel gefaßt: „mit dem Geist eines Montesquieu sehen, mit der feurigen Feder Rousseaus schreiben“.35 Er wußte noch sehr genau, daß er mit seinem neuen Sinn für die Geschichte, die Vielfalt der Kulturen und der Formen des Volkslebens einen Weg beschritt, der von Montesquieu gebahnt worden war, und daß entscheidende Impulse für die „neue Beredsamkeit der Leidenschaften“ (Goethe) von Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) ausgegangen waren, daß der Sturm und Drang hierin also den neuesten Entwicklungen der französischen Literatur verpflichtet war. Übrigens wurde auch Diderot, der schon für Lessing so große Bedeutung hatte, nach Goethes Zeugnis im Straßburger Kreis um Herder eifrig studiert (HA 9, 487).
Goethes „Werther“ ein Roman der Empfindsamkeit
Der Sturm und Drang war eine literarische Bewegung, die keineswegs einer ganzen Epoche ihren Stempel hat aufdrücken können, wie von der nationalistischen Literaturgeschichtsschreibung behauptet, deren Spuren sich vielmehr bald in anderen Entwicklungen verloren, während die aufklärerisch-empfindsamen Impulse, auf denen sie beruhte, weiterwirkten, ja ihre Potentiale erst in der Zeit von Klassik und Romantik voll entfalteten. Goethe ließ auf seinen Sturm-und-Drang-„Götz“ von 1773 gleich im nächsten Jahr 1774 den „Werther“ folgen, und das ist eben ein empfindsamer Roman, der wie alle Werke der Empfindsamkeit ein empfindsames Individuum auf der Suche nach dem Natürlichen zeigt und ebensowohl vom Glück des Gefühlslebens wie von den Problemen des Gefühlsüberschwangs, den Gefahren der „Schwärmerei“ handelt. Das vermag man unschwer zu erkennen, wenn man den „Werther“ mit seinen Vorbildern und Anregern aus dem Raum der englischen und der französischen Empfindsamkeit
[<< 49]
vergleicht, mit den Romanen von Samuel Richardson (1689–1761) und Rousseau,36 oder auch mit dem Bürgerlichen Trauerspiel als einer besonders markanten Gattung der empfindsamen Literatur.37 Dem Sturm und Drang mag am „Werther“ allenfalls noch die Art und Weise zuzurechnen sein, wie der Anspruch des Gefühls in ihm auf die Spitze getrieben wird und in eine zerstörerische Leidenschaft umschlägt; Werther endet ja im Selbstmord.
Die Themen Selbstmord und Kindsmord
Doch selbst die literarische Behandlung des Themas Selbstmord im „Werther“ gehört ganz der Aufklärung an. Sie verweist auf eine Diskussion zurück, die sich durch das gesamte 18. Jahrhundert verfolgen läßt. Die Aufklärer wollten im Selbstmord nicht mehr nur eine Todsünde erblicken, wie es der christlichen Tradition entsprach, sondern auch den Ausdruck einer seelischen Notlage, deren „natürliche Ursachen“ sich ergründen ließen, bei dem es also auf ein Verständnis ankäme, das mit Mitteln der Psychologie und Soziologie der Lage und den Motiven des Selbstmörders nachginge.38 Ähnliches gilt übrigens von einem zweiten Lieblingsthema des Sturm und Drang, das noch in Goethes „Faust“, in der sogenannten „Gretchentragödie“ eine wesentliche Rolle spielt, dem Thema des Kindsmords, der Tötung eines unehelich geborenen Kinds durch seine Mutter. Auch hier will sich der Aufklärer nicht mit einem metaphysischen Verdammungsurteil begnügen, wie es der Tradition des Christentums entspricht, will er versuchen, die Lage und die Motive der Kindsmörderin von ihren „natürlichen Ursachen“ her psychologisch und soziologisch aufzuhellen.39
[<< 50]
Vom Sturm und Drang zur „Weimarer Frühklassik“
Was nun die sogenannte Weimarer Frühklassik 40 der Jahre 1775 bis 1786 bzw. 1794 anbelangt, so läßt sie sich ohne wesentliche Einbußen unter die Begriffe der Aufklärung und der Empfindsamkeit abbuchen. Daß einige aus der kleinen Gruppe von Literaten, die die Bewegung des Sturm und Drang bildeten, nun die gesamte Palette aufgeklärt-empfindsamer Themen und Formen für sich entdeckten, wie sie von der Literatur um sie herum kultiviert worden war, kann wohl kaum dazu herhalten, eine neue Epoche auszurufen. Die Kulturpolitik des Weimarer Hofs um die Herzoginmutter Anna Amalia und den Herzog Carl August, die Schaffung eines „Musenhofs“ durch die Berufung großer Geister wie Wieland, Goethe und Herder war ja ein typisches Projekt aufgeklärter Fürstenpolitik. Goethe und Herder arbeiteten, nachdem sie in Weimar angekommen waren, sofort eng mit Wieland zusammen, unbeschadet der Kontroversen und Irritationen, die zuvor ihr Verhältnis zu Wieland bestimmten; es stellte sich heraus, daß es zwischen ihnen keinen grundsätzlichen Dissens gab. Und wenn man ein Hauptwerk der „Weimarer Frühklassik“ wie Goethes „Iphigenie auf Tauris“ (1787), eine Arbeit, die Wieland intensiv begleitet und begeistert begrüßt hat, oder Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (1784–1791) und „Briefe zur Beförderung der Humanität“ (1793–1797) zur Hand nimmt, wird man unschwer feststellen, daß in Weimar damals nichts anderes als die Sache der Aufklärung und der Empfindsamkeit verhandelt wird.41