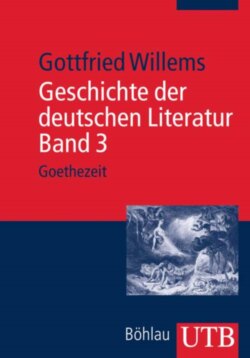Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 3 - Gottfried Willems - Страница 9
2.1 Germanistik und Klassik-Mythos
ОглавлениеDie Geburt der Neugermanistik aus dem Klassik-Mythos
Wer immer einen Weg zur Literatur der Goethezeit sucht, ist mit ihrem Klassik-Nimbus konfrontiert und tut gut daran, sich darauf einzustellen, ganz besonders aber der Germanist und Literaturwissenschaftler. Für ihn geht es dabei nicht nur um einen angemessenen Zugang zu den Werken einer bestimmten Epoche, sondern darüber hinaus geradezu um sein Fach als ganzes, um das Selbstverständnis des Fachs. Denn die Neugermanistik, die Wissenschaft von der Neueren Deutschen Literatur, ist als eine eigene, besondere Disziplin der akademischen Wissenschaft unmittelbar aus dem Klassik-Mythos hervorgegangen. Der Klassik-Mythos war ihr Schöpfungsbefehl, bezeichnet „das Gesetz, nach dem sie angetreten“, und das hat bis heute Folgen für ihre Arbeit.
Nun ist zwar auch die Kritik an der „Klassik-Legende“ schon über hundert Jahre alt, und sie hat sich seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts geradezu einen festen Platz im geistigen Haushalt der
[<< 19]
Germanistik erobert.2 Doch lassen sich die Spuren des Klassik-Mythos bis heute unschwer in allen Arbeitsbereichen des Fachs nachweisen, selbst in Untersuchungen zu anderen Epochen, zu älteren Epochen wie Barock und Aufklärung ebensowohl wie zu jüngeren, zum Realismus des 19. Jahrhunderts oder zur Moderne des 20. Jahrhunderts. Denn diese anderen Epochen sind von der Germanistik zunächst nur als Stationen auf dem Weg zum Höhe- und Gipfelpunkt der Klassik bzw. auf dem Weg von ihm weg begriffen worden, und das heißt: sie sind lange Zeit an den Vorstellungen der Klassik gemessen worden, oder vielmehr an den Vorstellungen, die man sich von ihr gemacht hat, etwa an den Begriffen von Autorschaft und vom literarischen Kunstwerk, die man ihr zuschrieb. An den Folgen hat die Germanistik bis heute zu tragen.
Die Neugermanistik ist als eine eigene, besondere Disziplin im 19. Jahrhundert aus dem Glauben, aus der allgemein unter den Deutschen verbreiteten und von den gesellschaftlichen Institutionen geförderten Überzeugung geboren, daß die Literatur der Jahre 1770 bis 1830 der unübertreffliche Höhepunkt der deutschen Literaturgeschichte gewesen sei, und insofern der kostbarste Schatz in der kulturellen Überlieferung der Deutschen; daß da etwas Gestalt angenommen habe, was für alle Deutschen, für jeden Einzelnen wie für die ganze Nation, von bleibender Bedeutung sei und daß es deshalb der jeweiligen Gegenwart immer wieder neu zu erschließen und darzustellen sei, im Namen der Identität der Deutschen und ihrer kulturellen Eigenart. Die „deutsche Literaturbewegung von Lessing bis Goethe“ sollte den Deutschen über allen Wechsel der Zeiten hinweg nahegebracht werden. Das war die gesellschaftliche Mission, die die Neugermanistik als Wissenschaft im 19. Jahrhundert ins Leben rief.3
[<< 20]
Literaturgeschichte im Dienst des Nationalismus
Genauer betrachtet, ist diese Neugermanistik in zwei Schritten entstanden. Ein erster Schritt wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts getan, wo die ersten großen „Geschichten der deutschen Nationalliteratur“ entstanden. Die bekannteste und einflußreichste von ihnen stammt aus der Feder von Georg Gottfried Gervinus und ist in 5 Bänden von 1835 bis 1842 erschienen. Literaturgeschichtliche Arbeiten hat es natürlich auch vor dem 19. Jahrhundert schon gegeben, aber keine, die sich ausschließlich der Darstellung der deutschen Literatur widmeten, die ausschließlich Geschichte einer deutschen „Nationalliteratur“ sein wollten. Derlei hat vorher schon allein deshalb nicht interessieren können, weil die Literatur der Antike, die Werke der alten Griechen und Römer, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als eine unentbehrliche Grundlage des literarischen Lebens galten. Über sie wollte man zunächst und vor allem informiert sein, wenn man sich mit Literatur befaßte.
Außerdem empfanden sich die Literaten und die meisten von denen, die sich mit Literatur beschäftigten, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, bis hin zu Goethe und seinem Kreis, als Kosmopoliten, als „Weltbürger“, also als Menschen, denen die deutsche Literatur nicht unbedingt näher und wichtiger wäre als die große Literatur der alten Griechen und Römer und der modernen Italiener, Engländer, Franzosen und Spanier, als Homer und Vergil, Dante und Petrarca, Shakespeare, Cervantes und Rousseau. Dieses literarische Weltbürgertum war hinterfangen von der aufklärerischen Vorstellung vom „Allgemein-Menschlichen“, von dem Glauben an die natürliche Gleichheit aller Menschen. In der Literatur wollte der literarische Weltbürger vor allem dem Allgemein-Menschlichen begegnen.
Das hat sich gerade in der Zeit zwischen 1770 und 1830 geändert. Die aufklärerische Vorstellung vom Allgemein-Menschlichen, von der allgemeinen Menschennatur wurde hier mehr und mehr vom Nationalismus, vom Gedanken der Nation als Dominante des kulturellen Lebens überlagert, wenn nicht vollends beiseite gedrängt. Man verstand sich nun nicht mehr in erster Linie als aufgeklärter Weltbürger, sondern als guter Deutscher, so wie jenseits der Grenzen als guter Franzose, als guter Engländer.
Moderner Nationalismus und Französische Revolution
Der moderne Nationalismus, wie er unter anderem das Konzept der Nationalliteratur hervorbrachte, erlebte seinen Durchbruch in
[<< 21]
der Französischen Revolution.4 Die Revolutionäre waren ja nicht nur Sozialrevolutionäre, sondern auch glühende Nationalisten; das wird gerne vergessen. Von der Französischen Revolution und ihren Folgen wird hier immer wieder zu handeln sein. Sie bezeichnet das wichtigste geschichtliche Ereignis der Epoche. Sie hat die Menschen und insbesondere die Literaten unausgesetzt beschäftigt, von ihren Anfängen 1788/89 über die „Terreur“, die Schreckensherrschaft der Jahre 1793/94, die Herrschaft Napoleons, die Napoleonischen Kriege und die Besetzung weiter Teile Deutschlands durch die Franzosen nach der Schlacht von Jena und Auerstedt (1806) bis hin zu den sogenannten Befreiungskriegen von 1812/13 und zum Wiener Kongreß von 1814/15, mitsamt all den sozialen Umbrüchen und politischen und weltanschaulichen Debatten, die mit ihr einhergingen. Eine der Folgen der Französischen Revolution war nun eben der Durchbruch des modernen Nationalismus.
Die Revolution als Krise der Modernisierung
Schon darin wird greifbar, daß die Französische Revolution nicht nur ein politisches Ereignis ersten Ranges war, sondern auch eine Kulturrevolution, eine Umwälzung des kulturellen Lebens von kaum zu überschätzender Bedeutung.5 Sie machte mit ihren politischen und sozialen Aktivitäten noch der letzten Schlafmütze in Europa auf die drastischste Weise klar, daß Europa in eine Dynamik der Modernisierung eingetreten war. So wurde sie zum Anlaß, erneut und intensiver als je zuvor über die Eigenart, die Ursachen und die Folgen solcher Modernisierung nachzudenken.
Was aber heißt Modernisierung? Es heißt zunächst und vor allem: Umgestaltung der Lebensverhältnisse auf der Basis des Fortschritts der Wissenschaften, Verwissenschaftlichung der Welt im Namen des gesellschaftlichen Fortschritts. Und das wiederum bedeutet, daß die überkommenen Lebensverhältnisse, an die die Menschen gewöhnt sind, nicht einfach fortgeschrieben werden; daß sich viele der überkommenen, traditionellen Bindungen lockern, in die sich die Menschen bis dato hineingestellt wußten, Bindungen, die einerseits zwar
[<< 22]
ihre Bewegungsfreiheit begrenzen, die ihnen andererseits aber auch Sicherheit und Orientierung geben, Bindungen wie die an einen Stand, einen Beruf, eine Region oder eine Kirche. Die Menschen werden mehr und mehr in eine umfassende soziale Mobilität hineingerissen, sie steigen auf und ab auf der sozialen Leiter, sie wechseln oder verlieren ihre Konfession und Religion, wechseln ihre „Weltanschauung“, sie verlassen ihre Heimat, ihre Familie und ihren Beruf und ziehen dahin oder dorthin.
Zu dieser Modernisierung des Lebens und Mobilisierung der Menschen gehört wesentlich mit dazu, was die Soziologie als Pluralismus und Individualismus beschreibt. Pluralismus meint, daß Menschen unterschiedlicher Religion, Konfession oder Weltanschauung und unterschiedlicher Herkunft, Menschen, die die verschiedensten Lebensstile praktizieren und die unterschiedlichsten Lebensziele verfolgen, in ein und derselben Gesellschaft nebeneinander leben und zusehen müssen, daß sie so, wie sie die Dynamik der Modernisierung durcheinandergewirbelt hat, miteinander auskommen können. Und Individualismus bedeutet, daß sich in dieser Dynamik der Modernisierung und Pluralisierung der Lebensformen für jeden Einzelnen die Möglichkeit eröffnet, einen eigenen Weg zu gehen, sich eigene Ziele zu setzen und sich seiner besonderen Individualität gemäß an einer „Selbstverwirklichung“ zu versuchen.
Das alles ist natürlich im 18. Jahrhundert schon längst im Gange, vorangetrieben vor allem von der Bewegung der Aufklärung, aber es gewinnt im Zeitalter der Französischen Revolution doch eine neue Qualität, insofern die Gesellschaft hier in einem zuvor noch nie dagewesenen Maße in Bewegung gerät: Könige, Adlige und Kirchenfürsten verlieren ihren Kopf und ihr Vermögen, einfache Soldaten steigen in den Adel, ja bis zum Kaisertum auf, und mancherorts wird sogar die christliche Religion von Staats wegen abgeschafft.
Modernisierung und Nationalismus
Eben hier liegen nun auch die Quellen des modernen Nationalismus, wie er sich seinerzeit überall in Europa Bahn brach. Mit seiner Hilfe sollte irgendwie Ordnung in die Dynamik der Modernisierung gebracht werden, sollte die neue Mobilität gebändigt, sollten der neue Pluralismus und Individualismus begrenzt und die Kräfte der Bindung des Einzelnen an das Gemeinwesen gestärkt werden. Während des gesamten 19. Jahrhunderts haben sich die europäischen Gesellschaften
[<< 23]
darin geübt, die immer neuen Modernisierungsschübe und Modernisierungskrisen mit Hilfe des Nationalismus zu bestehen.6 Und so ist es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein geblieben, und ist es in manchen Weltgegenden heute noch immer. Selbst in Deutschland sammeln sich die Modernisierungsverlierer, diejenigen, die der Dynamik der Modernisierung nicht gewachsen sind, zum Teil noch immer unter der Fahne des Nationalismus und suchen die Mobilität der Moderne, ihren Pluralismus und Individualismus zu begrenzen, indem sie rufen: Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!
Ideengeschichtliche Voraussetzungen des modernen Nationalismus
Das alles hat im Zeitalter der Französischen Revolution begonnen. Die theoretischen Grundlagen dafür, daß der nationale Gedanke nun zu einer Dominante der Kultur wurde, sind freilich bereits im 18. Jahrhundert geschaffen worden. Hier ist vor allem an den Begriff des „Volksgeists“ zu denken, wie er von dem französischen Schriftsteller Montesquieu (1689–1755) in seiner Abhandlung über den „Geist der Gesetze“ („De l’esprit des lois“) von 1748 entwickelt worden ist. Montesquieu erklärt die Tatsache, daß die Staaten der verschiedenen Nationen – der Griechen, Römer, Italiener, Spanier, Franzosen, Engländer, Deutschen – verschiedene Verfassungen, verschiedene „Gesetze“ haben, mit einem je anders gerichteten „esprit de la nation“; dieser soll für die Unterschiede verantwortlich sein, die der Kultur der verschiedenen Nationen ihre besondere Gestalt verleihen, und damit wie ihren Staaten, ihren Verfassungen, ihren „Gesetzen“, so auch ihrer Kunst und Literatur.
In Deutschland hat sich vor allem Johann Gottfried Herder (1744 – 1803)7 für den Begriff des „Volksgeists“ stark gemacht – ein Autor, der sich selbst als Schüler von Montesquieu sah und ein „zweiter Montesquieu“ werden wollte – und er hat ihn mit besonderem Nachdruck in
[<< 24]
Fragen der Kunst und Literatur zur Geltung gebracht. Das literarische Kunstwerk ist für ihn wie jedes Artefakt zugleich ein Zeugnis der „allgemeinen Menschennatur“, ein Ausdruck des besonderen, individuellen „Genies“ seines Autors und die Manifestation eines bestimmten „Volksgeists“. Der „Volksgeist“ soll als Quelle des „Charakteristischen“ die Ebene bezeichnen, die zwischen der allgemeinen Menschennatur in ihrer unspezifischen Abstraktheit und der je besonderen Individualität des Autors vermittelt.
In diesem Zusammenhang hat eine Sammlung „fliegender Blätter“ Berühmtheit erlangt, die Herder 1773 herausgab und an der auch der junge Goethe mitwirkte, eines der wichtigsten Dokumente des Sturm und Drang, das den Titel trägt „Von deutscher Art und Kunst“. Der Titel spricht für sich: was die Deutschen an Kunst hervorbringen, soll nun wesentlich als Ausdruck deutscher Wesensart begriffen werden. Übrigens kann man schon dieser Schrift ansehen, daß der Begriff des deutschen Wesens eine Konstruktion war, die nicht ohne Gewaltsamkeiten und Schiefheiten zustande zu bringen war. Die wichtigsten Beiträge des Sammelbands stammen vom jungen Goethe und sind Shakespeare und dem Straßburger Münster gewidmet. Shakespeare ist aber durchaus kein Beispiel für deutsche, sondern allenfalls für englische Art und Kunst, und die Gotik, die Goethe am Straßburger Münster bewundert, stammt aus Frankreich und nicht aus Deutschland; sie war zunächst die Kirchenbaukunst der französischen Könige. Beides, Shakespeare und die Gotik, wird hier aber für eine spezifisch deutsche Kultur reklamiert – was da als „deutsche Art und Kunst“ behauptet wird, ist offensichtlich von Anfang an krumm und schief.
Bei Herder ist der „Volksgeist“ zunächst nur ein Faktor der kulturellen Produktion unter anderen; die allgemeine Menschennatur und die Individualität, das „Genie“ des Autors bedeuten ihm mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr als der „Volksgeist“.8 Das ändert sich dann aber bei seinen Nachfolgern, und es ändert sich gerade in der Zeit der Französischen Revolution, in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Hier sind vor allem die Romantiker zu
[<< 25]
nennen, wie sie ihre Arbeit wesentlich als eine deutsche Antwort auf die Französische Revolution verstanden. Bei ihnen wird die Ebene des „Volksgeists“ nach und nach wichtiger als alles andere, wichtiger als die Ebenen der „allgemeinen Menschennatur“ und des individuellen „Genies“ eines Autors.
Dabei wird der Autor zu einer Art Medium des „Volksgeists“. Was ein Goethe schreibt und die Art, wie er schreibt, sollen nun wesentlich als Ausdruck des deutschen „Volksgeists“ und der deutschen „Volksseele“, als Manifestation des „deutschen Wesens“ verstanden werden. Von „Volksseele“ spricht zum Beispiel einer der Propagandisten des deutschen Nationalismus und Mentoren der Hochromantik, der entlaufene Revolutionär Joseph Görres (1776–1848).9 In der Hochromantik entsteht die Vorstellung, daß Goethe ein Werk wie den „Faust“ nur geschrieben habe und nur habe schreiben können, weil er Deutscher war und weil der deutsche Mensch nun einmal von „faustischer“ Natur sei, irgendwie immer schon ein „faustisches“ Streben im Leib habe, so daß sich dieses „Faustische“ wie von selbst in seinem Werk habe manifestieren und wiederfinden müssen.
Weltliteratur vs. Nationalliteratur
Goethe selbst war keineswegs davon angetan, auf solche Weise für den neuen deutschen Nationalismus in Anspruch genommen zu werden. Er war und blieb ein Aufklärer, und das heißt, daß er sich zunächst und vor allem als Kosmopolit, als literarischer Weltbürger verstand.10 Erst einige Autoren der nächsten Generation, erst Männer wie Novalis, Hölderlin und Kleist waren für den neuen Nationalismus anfällig; Goethe war und blieb gegen ihn immun. Als man um 1795 herum anfing, den berühmten Goethe als die zentrale Figur der deutschen Literatur seiner Zeit einen „klassischen deutschen Nationalautor“ zu nennen, hat er dies umgehend zurückgewiesen, und je mehr sich der Geist des Nationalismus in Gesellschaft und Literatur
[<< 26]
breit machte, desto entschiedener hat er sich gegen jede Vereinnahmung verwahrt.11
So begann Goethe gerade damals, den Begriff der „Weltliteratur“, das Konzept eines literarischen Kosmopolitismus zu propagieren (HA 12, 361–364). Ohnehin hat er sich nie nur mit der deutschen Literatur allein, sondern immer auch mit der des Auslands beschäftigt. Unausgesetzt hat er sich darum bemüht, den Deutschen französische, englische, italienische, ja sogar persisch-arabische, indische und chinesische Literatur nahezubringen, und in seinen eigenen Werken hat er immer wieder den produktiven Dialog mit diesen fremden Literaturen gesucht. „National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit“,12 so Goethe selbst – für den neuen Nationalismus eine unerträgliche Provokation. Für Goethe war die Literatur nicht so sehr der Ort, an dem ein nationales Selbstbewußtsein entsteht, an dem ein deutscher „Volksgeist“, eine deutsche „Volksseele“, ein deutsches Wesen ausdruckshaft zum Vorschein kommen, um in ihren Produktionen ihrer selbst innezuwerden und ein klares Bewußtsein von sich selbst zu gewinnen, als vielmehr ein Ort, an dem Menschen der unterschiedlichsten Herkunft und Lebensweise einander auf der Basis der „allgemeinen Menschennatur“ begegnen können.13
Nationalismus und Germanistik
Aber was Goethe auch immer in diesem Sinne unternahm – der Gedanke der Nationalliteratur war nicht mehr aufzuhalten, er setzte sich durch, und Goethe wurde als Zentralfigur der deutschen Literatur für ihn vereinnahmt, wurde zum „klassischen deutschen Nationalautor“ ausgerufen, und sein Werk zum Höhepunkt und Inbegriff einer deutschen Nationalliteratur. Man kann diese Vereinnahmung auch eine Fälschung nennen. Zur wichtigsten Werkstatt solcher Falschmünzerei wurde aber bald schon die neue Wissenschaft der Germanistik. Mit
[<< 27]
einer Lüge hat sie das Licht der Welt erblickt, der schiefe Blick war ihr Geburtsfehler, und manchmal möchte man meinen, daß er bis heute ihr Markenzeichen geblieben sei, wenn sie sich seither natürlich auch in manch anderen Formen des Schielens geübt hat.
Schon jetzt dürfte deutlich sein, wie wichtig es ist, sich bereits bei der ersten Annäherung an die Literatur der Goethezeit Rechenschaft vom Klassik-Mythos zu geben. Solche Rechenschaft ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, etwas von dem in den Blick zu bekommen, was diese Literatur ursprünglich war und sein wollte. Dabei handelt es sich offensichtlich nicht nur um das Abtragen eines historischen Firnis, sondern um sehr viel mehr, nämlich um die Neutralisierung dessen, was die Fälscherwerkstatt des Nationalismus aus dieser Literatur gemacht hat. Die eifrigsten Arbeiter in dieser Fälscherwerkstatt waren aber nun einmal die Germanisten; sie mußten es sein, denn die raison d’être ihrer Disziplin war zunächst eben nichts anderes, als die Literatur der Goethezeit als Blütezeit der deutschen Nationalliteratur zu erweisen, sie als Raum der Epiphanie des deutschen Wesens darzustellen und in Erinnerung zu halten.
Die Ausarbeitung des Klassik-Mythos zur Klassik-Doktrin
Wie bereits angedeutet, entstand die Neugermanistik in zwei Schritten. Der erste Schritt war das Konzipieren von Geschichten der deutschen Nationalliteratur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Schaffung einer Geschichtsschreibung, die die Geschichte der deutschen Literatur als Geschichte einer Nationalliteratur zur Darstellung brachte.14 Bei Gervinus ist gut zu sehen, wie dieses neue Konzept umgesetzt wurde. Die ganze deutsche Literatur soll auf die Weimarer Klassik, auf das Werk Goethes und Schillers hinauslaufen. Die Literatur des Mittelalters, Luther, Opitz, Lessing – das alles sollen nur Stufen auf dem Weg hinauf zum Gipfel der Klassik gewesen sein, und seit dem Tod Goethes, ja schon mit dem altersbedingten Erlahmen seiner schöpferischen Kraft soll es mit der deutschen Literatur wieder bergab gegangen sein.15
[<< 28]
Lessing, der Sturm und Drang, die Klassik und die Romantik werden dabei als Stationen eines Prozesses verstanden, in dem der Einfluß des Auslands, insbesondere der der französischen Kultur, nach und nach immer weiter zurückgedrängt worden wäre, so daß der deutsche „Volksgeist“ immer entschiedener und bewußter zu sich selbst hätte finden können – bis dahin, daß er in Goethe und seinen Mitstreitern schließlich ganz bei sich selbst angekommen wäre und Werke hätte entstehen lassen, die als sein vollkommener Ausdruck gelten könnten. Dementsprechend erscheinen diese Werke hier als ideale Medien einer Kultur der deutschen Identität, als Werke, deren Lektüre die Deutschen ihrer nationalen Identität innewerden ließe und aus ihnen eine selbstbewußte, ihrer selbst gewisse, in sich gefestigte Nation machen würde.
Goethe selbst hat sich, wie angedeutet, in diesem Modell nicht wiedererkennen mögen und statt dessen eine Weltliteratur propagiert. Damit zog er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trotz seiner Verklärung zum Klassiker immer wieder Kritik auf sich, bei Romantikern wie den Brüdern Schlegel und Ludwig Tieck oder dann auch bei einigen Jungdeutschen der Vormärz-Zeit wie Wolfgang Menzel. Goethe war insofern in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ein durchaus umstrittener Autor. Aber in der zweiten Jahrhunderthälfte hat sich diese Kritik dank der Arbeit der Neugermanisten dann wieder gelegt; die Vereinnahmung Goethes für das Konzept einer deutschen Nationalliteratur war abgeschlossen.16
Die Neugermanistik an Universität und Schule
Eine Voraussetzung für diese durchschlagende Wirkung war, daß sich die Neugermanistik damals an den Universitäten als ein eigenes Fach, als besondere akademische Disziplin hatte etablieren können, daß nun überall Lehrstühle für neuere deutsche Literatur eingerichtet worden waren – der zweite große Schritt in der Entwicklung der Neugermanistik. Zugleich wurde die neuere deutsche Literatur zu einem Gegenstand des Schulunterrichts; denn das war sie zuvor nur in engen
[<< 29]
Grenzen gewesen. Damals entstand z. B. Reclams Universalbibliothek, entstand das Institut des Reclamhefts, wie es die wachsende Nachfrage nach wohlfeilen Ausgaben literarischer Texte in Universität und Schule erkennen läßt; das Reclamheft Nr. 1 brachte 1867 bezeichnenderweise eine Ausgabe von Goethes „Faust“, der „Bibel der Deutschen“.
Die Neugermanistik zwischen klassischem Erbe und Moderne
Die Neugermanistik blieb dem Konzept der Nationalliteratur und der Ausrichtung auf die Blütezeit von Klassik und Romantik bis weit ins 20. Jahrhundert hinein treu, bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, im Osten Deutschlands nicht weniger als im Westen. Und dies, obwohl seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, seit dem Naturalismus von Arno Holz und Gerhart Hauptmann und dem Symbolismus von Stefan George, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke eine moderne Literatur entstanden war, die die Literatur von Klassik und Romantik nicht mehr fraglos als klassisches Vorbild begriff, die alle epigonale Orientierung an der Vergangenheit hinter sich lassen und etwas ganz anderes, etwas durchaus Neues versuchen wollte; die sich vielfach auch weniger als Teil einer Nationalkultur verstand denn vielmehr als Teil einer internationalen Moderne. Für die Germanistik wurde der Siegeszug der literarischen Moderne zunächst vor allem zu einem Anlaß, auf die bleibende Bedeutung des klassisch-romantischen Erbes hinzuweisen und es als einen unverlierbaren Schatz, als einen ewigen Hort des Wahren-Guten-Schönen der fortschreitenden Modernisierung entgegenzuhalten, als unverlierbaren Halt im Wirbel der „totalen Mobilmachung“ der Moderne.
Solange die Germanistik ihre Aufgabe so sah, hatte sie natürlich keinen Grund, mit dem Begriff der „Goethezeit“, den Epochengrenzen 1770 und 1830 und dem Bild vom Entwicklungsgang der deutschen Literatur unzufrieden zu sein, das die nationale Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts gezeichnet hatte. Daß daran manches zu kritisieren sein könnte, ging ihr erst auf, als sie die Literatur des 20. Jahrhunderts, die moderne Literatur im engeren Sinne, ernst zu nehmen begann, und das heißt: als sie damit begann, diese als eine Literatur zu nehmen, die eigenen Gesetzen gehorchte und sich nicht mehr am Maß der Klassik messen ließ. Was sie seither an kritischen Überlegungen angestellt hat, kam freilich nicht nur dem Verständnis der Moderne des 20. Jahrhunderts zugute, sondern auch dem von Klassik und Romantik, ja dem aller Epochen, der
[<< 30]
älteren nicht weniger als der jüngeren. In eben dem Maße, in dem man sich von den Insinuationen der nationalen Literaturgeschichtsschreibung löste, wurde ein freierer Blick auf die gesamte deutsche Literatur möglich.
Wie sieht nun das überkommene Epochenschema im einzelnen aus, und was ist an ihm aus heutiger Sicht zu kritisieren?