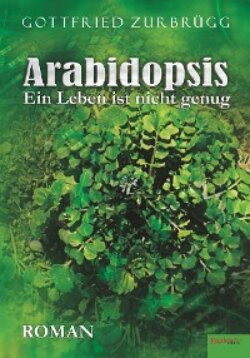Читать книгу Arabidopsis – ein Leben ist nicht genug - Gottfried Zurbrügg - Страница 13
7. KAPITEL
ОглавлениеSybille Walter fuhr gleich nach dem Telefongespräch nach Hause, um sich für den Abend vorzubereiten. „Ich bin einer ganz großen Sache auf der Spur“, hatte sie ihrem Chef gesagt und gleich frei bekommen.
Erst vor dem Spiegel fand sie sich wieder. Sie war so in Gedanken gewesen, dass sie sich an die Autofahrt gar nicht mehr erinnern konnte. Wie war sie wohl gefahren? Den Gedanken an mögliche Strafzettel schob sie einfach von sich. Jetzt war etwas anderes wichtiger.
„Wie sehe ich aus?“, fragte sie ihr Spiegelbild.
„Willst du so zum Herrn Professor?“, fragte das zurück.
„Natürlich nicht! Aber wer weiß?“ Sie trug nur Spitzenhöschen und einen weißen Spitzen-BH. Prüfend ließ sie den Blick über die Figur gleiten. Sie konnte zufrieden sein: der Busen nicht zu groß, der Bauch flach. Prüfend legte sie die Hand dorthin. Ja, sie musste mit dem Essen aufpassen. Der Po wohl gerundet, alles war so, wie sie es mochte. Sie spürte eine kribbelnde Erregung, als sie sich so im Spiegel betrachtete.
„Wollen der Herr Graf den Tanz mit mir wagen?“, trällerte sie frei nach Mozart vor dem Kleiderschrank. Sie würde den schwarzen Hosenanzug anziehen, der ihre Figur so sehr betonte, und die durchsichtige, schwarze Bluse, die doch alles bedeckte. Darunter?
„Nichts“, sagte ihr Spiegelbild. „Du kannst dir das leisten.“
„Lass das!“, sagte sie und schloss die Schranktür. „Ich bin als Journalistin dort.“ Und wenn sie zunächst die Jacke anbehielte? Warum nicht? Sie öffnete erneut den Schrank und nahm entschlossen die Kleidung heraus.
Ihr Spiegelbild in der Schranktür grinste sie an. „Du wagst eine ganze Menge!“
„Aber gern!“, gab sie zurück.
Dagmar Scherrer fuhr mit ihrem Wagen langsam den Ring entlang nach Durlach. Der Tag war gut gelaufen. Die Verhandlungen hatten den gewünschten Erfolg gezeigt. Sie freute sich auf den Abend und kontrollierte ihr Aussehen im Rückspiegel. Das Make-up saß nach dem langen Tag noch tadellos. Auch die langen blonden Haare hielten in der hochgesteckten Frisur. Ob ihr Mann schon zu Hause sein würde? Heute lagen keine besonderen Konferenzen an. Jedenfalls hatte er nichts dergleichen gesagt. Sie bog in die Straße ein und sah zum Haus hoch. Aus dem Arbeitsraum ihres Mannes leuchtete schwach die Abendbeleuchtung. Er war also nicht da. Für einen Augenblick spürte sie die Enttäuschung wie einen Stich durchs Herz. Aber hatte sie wirklich erwartet, dass er schon zurück wäre? Mechanisch fuhr sie den Wagen in die Garage und ging zum Haus hoch. Irmgard kam ihr entgegen. „Ist mein Mann da?“, fragte sie und wusste schon die Antwort.
„Nein, er hat eine Nachricht gesandt, dass er spät kommen wird. In der Badischen Weinstube findet eine Konferenz für Journalisten statt. Es geht um …“
„Danke“, unterbrach Dagmar Scherrer. „Ich weiß.“ Sie ließ offen, was sie wusste.
„Möchten Sie zu Abend essen?“, fragte Irmgard besorgt. „Wo darf ich servieren?“
„Danke, ich werde warten.“
Irmgard knickste und zog sich zurück.
Als Dagmar Scherrer das Haus betrat, fiel ihr das Gesicht der Katzengöttin auf. Jeden Abend war sie an dieser Statue vorbeigegangen, aber heute hatte sie den Eindruck, die gemeißelten Augen würden sie aus dem schwarzen Granit anschauen. Erstaunt legte sie den Mantel ab und ging in das Arbeitszimmer ihres Mannes. Durch das große Fenster sah man die Silhouette von Karlsruhe gegen den Abendhimmel. Sie blieb am Fenster stehen, bis die Schatten nicht mehr zu sehen waren und überall in der Stadt die Lichter angingen.
„Unsere Zeit war schön, Edwin, und ich danke dir. Jetzt gehen wir beide ganz unterschiedliche Wege“, sagte sie leise. Sie lauschte dem Klang ihrer Worte nach und vermisste die Trauer darin. „Jeder geht schon lange seinen eigenen Weg. Hoffentlich ist deiner ein guter Weg.“
„Brauchen Sie noch etwas?“, fragte Irmgard, die zur Tür hereinschaute.
„Nein, danke, Irmgard. Ich möchte nicht mehr gestört werden.“
Sie setzte sich in den großen Sessel und zündete eine Zigarette an. Es wurde dunkel im Zimmer. Die Skulpturen verschwammen zu Schatten, und nur die Glut der Zigarette leuchtete wie ein roter Stern.
Sybille hastete am Schloss vorbei durch den alten Botanischen Garten. Das Halbrund der Badischen Weinstube war nur wenig beleuchtet. Es war noch zu kühl, um draußen zu sitzen. Rasch stieg sie die Stufen hoch. An der Tür kam ihr Scherrer bereits entgegen.
„Wie schön, dass Sie kommen konnten.“ Scherrer lächelte überlegen. „Ich habe gedacht, dass Sie ein privates Gespräch vorziehen würden. Ich hoffe, es ist Ihnen recht so.“ Seine blauen Augen sahen sie auffordernd an.
Sybille nickte. „Sie hätten aber nicht so viele Umstände machen sollen“, sagte sie verlegen.
„Umstände?“ Er lachte mit angenehmer, tiefer Stimme. „Aber ich bitte Sie. Kommen Sie. Ich habe einen Tisch bei meinem guten Freund Natan bestellt. So hat man einen schönen Blick auf den Garten. Möchten Sie ablegen?“
Natürlich, sie hatte ja noch die Jacke an. Einen kurzen Augenblick zögerte sie, dann lächelte sie und sagte: „Danke, gerne, Herr Professor.“
Gewandt half er ihr aus der Jacke. Einen kleinen Augenblick bedauerte sie, dass sie nicht wenigstens einen BH unter der fast durchsichtigen, schwarzen Bluse trug. Aber dann sah sie die Überraschung in seinen blauen Augen aufblitzen. Man kann nur etwas sehen, aber noch nicht alles, dachte sie. Appetit machen darf man. Wäre ein Tisch bei Don Juan nicht ehrlicher gewesen, Herr Professor?
„Zum Wohl!“ Sie stießen mit Sherry an.
Dann kamen die Köstlichkeiten des Hauses auf den Tisch: Schnecken und Krustentiere. Professor, willst du mich prüfen? Aber das ist kein Problem, dachte Sybille amüsiert. Geschickt ließ sie sich die Gerichte schmecken. Schwieriger war es, den unterschiedlichen Weinen standzuhalten, die zu den Gängen serviert wurden. Ihm schien das nichts auszumachen. Er plauderte nebenbei über Journalismus und Gentechnik. Was er gesagt hat, ist wichtig, dachte Sybille, aber ich kann doch jetzt keinen Block herausnehmen und mitschreiben. So stellte sie interessierte Zwischenfragen und merkte, wie es für sie immer schwieriger wurde, dem Gespräch zu folgen. Plötzlich lachte sie laut. „Ich glaube, ich habe einen Schwips. Professor, Sie haben mich betrunken gemacht, weil Sie mich verführen wollen. Ich hätte auch so mit Ihnen geschlafen!“
„Schade, wir waren so gut ins Gespräch gekommen!“, bedauerte Scherrer.
Hatte sie alles verdorben? In ihrem Kopf drehten sich die Gedanken und fanden weder Anfang noch Ende.
„Ich bringe Sie heim“, schlug Scherrer vor, als sei er um sie besorgt. Er stand auf, wartete, bis auch sie aufgestanden war, half ihr in die Jacke, nahm sie sorgsam am Arm und führte sie aus dem Restaurant, nachdem er dem Kellner rasch seine Karte gegeben hatte. Alles war so leicht, so schwebend.
„Professor, ich möchte Sie auf der Stelle küssen“, gestand Sybille. „Ich habe mich gleich in Sie verliebt, als ich Sie das erste Mal sah!“ Mit diesen Worten fiel sie ihm einfach um den Hals.
„Bitte rufen Sie uns ein Taxi“, forderte Scherrer den Kellner auf, der ihnen gefolgt war.
Als es da war, führte er Sybille zum Wagen und stieg mit ein. Sybille war wach genug, ihre Adresse zu nennen und auch noch die Haustür aufzuschließen. Aber dann fiel sie in seine Arme und schlief fast. Scherrer brachte sie in das Schlafzimmer ihrer kleinen Wohnung.
Der Mond schien ins Zimmer, als Scherrer sie verließ. An der Tür blieb er stehen und sah zurück auf die schlanke Frau im Bett. „Ich danke dir, Sybille“, flüsterte er. Sybille drehte sich, als habe sie etwas gehört, und schob die Decke zur Seite. Aber dann lag sie still auf dem Rücken und der Mond streute sein fahles Licht über sie. Ihr weißer Körper verschwamm mit dem Weiß des Bettlakens, nur ihr schwarzes Dreieck hob sich deutlich im Dunkel ab. Scherrer stutze einen Augenblick. „So ist das gemeint“, sagte er leise. „Ihr Ägypter habt gut beobachtet. Der Schoß der Isis! Die Gestalt der Göttin verschwimmt mit dem dunklen Blau des Himmels, aber ihr Schoß ist deutlich zu sehen.“
Ein plötzlicher Hustenanfall nahm ihm den Atem. Er versuchte ihn zu unterdrücken. Alles begann sich um ihn zu drehen, auch die weiße Frau auf dem Bett. Die Farben verkehrten sich ins Gegenteil: Das Laken und die Frau wurden schwarz, und weiß leuchtete ihr Dreieck im wilden Wirbel, bis nur noch ein leuchtender Punkt zu sehen war. Das ist das Ende, dachte Scherrer merkwürdig unberührt und hielt sich an der Tür fest. Werde ich die Götter sehen oder wird sich gleich ein schwarzer Wirbel auftun und mich herabziehen? Aber dann bekam er wieder Luft. Der Krampf in seinem Hals löste sich und er richtete sich auf.
Leise ging er zu Sybille und deckte sie zu. Dann hauchte er einen Kuss auf ihre Stirn und ging zur Tür. Geräuschlos öffnete er, sah sich noch einmal um und verschwand. Sirius! Wie nah war ich den Sternen, wie nah dem Paradies, dachte Scherrer, als er zur Haltestelle ging.
Der Morgen wurde dunkelblau, als Scherrer in die erste Bahn stieg. Er sah noch einmal zurück zu den Fenstern. Nein, dachte er, Leben will ich. Das Leben suche ich und nicht den Tod. Er unterdrückte den Husten, der wieder aufkommen wollte. „Deine Medikamente, Robert, haben genau so lange gehalten, wie ich es brauchte“, stellte er fest, als die Bahn anfuhr.
An der Haltestelle Durlacher Tor zögerte er. Sollte er aussteigen und gleich ins Labor gehen? Aber es zog ihn nach Hause, in sein Arbeitszimmer, zurück in die Höhle, ausgestattet mit Büchern und Wissen. Ja, meine Höhle, dachte Scherrer. Dort kann ich verwundbar sein, denn mein Wissen schützt mich.
Erst in Durlach stieg er aus und bog in die Straße zu seinem Haus ein. Danke, Robert, für das Spiel des Lebens, dachte er, es war so einfach, Sybille zu verführen. Unwillkürlich musste er lachen. Wer weiß, was sie sich vorgestellt hat. Sie war eine Puppe in meinen Armen. Oder war ich der Vampir in den ihren?, fragte er sich. Habe ich Lebenskraft in mich aufgenommen, als ich neben ihr lag und ihre jugendliche Wärme spürte? War es das, was ich gesucht habe? Die Lust eines alternden David, der nicht mehr warm wurde und dem man Abigail als Gefährtin gab? So berichtet es die Bibel. Die Menschen wussten sehr viel um das Geheimnis des Lebens. War sie meine Abigail?
„Ich war der Handelnde“, sagte er laut. „Ich war der, der ihr Leben gab. Ich war der, der die Fäden in der Hand hielt. Sie hat es genossen. Sie wird nichts bereuen.“
Er ging die Straße entlang. Ich fahre doch bald wieder los, dachte er, nach Remchingen zu Robert. Es war ihm, als hätte das jemand anders gesagt. „Ja“, sagte er laut. „Ich bin stark genug, auch den Weg zu gehen. Ich habe so viel geschafft. Ich kann noch leben.“
„Noch“, klang es zurück, „noch blühen die Bäume, auch in diesem April, noch erwacht das Leben.“
Scherrer sah zu seinem Haus hoch. Glühte da eine Zigarette in seinem Arbeitszimmer? Ein kleiner roter Punkt schien durch die große dunkle Scheibe. „Wartet Dagmar auf mich?“, fragte er sich. „Ich möchte ihr jetzt nicht begegnen.“
Er blieb auf der Straße stehen. Der rote Punkt verschwand. Sie hat auf mich gewartet. Sie wartet immer noch darauf, dass ich nach Hause komme. Aber mein Weg führt mich weit fort. Ich kehre nicht zu ihr zurück, nur in mein Haus.
Langsam ging er weiter. Der Morgen kam früh herauf. Die Schatten der Nacht wichen dem Licht eines neuen Tages. Neben der Haustür stand wie immer die Katzengöttin, die er einst aus Ägypten mitgebracht hatte. Scherrer legte seine Hand auf den Katzenkopf aus Granit. Das waren noch Abenteuer. Die Welt war so weit und alles schien erreichbar, dachte Scherrer. Wir hatten die Zukunft vor uns. Alle Wege waren offen. Wir glaubten, die Welt erobern zu können. Aber nun hat sie uns eingeholt.
Wieder fühlte sich der Katzenkopf eigenartig warm an. Scherrer registrierte es unbewusst und ließ ihn los, um den Schlüssel aus der Hosentasche zu nehmen. Nachdenklich schloss er auf, hielt einen Augenblick inne und lauschte. Wie ein Dieb betrete ich mein eigenes Haus, dachte er. Was habe ich wem gestohlen? Ihr die Jugend? Und die Zeit? Mir ein Stück eigenes Leben? Er lachte leise vor sich hin. Ich wollte noch einmal leben. Habe ich das?
Es war alles ganz ruhig im Haus. Niemand schien seine Ankunft zu bemerken. Lautlos ging Scherrer über die dicken Teppiche in sein Arbeitszimmer. Leichter Zigarettenrauch hing in der Luft. Dagmar hat auf mich gewartet, dachte Scherrer. Sie hat zwar darauf gewartet, dass ich wiederkomme, aber sie hat den Augenblick der Begegnung nicht gewollt. Es reicht ihr, dass ich im Hause bin. Schwer ließ er sich in die weichen Polster fallen. Eine unbekannte Müdigkeit überkam ihn. Man kann nur ein Stück Leben genießen, dachte er, immer nur ein ganz kleines Stück.
Die Uhr an der Wand tickte gleichmäßig. Scherrer nahm es im Halbschlaf wahr. Die Zeit anhalten, dachte er, das will ich. Ich will ja nur die Zeit anhalten. Ich will kein ewiges Leben. Ich weiß, dass ewige Jugend nicht möglich ist. Ich will die Zeit anhalten, diese verdammte Zeit anhalten! Der Schlaf hielt ihn schon zu sehr gefangen, als dass er sich noch hätte erheben können.
„Die Zeit ermöglicht uns Bewegung“, sagte jemand neben ihm. Er spürte die Nähe einer jungen Frau neben sich. Sie war schlank und sehr schön. Ihr Gesicht konnte er nicht erkennen. Es kommt nicht auf das Gesicht an, dachte er. Ein Freund aus Jugendtagen fiel ihm ein, der die Gesichter der jungen Frauen immer mit einem Tuch bedeckte, wenn er mit ihnen schlief. „Es kommt nicht auf die Gesichter an. Der Körper ist wichtig. Nur der Körper.“
„Wir brauchen den Körper“, sagte die junge Frau neben ihm. „Nur, wenn es einen Körper gibt, der zu uns gehört, können wir Gestalt annehmen. Nur dann können wir uns frei bewegen. Der Körper muss ewig sein.“
Der Gedanke der alten Ägypter, dachte Scherrer, die Seele kann sich frei bewegen, wenn sie eine Heimat hat, in die sie zurückkehren kann. Wenn sie ein Haus hat, ist das Ka frei. Hat sie es nicht, dann ist sie heimatlos und verweht im Winde.
„Ist das so falsch?“, fragte die Gestalt neben ihm. „Empfindest du es nicht genauso? Hier ist dein Körper. Nicht du, dein Arbeitsraum, deine Bücher, deine Sammlungen. Sie gehören alle zu dir. Auch du kehrst zurück, um wieder dich selbst zu finden. Du brauchst dein Haus, um deinem Ka die Freiheit geben zu können.“
Meine Bücher, meine Forschungen, meine Sehnsucht. Nicht dem ewigen Wandel unterworfen zu sein, dachte Scherrer. Träume ich? Verschwimmen Tag und Traum? Ich muss Anneliese anrufen. Sie muss den Brief an die Welt der Wissenschaften weiterschicken.
„Du musst gar nichts“, sagte die Frau neben ihm. Wie Dagmar, dachte Scherrer, sie würde dasselbe sagen: „Du musst gar nichts.“
Er wollte aufstehen, aber seine Glieder gehorchten ihm nicht. Er wollte fortlaufen, aber er kam nicht voran. Natürlich, Serotonin lähmt die Glieder, dachte er. So entstehen Albträume.
„Das ist kein Traum“, sagte die Gestalt neben ihm. „Du fühlst meine Haut. Du fühlst meine Wärme. Es ist nicht die Wärme der jungen Frau von heute Nacht. Wir sind älter. Wir bestehen durch alle Zeiten.“
Nur nicht fragen, wer sie ist, dachte Scherrer. Ich will es nicht wissen. Er wagte auch nicht, den Kopf zu drehen.
„Du würdest es auch nicht verstehen, Scherrer“, sagte sie. „Du bist Wissenschaftler. Du hast deine Skulpturen gesammelt, weil es dir Freude machte, Gegenstände in der Hand zu halten, denen andere Leben eingehaucht hatten. Du hast das Leben gespürt, aber du hattest selber genug Leben, um nur die Kälte des Steins zu fühlen. Nun hast du gemerkt, dass der Stein warm ist.“
Scherrer verspürte keine Lust, zu diskutieren, und überließ sich dem Schlaf. Die Gegenstände um ihn herum begannen zu leben. Die Katzenstatue vom Eingang seines Hauses, die Göttin Bastet, ging durch den Raum. Er sah die schlanke Figur, den angedeuteten Rock tief auf der Hüfte, aber den Kopf nur von hinten. Es kommt auf den Kopf nicht an, dachte er lächelnd im Schlaf. Es geht um den Körper, nur um den Körper. Geschmeidig schlich Bastet durch den Raum und berührte die kleine Göttin Selekit, die aus ihrem Schlaf erwachte. Ihre goldenen Flügel erhielten schwarz-weiße Federn. Die Flügel begannen zu schlagen, aber Scherrers Augen wurden abgelenkt. Die Kanopen auf dem Bücherregal erwachten. Wieder war es Bastet, die ihnen mit der Hand über den Kopf strich. So wie ich es vorhin getan habe, dachte Scherrer, als ich den Stein zum Leben erweckte. War ihm der Stein nicht warm vorgekommen?
Zu spät! Scherrer sank tiefer in den Schlaf. Er sah noch, wie sich die Köpfe der Kanopen bewegten, und hörte, wie die Katze sagte: „Wir haben kein Recht, uns in die Welt der Menschen einzumischen. Die Götter und die Menschen leben in unterschiedlichen Zeiträumen. Wir können sie nicht verstehen, und sie verstehen uns nicht.“
Er hätte zu gern gewusst, was die Kanopen antworteten, aber er hörte sie nicht mehr. Wohlige Dunkelheit umgab ihn.
Er erwachte, wie es ihm schien, kurze Zeit später. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber der Morgen erhellte schon den Raum. Alles war an Ort und Stelle. Die kleine Selekit breitete ihre goldenen Flügel aus wie immer. Goldene Flügel, nicht die Farben der Geierflügel, die er im Traum gesehen hatte. Er streckte sich. Seine Glieder schmerzten von der ungewohnten Lage. Die Uhr schlug sechs. Die Zeit anhalten, dachte Scherrer. Mein erster und mein letzter Gedanke. Wenn man das könnte! Ich will keine Ewigkeit. Ich will kein Leben, das hin und her pendelt zwischen der Wirklichkeit und dem Traum. Ich will nicht durch eine Scheintür zwischen den Welten hin und her wandern. Sei es nun eine bemalte Scheintür in einem Grab oder der Bildschirm an meinem Computer, der schwarz wird und trotzdem etwas zeigt, was ich nicht sehen kann. Ich will die Welt der Götter nicht, aber ich will auch nicht im Tod versinken, im Nichts. Ich will nicht vergehen! Die Zeit anhalten! War da nicht Anne Neidhardt mit dem geheimnisvollen Todesgen in der Arabidopsis? Hatte sie eine innere Uhr gefunden? Eine unsterbliche Pflanze? Ob es das gab? Potentiell war das möglich, den Pflanzen möglich. Auch Tiere und Menschen hatten innere Uhren. Wie war das, wenn man die Uhr anhielt? Ob das ginge? Leben ohne Tod. „Der Tod ist das Geheimnis des Lebens, denn nur mit ihm ist so viel Leben möglich“, sagte einst Goethe, der Denker, der ungewöhnliche Naturwissenschaftler, der Mann, der andere Wege ging. Ob ich auch andere Wege gehen werde?
Der unerbittliche Husten stellte sich wieder ein. „Das ist das Leben“, sagte Scherrer, „ein ständiger Kampf gegen den Tod, den wir nur verlieren können.“ Er sagte es wie eine Frage, aber die Bücher und Statuen gaben keine Antwort, die er nicht schon Hunderte Male gelesen hatte. Er kannte das ägyptische Totenbuch. Die Reise durch die Zwischenwelt, vorbei an den Gottheiten, die das Herz wogen. „Was habe ich in die Waagschale zu legen?“ Diese Frage stand plötzlich im Raum. Habe ich stets nur genommen? Habe ich immer nur genossen oder auch gegeben? „Ich habe gesucht“, sagte Scherrer, „und ich suche noch immer nach einer Antwort.“ Ob das zählen würde? Er wusste es nicht.
Zaghaft klopfte es an der Tür. „Herein“, rief Scherrer. Das musste das Hausmädchen sein. Dagmar würde nicht anklopfen. Es war das Mädchen. „Möchte der Herr frühstücken?“, fragte Irmgard.
Er wollte fragen, woher sie wusste, wo er zu finden war. Aber das Hauspersonal hatte auch so seine Geheimnisse. „Ist meine Frau schon auf?“, fragte er und wusste gleichzeitig, dass er sie nicht sehen wollte.
„Die gnädige Frau erwartet Sie um 8.00 Uhr im Esszimmer. Möchten Sie einen Kaffee?“, fragte sie.
„Ja, gerne“, antwortete Scherrer, „ein Kaffee wäre schön. Bitte stellen Sie ihn hier ins Arbeitszimmer. Ich habe noch zu tun und möchte mich eben frisch machen.“
Mit keiner Miene zeigte das Hausmädchen, dass sie sich wunderte. Gutes Personal ist viel wert, dachte Scherrer unwillkürlich und ging aus dem Raum, um sich im Bad fertig zu machen.
Im Bad lagen saubere Wäsche zum Wechseln, ein frisches Hemd und auf dem Bügel hinter der Tür hing ein anderer Anzug. Ein Gruß von Dagmar, meiner Frau, dachte Scherrer in einem Anflug von Zärtlichkeit. Sie kennt mich seit vielen Jahren. Einen Augenblick überkam ihn ein melancholisches Gefühl von Einsamkeit. Wir haben uns verloren. Vielleicht schon vor langer Zeit.
Er schaute in den Spiegel und erschrak vor seinem eigenen Spiegelbild. Die sonst so gepflegten Locken hingen wirr in seine Stirn. Er hatte es gar nicht bemerkt. Die Augen waren ein bisschen blutunterlaufen. Die Lider hingen schlaff herunter. Der Mund war schmal und zusammengekniffen. Ein Gesicht nach einer Nacht voller Unruhe und wenig Schlaf.
Scherrer zog sich langsam aus und duschte ausgiebig. Dann rasierte er sich sorgfältig. Ganz in Gedanken griff er zu dem Schalter unter dem Waschbecken und drückte ihn. „Morgendlicher Befund“, sagte seine Stimme vom Tonband. „Augen klar, Zahnfleisch gut durchblutet, Zunge ohne Belag.“ Lächelnd sah er sich an, griff erneut nach dem Schalter und stellte das Tonband ab. Eine endlose Reihe von Tagen, an denen alles immer gleich war.
„Gesund und ohne Befund“, sagte er. „Ich habe geglaubt, es müsse immer so sein.“
Langsam kleidete er sich an. Ein Kratzen im Hals mahnte ihn erneut an den längst fälligen Arztbesuch. Scherrer nahm ein Papiertuch aus dem Spender und hielt es vor den Mund Ein neuer Husten schüttelte ihn. Als der Anfall endlich vorbei war, war das Taschentuch leicht gerötet. Scherrer sah die Blutspuren betroffen an und warf das Tuch in den Mülleimer. Er kämmte seine grauen Haare, kniff den Sitz der Locken mit zwei Fingern nach und zog sich sorgfältig an. Bevor er hinunterging, kontrollierte er den Sitz der Krawatte und des Anzugs. Er war zufrieden. Die heiße Dusche hatte die Spuren der Nacht beseitigt. Scherrer griff nach einem Becher, ließ Wasser einlaufen, gab einige Tropfen Mundwasser hinzu und gurgelte mit dem Wasser, um den Blutgeschmack im Munde zu beseitigen. Vorsichtig spuckte er aus, um seinen Anzug auf keinen Fall zu beschmutzen. Dann warf er sich einen letzten Blick zu, freute sich daran, dass sein Mund wieder überlegen lächelte, und begab sich zurück in seinen Arbeitsraum.
Der Kaffee stand bereit. Scherrer trank einen Schluck und spürte, wie das heiße Getränk in den Magen rann, wie sich die Wärme in seinem Körper ausbreitete. Dann ging er an seinen Schreibtisch, stellte den Computer an und wartete geduldig, bis das Programm hochgefahren war. Flink eilten seine Finger über die Tasten und schienen sie kaum zu berühren.
„Interview mit Professor Scherrer“, schrieb er und stellte die wichtigsten Gedanken des Gesprächs mit Sybille zusammen.
Dann nahm er das Telefon, wählte die Nummer seines Büros und bat seine Sekretärin um einen Gefallen. „Ich überspiele Ihnen einen Text über das Internet“, erklärte er, „bitte drucken Sie ihn aus und schicken ihn per Boten in die Redaktion der Welt der Wissenschaften.“
„Selbstverständlich“, sagte Anneliese. „Haben Sie sonst noch einen Wunsch?“
„Auf meinem Schreibtisch liegt ein Umschlag für Frau Sybille Walter. Bitte legen Sie ihn zu dem Bericht.“
Sie ging in sein Büro und fand dort schnell, was er meinte. „Ich habe ihn gefunden, Herr Professor“, sagte sie. „Wann werden Sie heute hier sein? Es liegen einige Termine an.“
„Ich komme später“, sagte er. „Der lästige Husten. Ich muss endlich zum Arzt. Sie wissen doch …“
„In Ordnung, Herr Professor“, sagte Anneliese und dachte: Männer und Arzt!
Scherrer lehnte sich entspannt zurück, als es an der Tür klopfte. „Ja, bitte“, rief er.
Irmgard öffnete und sagte: „Die gnädige Frau lässt bitten!“
„Danke“, sagte Scherrer und erhob sich. „Ich bin gleich bei ihr.“
Dagmar Scherrer saß mit dem Rücken zur Tür. Das war ihr Platz, aber heute hatte Scherrer das Gefühl, als säße sie absichtlich so, um ihm noch einen winzigen Moment Zeit zu geben, und er war ihr dankbar dafür. Er sah ihren schlanken Rücken, die gerade Haltung, mit der sie am Tisch saß, die stets korrekten, hochgesteckten, blonden Haare. Ja, sie war seine Frau, die seine Karriere sehr gefördert hatte, die es verstand, auf Empfängen die richtigen Leute im rechten Ton anzusprechen. Sie hörte ihn und drehte sich zu ihm um. „Danke, dass du dir Zeit nimmst. Sicher hast du sehr viel zu tun“, sagte sie. Es war eine Feststellung, aber sie legte ihm damit auch alle Worte zur Entschuldigung hin.
„Ich habe die Nacht im Arbeitszimmer verbracht“, sagte er und beugte sich zu ihr hinunter, um ihr einen Kuss auf die Stirn zu hauchen. „Es ist sehr spät geworden und die Gedanken haben mich dann nicht mehr losgelassen.“
„Setz dich“, sagte Dagmar. „Möchtest du auch etwas frühstücken?“
Scherrer nickte und nahm ihr gegenüber Platz. Irmgard schenkte ihm Kaffee ein, aber Dagmar bat sie mit einer Handbewegung, sich zurückzuziehen. Jetzt kommt es, dachte Scherrer, aber Dagmar lächelte ihn an.
„Waren es neue Erkenntnisse zu den Experimenten, die dich nicht schlafen ließen?“, fragte sie.
Scherrer griff ihre Worte gerne auf. „Es geht um sehr viel. Endlich nehme ich wieder an der Forschung teil.“ Aber dann merkte er, dass Dagmar gar nicht zuhörte. Erneut versuchte er ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. „Wir arbeiten im Institut ganz wunderbar zusammen“, erzählte er.
„Ich weiß“, bestätigte Dagmar abwesend. „Aber darum geht es nicht. Wovor hast du eigentlich Angst?“, fragte sie ihn direkt und sah ihm forschend in die Augen.
Scherrer zuckte zusammen. Eine solche Frage hatte er nicht erwartet. „Angst?“, fragte er und seine Stimme klang heiser.
„Edwin“, sagte Dagmar leise, „wir sind seit so vielen Jahren verheiratet. Du bist oft spät heimgekommen oder die Nacht über fortgeblieben, aber noch niemals hast du angezogen im Arbeitsraum übernachtet. Irgendetwas muss dich ungeheuer beschäftigt haben. Hast du kein Vertrauen zu mir?“ Liebevoll sah sie ihn mit ihren blauen Augen an.
Scherrer dachte nach. Was kann, was will ich ihr sagen?, fragte er sich. Was weiß sie? Sybille? Rasch verwarf er den Gedanken. Nein, Dagmar ging es nicht um Eifersucht wegen eines kleinen Abenteuers, es ging ihr um ihn, um ihn ganz persönlich.
„Wir haben im Institut eine neue Forschung begonnen“, sagte er. Dagmar schaute ihn konzentriert an. „Es geht um Todesgene.“
„Ja“, sagte Dagmar, als er zögerte. „Gene, die den Tod auslösen. Ist das richtig?“
„Korrekt“, antwortete Scherrer und fühlte sich wieder auf sicherem Boden. „Wir haben bei Arabidopsis ein Todesgen festgestellt. Beziehungsweise, Frau Neidhardt vermutet es. Als sie hier war, hat sie mir genau erklärt, was sie sucht. Wenn sie es gefunden hat, möchte sie das Gen auf Baumwolle übertragen und so die gefährlichen Spritzmittel überflüssig machen.“
„Das ist ihre Forschung“, stellte Dagmar fest. „Was ist deine?“
„Meine?“, fragte Scherrer. „Meine Aufgabe ist es, die Mittel dafür durch Sponsoren bereitzustellen.“
„Es geht um dich“, sagte Dagmar. „Um dich und uns! Ist der Husten so schlimm? Hast du Angst, dass mehr dahinter steckt?“
Scherrer sah sie unsicher an. „Ich gehe nicht gern zum Arzt“, gestand er.
„Welcher Mann kann damit schon umgehen?“, fragte Dagmar. „Konsultierst du einen Spezialisten?“
„Zunächst Robert in Remchingen.“
„Ich kenne ihn“, sagte Dagmar. „Er ist seit Jahren mein Hausarzt.“
„Dein Hausarzt?“, fragte Scherrer, und plötzlich klang Besorgnis in seiner Stimme.
Dagmar lachte. „Nein, mir fehlt nichts. Jetzt nicht. Aber hin und wieder braucht man auch einen Arzt und sei es nur zu Vorsorgeuntersuchungen. Viele Dinge erkennt man nicht selber, auch wenn man sich gut beobachtet.“
„Du meinst das Tonband?“, fragte Scherrer und ärgerte sich über seine heisere Stimme.
„Das ist deine Sache“, antwortete Dagmar und trank einen Schluck Kaffee. „Hast du Zeit?“
„Ich habe Zeit“, antwortete Scherrer. „Danke für das offene Gespräch. Wir haben seit Jahren nicht mehr so miteinander gesprochen.“
„Leider“, sagte Dagmar. „Ich möchte nur wissen, wie es weitergeht.“
Scherrer stand auf und trat hinter sie. Er legte seine Hände auf ihre Schultern und sagte. „Dagmar, ich weiß es wirklich nicht.“
„Das Todesgen interessiert dich nicht nur wegen der Arabidopsis, richtig?“, fragte Dagmar.
„Ja“, bestätigte Scherrer.
„Du hast die Ägyptologie auch betrieben, weil dich das Problem der Unsterblichkeit reizt?“, fragte sie weiter.
„Ja, Überlegungen dazu beschäftigen mich seit vielen Jahren. Weniger die Suche nach der Unsterblichkeit, auch nicht die Frage nach einem Leben nach dem Tode. Ich möchte die Uhr anhalten können, die alles Leben vorantreibt!“, sagte Scherrer.
„Und dann?“, fragte Dagmar. „Dann ist Zeit nicht mehr, Vergänglichkeit nicht mehr. Dann gibt es auch keine Bewegung und kein Leben. Was ist dann?“
„Das fragte sie mich gestern auch“, sagte Scherrer.
„Wer?“, erkundigte sich Dagmar. „Die Kleine aus der Redaktion?“
Scherrer zuckte zusammen. Sie wusste also Bescheid. „Nein, eine ägyptische Göttin im Traum“, erklärte er. „Es war ein eigenartiger Traum zwischen Wachen und tiefem Schlaf.“
„Ihr arbeitet in einem Grenzgebiet“, mahnte Dagmar, „da verschwimmen die Grenzen zwischen Forschung und Mystik. Ihr habt euch weit vorgewagt.“
„Aber es geht doch nur um unsere Forschung“, meinte Scherrer, ließ sie los und ging zu seinem Platz zurück. Er setzte sich, nahm einen Toast und bestrich ihn mit Butter.
„Nein, Edwin!“, erwiderte Dagmar ernst. „Und das weißt du auch. Dir geht es um Leben und Tod, um Zeit und Ewigkeit. Wirst du mir Bescheid geben, wenn du gefunden hast, was du suchst?“
„Wie meinst du das?“, fragte Scherrer und ließ das Messer sinken, mit dem er gerade seinen Tost bestrich.
„Du weißt, was ich meine“, sagte Dagmar. „Wir haben keine Kinder. Wir beide sind ganz allein. Ich möchte nur wissen, wann du mich verlässt.“
„Ich suche nur einen Arzt auf“, sagte Scherrer und legte Messer und Toast zur Seite.
„Du hast Post aus Ägypten“, wechselte Dagmar das Thema und wies auf einen Brief, der neben seinem Teller lag.
Scherrer nahm den Brief und öffnete ihn. Interessiert las er ihn durch. „Eine Einladung zu einer besonderen Ausstellung. Das Grab eines ägyptischen Heilers wurde gefunden. Man lädt mich zur Öffnung des Grabes ein. Nubi sprach bereits am Telefon mit mir darüber.“
„Es beginnt“, sagte Dagmar.
„Was beginnt?“
„Ihr seid dabei, Türen zu öffnen, die besser geschlossen blieben. Irgendwie sind wir beide in das Geschehen mit einbezogen. Aber ich weiß nicht wie und warum. Gestern habe ich in deinem Arbeitszimmer auf dich gewartet.“
„Entschuldige, dass ich dich warten ließ“, bat Scherrer und trank einen Schluck Kaffee. „Ich habe den Rauch deiner Zigarette gerochen.“ Er verschwieg, dass er vom Garten aus gesehen hatte, wie lange sie gewartet hatte.
Dagmar lächelte ihn an. „Als ich gestern auf dich wartete, hatte ich das Gefühl, nicht die Einzige zu sein. Auch andere tun das. Es wundert mich nicht, dass du gerade jetzt nach Ägypten eingeladen wurdest. Wirst du fliegen?“
„Ich will das Ergebnis des Arztbesuches abwarten“, antwortete Scherrer.
Schweigend aßen beide ihren Toast und vermieden es dabei, sich anzusehen.
„Du wirst fliegen“, unterbrach Dagmar das Schweigen und fügte hinzu: „Ich weiß es.“